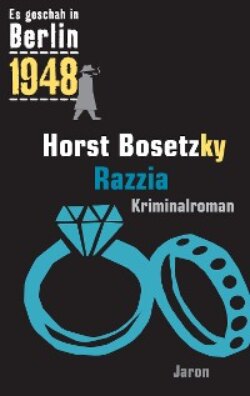Читать книгу Razzia - Horst Bosetzky, Uwe Schimunek - Страница 7
DREI
ОглавлениеEIN FREIES FELD. Schneebedeckt. Je schneller er laufen wollte, desto tiefer sank er ein. Ringsum gab es kleine Anhöhen. Russische Soldaten standen dort und feuerten auf ihn. Wie auf einen Hasen. Und wie ein Hase suchte er sich dadurch zu retten, dass er wilde Haken schlug. Die Russen lachten nur höhnisch und machten sich einen Spaß daraus, so zu zielen, dass die Kugeln ganz dicht an seinem Kopf vorbeipfiffen, ohne ihn aber zu treffen. Noch nicht. «Du Mörder!», schrien sie. «Mörder, Mörder!» Da durchschlug eine Kugel seine Luftröhre. Er röchelte, er war am Ersticken.
Helmut Trompale fuhr schreiend auf und tastete nach der Nachttischlampe. «Scheiße!» Immer wieder derselbe Alptraum. Es ärgerte ihn, dass er ihn nicht besiegen konnte, nicht auslöschen ein für alle Mal. Er war schließlich Boxer und hart im Nehmen. Und in Wirklichkeit hatte die feindliche Kugel ihn nur seitlich am Hals getroffen, ohne Schlagader und Luftröhre zu zerfetzen. Am Dnjepr war es gewesen, am 4. Dezember 1943. Er war danach zum
XXII. Festungs-Infanterie-Bataillon 999 gekommen und hatte das Kriegsende als Obergefreiter in der Schreibstube erlebt. Niemand war bisher gekommen, um ihn dafür anzuklagen, dass er mit seinem Kommando Hunderte von Partisanen erschossen hatte. Die Kameraden, mit denen er sprach, meinten auch, dass ihnen nichts passieren werde, es habe sich schließlich um einen Befehlsnotstand gehandelt.
Er wohnte in der Mariannenstraße, ein paar hundert Meter von der Kottbusser Brücke entfernt, also im Bezirk Kreuzberg, der wie Neukölln, Schöneberg, Tempelhof, Steglitz und Zehlendorf zum amerikanischen Sektor gehörte. Er selbst aber sprach nie von Kreuzberg, sondern immer nur von SO 36, dem Kiez zwischen dem zugeschütteten Luisenstädtischen Kanal und dem Landwehrkanal, der seinen Namen vom Postzustellbezirk Südost 36 herleitete. Man grenzte sich stets ab von jenen anderen Kreuzbergern, die im vornehmeren Zustellbezirk SW 61 zu Hause waren. Trompale war 25 Jahre alt, hatte den Beruf des Kalligraphen erlernt, arbeitete aber derzeit bei einer Schildermalerfirma in der Hobrechtstraße. Wenn er denn arbeitete. Der Handel auf dem schwarzen Markt war nämlich erheblich lukrativer.
Heute am Montag hatte er noch weniger Lust, zur Arbeit zu gehen, als sonst. Er brauche eine Frau, die ihm bei Bedarf in den Hintern treten würde, sagten seine Freunde schon seit langem, doch er hatte die Richtige erst letzten Herbst kennengelernt: Marianne. Die würde ihn schon an die Kandare nehmen und dafür sorgen, dass er regelmäßig zur Arbeit und zum Training ging.
Ein Blick auf seinen Wecker zeigte ihm, dass es bereits elf Uhr geworden war. Nun hatte es auch keinen Sinn mehr, in die Firma zu gehen. Sein Chef lag ohnehin im Krankenhaus. Er traf sich lieber wieder mit Karl-Heinz Kappe und half dem bei seinen Geschäften. Aber das hatte noch Zeit. So drehte er sich wieder zur Seite, um noch eine Runde zu schlafen.
Die Klingel im Flur ließ ihn zusammenfahren. Gott, die Polizei! Nein, es war die Chefin. Ihre Stimme war unverkennbar und nicht zu überhören. «Helmut, bitte kommen Sie in die Werkstatt, da ist ein dringender Auftrag zu erledigen!»
Was bei der dringend war, das wusste er. Aber mit ihr jetzt zu pimpern, das konnte er Marianne nicht antun. Die Zeiten waren vorüber. Endgültig. Also rief er ihr nur zu, dass ihm schlecht sei, er aber bis Mittag in der Hobrechtstraße sein würde. Grummelnd zog sie wieder ab.
Er ging in die Küche, um sich über dem Ausguss zu rasieren. Lange betrachtete er sein Gesicht im Spiegel. Sah so ein Mörder aus? Nein. Die Rasur verlief nicht ohne Verletzungen, denn die Seife war schlecht und die Rasierklinge stumpf. Einen Alaunstift hatte er nicht. Nun gut. Er röstete sich zum Frühstück zwei Scheiben klitschigen Brotes auf seiner Kochplatte und bestrich sie mit Melasse. Dann machte er sich auf den Weg zur Arbeit. Weit hatte er es nicht. Die Mariannenstraße mündete in den Kottbusser Damm. Die Notbrücke über den Landwehrkanal war zur überqueren, die alte war in den letzten Kriegstagen gesprengt worden und lag noch immer im Wasser. Ein paar hundert Meter ging es nun das Maybachufer entlang. Dort am Steg überwinterte der Ausflugsdampfer, mit dem er schon öfter zur Woltersdorfer Schleuse gefahren war. Wenn er wieder einmal an Bord ging, dann mit Marianne.
Mariandl-andl-andl,
aus dem Wachauer Landl-Landl.
Dein lieber Name klingt
schon wie ein liebes Wort.
Mariandl-andl-andl,
du hast mein Herz am Bandl-Bandl.
Du hältst es fest und lässt
es nie mehr wieder fort.
Diese Zeilen gingen ihm nicht mehr aus dem Kopf, obwohl er sonst lieber im AFN Amerikanisches hörte, Jazz, Moonlight Serenade, In the Mood oder Chattanooga Choo Choo von Glenn Miller zum Beispiel.
Die Chefin fiel ihm um den Hals, als er in der Werkstatt erschien. Ohne ihn hätte Hannelore Patschek ihren Laden zumachen können. Sie hatte zwar noch einen Lehrling, aber der war herzlich unbegabt, «zum Scheißen zu dämlich», wie Herbert Patschek es einmal ausgedrückt hatte.
Dringend zu malen war das Ladenschild für die Kleine Melodie, das Tanzcafé mit Barbetrieb und Weinstube in der Skalitzer Straße 95. Es war schon eine Kunst, die Buchstaben so schwungvoll hinzubekommen, dass es nach Lebensfreude und Genuss aussah. Doch er schaffte es bis zum Feierabend und konnte das Schild mit dem Lehrling zusammen rechtzeitig anliefern und an der Hauswand befestigen.
Dann musste er sich sputen, um sein Rendezvous mit Marianne nicht zu verpassen. Um achtzehn Uhr wollte sie auf dem U-Bahnhof Rathaus Neukölln stehen und auf ihn warten. Von der Kleinen Melodie war es nur ein kurzes Stück bis zur U-Bahnstation Görlitzer Bahnhof, immer an der Hochbahntrasse entlang und an der Emmaus-Kirche vorbei. Hallesches Tor musste er umsteigen von der Linie BII in die Linie CI Richtung Grenzallee. Pünktlich konnte er Marianne in die Arme schließen. So eng umschlungen, wie es gerade noch schicklich war, stiegen sie hinauf zur Karl-Marx-Straße. Vor der Ruine des Rathauses überquerten sie die Fahrbahn. Vom Kiehl’schen Bauwerk von 1908 waren zwar die Innenräume zum großen Teil ausgebrannt und der Dachstuhl völlig zerstört, aber die Außenmauern waren erhalten geblieben. Im Gegensatz dazu war das alte Amtshaus an der Ecke Erkstraße nur noch ein einziger Trümmerhaufen. Sie gingen in das Café, das gegenüber dem Kaufhaus Friedland aufgemacht hatte. Marken für zwei Stücken Kuchen hatte er. Doch die richtige Stimmung mochte nicht aufkommen, auch nicht, nachdem sie eine Art Grog getrunken hatten.
«Du bist ja so bedrückt heute», sagte er.
«Du aber auch», kam es zurück.
Er seufzte. «Ja, weil … Bei der Razzia gestern haben sie mir alles abgenommen.»
«Du sollst doch endlich aufhören mit deinen Schiebereien!», zischte sie.
«Das mach ich doch nur deinetwegen. Damit du deinen Modesalon aufmachen kannst und ich mein Geschäft für Schilder, Stempel, Sportpokale und so. Das ist mein großer Traum, und du bist meine große Liebe.»
Theodor Trampe konnte mit Fug und Recht als sozialdemokratisches Urgestein bezeichnet werden. Er war gelernter Elektroinstallateur, hatte sich aber noch zu Zeiten von Kaiser Wilhelm II. der Politik und der Gewerkschaftsarbeit verschrieben und bald den Lötkolben gegen den Federhalter eingetauscht, das heißt sein Brot mit journalistischer Arbeit zu verdienen begonnen. Der Widerstand gegen Hitler hatte ihn ins KZ gebracht, er war aber mit dem Leben davongekommen. Wahrscheinlich hatte sein Freund Hermann Kappe mit seinen Beziehungen das Schlimmste verhindert. Nun war er Wirtschaftsdezernent im Bezirksamt Neukölln, also Stadtrat. Oft saß er in seinem kargen und schlecht geheizten Büro in den Resten des Rathauses und ließ an sich vorüberziehen, was seit April 1945 in Neukölln geschehen war …
Am 28. April 1945 hatte die Rote Armee nach dreitägigen Kämpfen das letzte Aufgebot von Waffen-SS und Volkssturm niedergerungen und den Bezirk erobert, am 11. September hatte ihn die amerikanische Besatzungsmacht übernommen. Von den rund 18 000 Gebäuden waren 11 000 völlig oder zumindest so sehr zerstört, dass sie nicht wiederhergerichtet werden konnten, was aber im Vergleich zu einigen Innenstadtbezirken wenig war. Relativ schnell war das zivile Leben wieder in Gang gekommen, hatten die öffentlichen Betriebe und die Verwaltung wieder funktioniert: BVG, Post, BEWAG, Wasserwerke, Krankenhäuser, Meldestellen, Bezugsscheinstellen. Schon im August 1945 hatte man das Amt «Neues Leben» eingerichtet, das sich um Chorgruppen, Laienmusiker, Briefmarkensammler, Schachspieler und Laienspielgruppen kümmerte. Die Devise hatte gelautet: Ärmel aufkrempeln, zupacken, aufbauen! Die Trümmerfrauen hatten Heroisches geleistet. Steine, die noch zu gebrauchen waren, hatten sie mit ihren Werkzeugen vom Mörtel befreit und sauber aufgeschichtet. Die nicht mehr zu verwendenden Ziegelbrocken und der abgeschlagene Mörtel waren in Kipploren geschippt und auf eigens verlegten Gleisen mit kleinen Dampflokomotiven in den Jahnpark geschafft worden, wo ein gewaltiger Trümmerberg entstanden war. Der Kältewinter 1946/47 hatte viele Opfer gefordert. Wärmestuben waren eingerichtet worden, und wer ins Kino gegangen war, hatte sich heiße Ziegelsteine mitgenommen, damit ihm die Zehen nicht abfroren. 1947 hatte die Kinderlähmung Angst und Schrecken verbreitet. Mit der Wirtschaft hatte es nach Kriegsende ganz schlecht ausgesehen, denn viele Betriebe, auch mittlere und kleine, waren demontiert worden.
Theodor Trampe erinnerte sich noch ganz genau an seine ersten Tage in Neukölln im Juli 1945 in der Sonderabteilung «Entnazifizierung von Industrie und Handwerk». Alle sogenannten Mitläufer hatten mit nur geringen Einschränkungen eine neue Gewerbegenehmigung bekommen, was ihm sehr contre cœur gegangen war, nur bei Naziaktivisten waren Treuhänder eingesetzt worden. Die Nordkabel AG, Eternit, Hasse & Wrede, NCR, die kleine Schuhfabrik Reh & Predel und Gaubschat hatten ihre Arbeit wiederaufgenommen. Wenn er an Gaubschat dachte, bekam er noch immer Bauchschmerzen. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte man diesen Namen für immer und ewig aus dem Handelsregister löschen müssen, denn Gaubschat hatte ab 1942 die berüchtigten Gaswagen hergestellt, Spezial-LKWs, in denen Häftlinge mit eingeleiteten Abgasen getötet worden waren. Sein Lieblingskind war dagegen die Kindl-Brauerei, in der nach ihrer Demontage im November 1947 endlich wieder das erste Bier gebraut werden konnte. Ein Biersiphon stand auf dem kühlen Fensterbrett und wartete auf Theodor Trampes Freund Hermann Kappe.
«Den großen Autopreis von Argentinien gewann der Italiener Giuseppe Farina auf Maserati. Zweiter wurde sein Landsmann Achille Varzi auf Alfa Romeo. Den dritten Platz belegte der Franzose Jean-Pierre Wimille. » Hermann Kappe hatte die Sportseite des Telegraf aufgeschlagen und wollte seinen Kollegen Gerhard Piossek, der als großer Freund des Autorennsports galt, mit dieser Nachricht erfreuen.
Doch der winkte nur ab. «Heute ist ganz was anderes wichtig.»
Kappe blätterte demonstrativ in der Zeitung. «Was denn? Etwa, dass Willy Brandt vom SPD-Vorstand in Hannover zu dessen neuem Berliner Vertreter bestimmt wurde?»
Ihr Gespräch wurde unterbrochen, als der Polizeireporter des RIAS in der Tür stand und fragte, ob es im Mordfall Peter Rembowski etwas Neues gäbe.
Kappe stöhnte auf. Seine Cousine musste also etwas ausgeplaudert haben. «Nein, nicht dass ich wüsste.»
Der Reporter ließ nicht locker. «Er soll viele Freundinnen gehabt haben, auch welche aus den Westsektoren.»
«Keine Ahnung. Ich führe die Ermittlungen nicht.» Kappe gab sich so abweisend wie möglich.
«Aber Ihr Sohn …»
Der Journalist bekam aber keine weitere Antwort und zog wieder ab.
Kappe hatte keine Lust mehr, sich in die Akten mit den ungelösten Fällen zu vertiefen, und beschloss, Feierabend zu machen. Er verabschiedete sich von Piossek, hüllte sich in Schal und Mantel und lief zur Ecke Grunewaldstraße und Martin-Luther-Straße, von wo aus er mit der Straßenbahn zum Rathaus Neukölln fahren konnte.
Kappe und Theodor Trampe begrüßten sich mit alter Herzlichkeit und feierten den Umstand, dass Krieg und Naziherrschaft vorüber waren, mit ein paar Gläsern Kindl-Bier aus Neukölln.
«Kommst du noch mit ins Kino?», fragte Theodor Trampe, als der Siphon geleert war. «Ich habe durch meine Beziehungen zwei Karten für heute Abend bekommen.»
«Was gibt’s denn?», wollte Kappe wissen.
« Film ohne Titel. »
«Wie?» Kappe fühlte sich veräppelt.
Theodor Trampe erklärte ihm die Sache. «Es geht um eine Liebesgeschichte, um Christine und Martin. Vor dem Krieg ist er ganz oben, nach dem Krieg sie. Der Regisseur, der Drehbuchautor und die Schauspieler können sich nicht einigen, was für eine Art Film es werden soll, und einen Titel können sie auch nicht finden. Den sollen wir Zuschauer uns nun ausdenken. Nach der Vorstellung bekommen wir alle einen Zettel in die Hand gedrückt und sollen einen Titelvorschlag aufschreiben. Der Gewinner bekommt dreitausend Mark.»
«Nicht schlecht», sagte Kappe, ohne so recht begeistert zu sein. Erst als er hörte, dass Hildegard Knef eine der beiden Hauptrollen spielte, war er Feuer und Flamme.