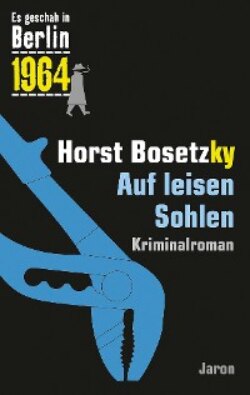Читать книгу Auf leisen Sohlen - Horst Bosetzky, Uwe Schimunek - Страница 7
ZWEI
ОглавлениеSIEGFRIED HEIDEBLICK war 1929 in Neukölln auf die Welt gekommen und hatte den Kiez um den Hermannplatz auch nie verlassen, obwohl er wusste, dass Neukölln auf der Skala der zwölf West-Berliner Bezirke ganz weit unten stand, nur Kreuzberg und Wedding galten weniger. Früher hatte man noch auf die Menschen herabblicken können, die im Scheunenviertel am Alexanderplatz, den Straßen um den Schlesischen Bahnhof und in der «Parochialritze» gelebt hatten. Doch das lag ja nun alles in Ost-Berlin, also sozusagen im Ausland, und zählte nicht mehr. Bis 1912 hatte Neukölln den Namen Rixdorf getragen. Dann hatten einige Rixdorfer Bürger gemeint, der Name ihres Ortes sei zu sehr mit proletarischen Vergnügungen verbunden, und man hatte beschlossen, sich in Neukölln umzubenennen.
Heideblick wohnte in einem alten Wohnhaus in der Hobrechtstraße, Ecke Lenaustraße, das den Krieg überstanden hatte. Schon vor einiger Zeit hatte er sich ein Grundstück draußen in Rudow gekauft, und seine Frau drängte ihn, dort endlich zu bauen. Doch er vertröstete sie Jahr für Jahr mit den Worten: «Wenn es mit der Firma wieder besser geht.»
Er hatte das Unternehmen Möbel-Heideblick in der Karl-Marx-Straße von seinem Vater geerbt. Doch im Augenblick liefen die Geschäfte schlecht. Wer im Krieg ausgebombt worden war, hatte sich schon längst neue Möbel gekauft, später auch noch Musiktruhe, Fernseher, Kühlschrank und Waschmaschine. Jetzt boomten das Auto- und das Reisegeschäft. Zudem war die Konkurrenz zu stark geworden. Heideblick versuchte es seit einiger Zeit mit der Bestuhlung von Kino- und Theatersälen, aber das hatte ihm die leeren Kassen auch noch nicht gefüllt. Die Werbesprüche Heideblick verhilft auch dir zum häuslichen Glück oder Möbelglück durch Heideblick hatten nicht den erhofften Erfolg eingebracht. Seine Frau Ute machte sich hin und wieder darüber lustig. Auch heute fragte sie spöttisch: «Siegfried Heideblick, verhilfst du mir mal wieder zum häuslichen Glück?»
«Das werde ich tun», brummte er, «und zwar, indem ich dich gleich verlasse und zum Fußball gehe.»
Ute lachte bitter. «Gut, dann kann ich ja in Ruhe zu meiner Mutter gehen.»
Mit Letzterer war Ute sowieso zum Kaffeetrinken verabredet. Sie verabschiedete sich mit einem Küsschen und machte sich auf den Weg. Heideblick blieb allein zurück und nahm sich noch einmal die Baupläne und Kalkulationen für «Bad Rudow» vor, wie er das geplante Eigenheim gern nannte. Gott, das war im Augenblick kaum finanzierbar! Doch Ute freute sich so auf ein Haus im Grünen.
Nach einer guten halben Stunde angestrengten Brütens packte er schließlich alle Unterlagen wieder zusammen und verließ die Wohnung, um zum Fußball zu gehen. Fußball war sein Lebensinhalt. Das wussten auch seine Angestellten, die ihm zum fünfzigjährigen Firmenjubiläum eine Zeichnung geschenkt hatten, auf der sein Kopf aus einem Fußball bestand. Als geborener Neuköllner war er eigentlich verpflichtet, Fan von Tasmania 1900 zu sein, die auch gerade wieder Berliner Meister geworden waren. Doch sein Herz schlug mehr für den 1. FC Neukölln, für den er einmal selbst gespielt hatte. Von der Bundesliga hielt er nicht viel, denn Hertha BSC war in der Saison 1963 / 64 gerade einmal auf Platz vierzehn gelandet. Eine Schande für West-Berlin! Deutscher Meister war der 1. FC Köln geworden. Wenn schon nicht Neukölln, dann immerhin Köln, dachte sich Heideblick. Die Ost-Berliner hatte es auch nicht besser getroffen, denn in der DDR war die BSG Chemie Leipzig Meister geworden.
Heideblick erreichte die Haustür und wollte sie schwungvoll aufreißen, doch irgendein Scherzbold hatte sie am helllichten Tage abgeschlossen. Um sie zu öffnen, musste er sein Schlüsselbund aus der Hosentasche ziehen und den Durchsteckschlüssel aus der Halterung lösen. Er verfluchte das Ding, das typisch für Berlin war. Nach dem Aufschließen musste man den Schlüssel durch das Schloss hindurchschieben und die Tür von der anderen Seite wieder abschließen, sonst bekam man den Schlüssel nicht wieder heraus. Nur der Hauswart hatte einen Spezialschlüssel. Also ging der Scherz wohl auf Konto dessen Sohns.
Heideblick besaß zwar zwei mit Reklame verzierte Lieferwagen, doch er hatte nie Lust gehabt, einen Führerschein zu machen. Und seinen Fahrer am Sonntag von Reinickendorf, wo der wohnte, nach Neukölln zu bestellen, hätte nur Ärger gebracht. Heideblick mochte auch nicht zur Haltestelle Sonnenallee, Ecke Hermannplatz gehen, um mit der Straßenbahn 95 zu fahren. Deshalb entschied er sich fürs Laufen. Schließlich tat er somit auch etwas für seine Gesundheit. Die Strecke von seinem Mietshaus bis zum Hertzbergplatz betrug gut zweieinhalb Kilometer. Die schaffte er spielend. Doch die Weserstraße, in die er nach ein paar Schritten einbog, war das, was sein Verkäufer, der aus Bremen stammte, einen «langen Jammer» nannte. Fast schnurgerade zog sie sich vom Kottbusser Damm bis zur Ringbahn am Bahnhof Sonnenallee.
Endlich hatte Heideblick den Hertzbergplatz und mit ihm das mehr als bescheidene «Stadion» des 1. FC Neukölln erreicht und seinen Stammplatz auf der westlichen «Tribüne» eingenommen, einen Stehplatz natürlich. Von hier aus hatte man einen weiten Blick Richtung Osten. Alle naselang tauchten die Maschinen der Pan Am und der BEA am Berliner Himmel auf, scheinbar aus dem Nichts kommend, und hatten schon die Räder ausgefahren, um wenig später in Tempelhof zu landen. Nachdem man West-Berlin eingemauert hatte, waren die drei Luftkorridore in Richtung Nord, West und Süd fast wieder so wichtig wie zu Blockadezeiten.
Jedes Flugzeug habe damit, so hatte es ihm seine vielseitig gebildete Tante Gisela aus Kladow einmal erklärt, die gleiche Bedeutung wie beim Cargo-Kult der Melanesier. Die hätten nämlich, als die ersten Flugzeuge hoch über ihren Köpfen aufgetaucht waren, geglaubt, ihre Ahnen wären aus Gräbern gestiegen, um ihnen wertvolle Waren aus dem Westen zu bringen.
Das Spiel begann, und Heideblick feuerte die «95er» in ihren blauen Hosen und gelben Hemden nach Kräften an. Bei jeder Spielunterbrechung wanderte sein Blick zum riesigen Komplex des Gaswerks Neukölln, das sich von der Sonnenallee bis zum Neuköllner Schifffahrtskanal zwischen dem Bahndamm und einer Laubenkolonie erstreckte. Gas brauchte man für die Herde und Thermen in den Wohnungen, für die Straßenlaternen, und wer unglücklich war … Doch an diese Einsatzmöglichkeit wollte er lieber nicht denken.
Kriminaloberkommissar Otto Kappe war eigens zum Zeitungskiosk am Kaiserdamm gelaufen, um sich den Telegraf zu kaufen. Denn heute sollte endlich der lange geplante Artikel über ihn und die Berliner Kripo erscheinen. Er konnte es nicht abwarten, bis er wieder zu Hause war, sondern fing schon auf dem Heimweg zu blättern an. Und tatsächlich fand er den Artikel mit dem Foto. Die Überschrift lautete: Die Verbrecherjagd liegt den Kappes im Blut – Wie Hermann Kappe, so der Neffe Otto.
Wir besuchen Kriminaloberkommissar Otto Kappe, 53, in seinem Büro in der Gothaer Straße. Er beugt sich nicht über einen Mann, der gerade erschossen worden ist, sondern über einen dicken Aktenordner. «Ich kümmere mich gerade um einige nasse Fische», erklärt er uns mit dem ihm eigenen Humor. «Das liegt daran, dass ich aus einer Fischerfamilie stamme, Wendisch-Rietz am Scharmützelsee.» Was «nasse Fische» sind, erfahren wir später: ungelöste Fälle. Immer wenn kein aktueller Mordfall anliegt, befassen sich die Beamten der Mordkommission mit ungelösten Fällen – vielleicht ist ja von den Kollegen doch etwas übersehen worden. Otto Kappe ist in Berlin geboren. Wie sein Onkel Hermann, Kriminalober kommissar a. D., ist er zuerst zur Schutzpolizei gegangen und von dort dann zur Kripo gekommen. 1938 hat er den Kommissarslehrgang in Charlottenburg absolviert, ist dann aber ins Abseits geraten, weil er nicht in die NSDAP und die SS eintreten wollte, und hat seinen Dienst in Litzmannstadt, heute Łódź, antreten müssen. Als seine Frau Gertrud dann schwanger wurde, durften sie wieder nach Berlin zurückkehren, wo auch der Sohn Peter zur Welt gekommen ist. Nach dem Krieg hat Otto Kappe zuerst beim englischen Sektorassistenten am Kaiserdamm gearbeitet, 1952 ist er dann zu einer der Mordkommissionen versetzt worden, sozusagen als Belohnung dafür, dass er mit einem Kollegen zusammen einen der Ganoven fassen konnte, der am Raub in der Eisenbahnverkehrskasse Unter den Linden beteiligt gewesen war.
1956 wurde Otto Kappe vom Dienst suspendiert, weil man ihn verdächtigte, bei einer Polizeirazzia aus niederen Beweggründen eine Frau niedergeschossen zu haben. Zusammen mit seinem Onkel Hermann stellte er aber Nachforschungen an und konnte seine Unschuld beweisen.
Hermann Kappe, Jahrgang 1888 und schon lange pensioniert, lobt seinen Neffen in den höchsten Tönen. Er sei intelligent, redegewandt und feinfühlig. Der Meinung sind auch Otto Kappes Kollegen, zum Beispiel sein Kriminalassistent Hans-Gert Galgenberg, dessen Großvater Gustav schon bei der Kripo gewesen ist.
Otto Kappe freute sich über das, was über ihn geschrieben worden war. Und am Kaffeetisch pflichtete ihm seine Frau Gertrud, nachdem sie alles überflogen hatte, bei. Schmunzelnd variierte sie den berühmten Spruch von Descartes: «Ich stehe in der Zeitung, also bin ich.»
«Nun ja …» Otto machte eine etwas hilflose Geste und gebrauchte einen Begriff, den sein Sohn Peter schon öfter verwendet hatte, der an der FU Psychologie studierte. «Das ist nun mal meine narzisstische Bedürftigkeit.»
Gertrud konnte sich ein mildes Lächeln nicht verkneifen. «Dabei magst du doch den SPD-nahen Telegraf eigentlich gar nicht, die Morgenpost ist schließlich dein Leib- und Magenblatt.»
Zum Glück klingelte es in diesem Moment an der Wohnungstür, und Otto brauchte den Dialog, der ihm doch ein wenig peinlich war, nicht fortzusetzen. Es war Peter, der bei einem Freund übernachtet hatte und sie nun zum gemeinsamen Zoobesuch abholen wollte, aber auch noch gern eine Tasse Kaffee mit ihnen trank.
Peter erzählte ihnen, dass er eigentlich gar keine Zeit für einen Ausflug habe, da er an einem Referat über David McClelland sitze.
Sein Vater sah ihn lächelnd an. «Spielt der in London bei Tottenham oder Arsenal?»
«Vater, das ist ein US-amerikanischer Sozialpsychologe, der in seinem Buch The Achieving Society herausarbeitet, dass die menschliche Motivation drei dominante Bedürfnisse umfasse: erstens das Bedürfnis nach Erfolg, zweitens das Bedürfnis nach Macht und drittens das Bedürfnis der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe. Die subjektive Bedeutung jedes Bedürfnisses variiert von Individuum zu Individuum und hängt auch vom kulturellen Hintergrund des Einzelnen ab.»
«Das hätte ich auch ohne jahrelanges Psychologiestudium an der FU zusammenbekommen», murmelte Otto.
Sein Sohn grinste. «Und was ist der TAT?»
Da musste Otto nicht lange überlegen. «Der Tathergang aus Tätersicht.»
«Denkste! TAT ist der Thematische Auffassungstest von Murray und Morgan, den McClelland weiterentwickelt hat. Bei diesem Test werden den Probanden Schwarz-Weiß-Fotografien vorgelegt, zu denen sie sich Geschichten ausdenken sollen: Was führte zu der gezeigten Situation? Was geschieht gerade? Was fühlen und denken die abgebildeten Personen? Wie ist der Ausgang der Geschichte? Ein Beispiel: Man zeigt zwei Probanden ein Bild von einem Paar, das sich gerade streitet. Der eine äußert: ‹Sie werden sich gleich wieder versöhnen und miteinander ins Bett gehen.› Und der andere sagt: ‹Der Mann wird die Frau gleich umbringen.› Die Antworten erlauben Rückschlüsse zur Psyche der beiden.»
Otto nickte. «Natürlich. Aber was, wenn nun einer sagt: ‹Erst geht er mit der Frau ins Bett und dann bringt er sie um›?»
«Dann ist das Sache deiner Mordkommission.»
Gertrud unterbrach die beiden. «Genug mit euren Albereien! Wir gehen jetzt in den Zoo.»
Seit der Spaltung Berlins besaßen beide Stadthälften ihren eigenen Zoo: West-Berlin den Zoologischen Garten, eröffnet 1844, und Ost-Berlin seit 1955 den Tierpark am Schloss Friedrichsfelde.
Der Zoo West hatte seinen Haupteingang am Hardenbergplatz, und dort trafen sich zur abgesprochenen Zeit fünf Mitglieder der Familie Kappe: Otto mit seiner Frau Gertrud und ihrem Sohn Peter und Hermann mit seiner Frau Klara. Deren drei Kinder waren nicht dabei. Margarete war gerade verreist, Hartmut lebte in Ost-Berlin, und Karl-Heinz, das schwarze Schaf der Familie, war irgendwo untergetaucht. Dann gab es da noch Hermann Kappes Bruder Oskar mit seiner Frau und seine Schwester Pauline mit den Ihren. Da den Überblick zu behalten fand Peter enorm schwierig.
Sonderlich spannend fanden die fünf den Zoo nicht, aber ihn zu besuchen war ebenso ein Berliner Ritual wie die alljährliche Dampferfahrt.
Hermann erinnerte sich an einen Zoobesuch mit seinem Sohn Hartmut, als der noch klein gewesen war. Heute war Hartmut mit einem Kontaktverbot belegt, weil er in Ost-Berlin bei der MUK arbeitete, der Morduntersuchungskommission. «Hartmut hat damals gefragt: ‹Papa, kaufst du mir einen Elefanten?› Und als ich nachgefragt habe, wo wir das viele Futter für das Tier hernehmen sollten, hat Hartmut geantwortet: ‹Kein Problem, da steht doch Füttern verboten.›»
Otto seufzte. «Schade, dass der Journalist vom Telegraf nicht mit ihm sprechen konnte. Das hätte so schön zur Überschrift gepasst: Die Verbrecherjagd liegt den Kappes im Blut.»
Siegfried Heideblick verfluchte alle Montage. Der Rhythmuswechsel lag ihm gar nicht. Jeden Sonntag schlief er bis in die Puppen, und dann musste er montags um sechs Uhr aufstehen. Denn seitdem sein Vater Möbel-Heideblick gegründet hatte, hieß es: Der Chef hat als Erster im Geschäft zu sein. Dieses Prinzip hatte zur Folge, dass er sich auch nicht von Olaf Nonnenfürst, seinem Handelsvertreter und Fahrer, abholen lassen konnte. Ute musste noch eher in der Schule sein als er in seiner Firma, und so stand sie schon abmarschbereit im Flur, als er sich an den Frühstückstisch setzen wollte. Er küsste und umarmte sie. «Einen schönen Tag wünsche ich dir!»
Als Ute gegangen war, schmierte er sich sein Paech-Brot. Er beneidete den Hersteller um die wunderbaren Werbesprüche, von denen er die meisten auswendig kannte. Besonders angetan hatte es ihm dieser:
Schinken nützt nichts, Wurst und Ei,
fehlt das Paech-Brot dir dabei.
Moral: Dem Fleisch verfallen oder nicht
auf Paech-Brot leiste nie Verzicht.
Warum nur brachte ihm die Reklame für seine Möbel nicht auch so einen Erfolg ein? Er stellte sich vor, in der Hochbahn zu stehen und dort über den Sitzen statt der Sprüche von Paech die seiner Firma zu lesen. Er brauchte unbedingt einen Werbefachmann! Aber den konnte er nicht bezahlen.
Heideblick stand auf, knallte die Wohnungstür hinter sich zu, schloss ab und lief zur Hobrechtstraße hinunter. Das Schild mit dem Namen Lenaustraße ärgerte ihn. Das war doch idiotisch, eine Straße in Neukölln, wo niemand Gedichte las, nach einem Dichter zu benennen, dazu noch nach einem österreichischen! Ringsum hießen die Straßen nach Berliner und Rixdorfer Kommunalpolitikern, etwa Hobrecht, Bürkner, Schinke, Pflüger und Sander. Warum dann ausgerechnet Lenau? In Gedanken hörte er Ute rufen: «Worüber du dich alles aufregen kannst!»
Er überquerte die Sonnenallee und musste einen Straßenbahnzug vorbeilassen. Die 95 fuhr noch, während die 3, die in der Hobrechtstraße zwischen Karl-Marx-Straße und Sonnenallee einen Halt gehabt hatte, schon eingestellt worden war. In einer Nische der Karl-Marx-Straße lag die Albert-Schweitzer-Schule, gehalten in den Farben des Grauen Klosters. Wie gern hätte er hier sein Abitur gemacht! Doch sein Vater hatte das nicht zugelassen. «Du wirst Tischler, sonst kannst du Möbel-Heideblick nicht richtig führen!», hatte der bestimmt. Die Karl-Marx-Straße … Dass die Neuköllner ihre gute alte Berliner Straße und die Bergstraße nach diesem Kommunisten benannt hatten, empörte Siegfried Heideblick Tag für Tag. Ohne Karl Marx keine DDR – und ohne DDR keine Mauer. Also musste sie seiner Meinung nach unbedingt rückbenannt werden.
Heideblick ging die Karl-Marx-Straße in Richtung Rathaus Neukölln hinauf. Seine Firma lag zwischen der Reuter- und der Weichselstraße. Ein blassgelber Straßenbahnzug der Linie 47 kam ihm entgegen. Er betrat sein Geschäft durch den Eingang im Hausflur und nahm erst einmal hinter seinem Schreibtisch Platz. Wenn seine Angestellten nun nacheinander eintrudelten, sollten sie glauben, er hätte die ganz Nacht hier gesessen und gearbeitet.
Als Erster erschien Olaf Nonnenfürst, ein rundlicher Typ, der wie ein Krapfen aussah.
«Guten Morgen, Chef!», rief er beim Eintreten. «Haben Sie heute schon Zeitung gelesen?»
«Nein. Wieso?»
«Dann halten Sie sich mal fest!» Nonnenfürst warf ihm eine Morgenpost auf den Schreibtisch. «Ihr Onkel ist gestern in seiner Firma niedergestochen worden.»
Heideblick war etwas verwirrt. «Welcher Onkel? Ich habe mehrere.»
«Na, der Pillendreher, dieser Ludwig Wittenbeck.»
Heideblick sprang auf. «Was?» Er nahm die Zeitung zur Hand, aber den drei Zeilen war nicht viel zu entnehmen. Also griff er nach seinem Telefonbuch, riss den Hörer von der Gabel und rief in Kladow an, dann versuchte er es in der Kaubstraße. «Da hebt keiner ab.»
«Na, wenn er im Krankenhaus liegt oder vielleicht schon …» Nonnenfürst brach erschrocken ab.
«… tot ist …», vollendete Heideblick den Halbsatz. «Mein Gott! Wir rufen jetzt mal bei allen Krankenhäusern ringsum an, in Kreuzberg, Schöneberg und Neukölln, und fragen nach ihm.»
Sie brauchten keine fünf Minuten, dann hatten sie herausgefunden, dass Ludwig Wittenbeck im Urban-Krankenhaus lag.
«Los, Nonnenfürst, holen Sie den Wagen, und fahren Sie mich hin! Bitte!»
Über die Sonnenallee und die Urbanstraße waren sie in zehn Minuten am Ziel. Das Krankenhaus Am Urban war in offener Pavillonbauweise errichtet und 1890 eingeweiht worden. Ein zentraler Neubau war schon geplant, aber noch musste sich Heideblick mühsam durchfragen, ehe er seinen Onkel in einem der gelben Backsteinbauten gefunden hatte. «574 Betten ham wa hier, Meesta, und ick kann ma unmöjlich alle merken, die se bei uns einliefan tun.»
«Gott, du Armer!», rief Heideblick, als er endlich auf dem Bettrand seines Onkels saß. Freie Stühle gab es nicht mehr, denn alle drei Zimmernachbarn Wittenbecks hatten ebenfalls Besuch. «Wo hat dich denn dieser Kerl getroffen?»
Wittenbeck hob seine Bettdecke ein wenig an. «Zum Glück nur hier an der rechten Seite in den Bauch. Galle und Leber sind aber nicht verletzt. Es sah anfangs schlimmer aus, als es tatsächlich ist. Ich habe wirklich gedacht, dass ich sterben werde.»
Heideblick strich ihm über die Hand. «Das ist ja schrecklich.»
«Nein, das ist gar nicht schrecklich. Ich wäre gern gestorben.»
«Du kannst doch Tante Gisela nicht allein lassen!», rief Heideblick.
Der Onkel hatte plötzlich Tränen in den Augen. «Die hat mich doch verlassen und ist auf und davon. Darum wäre ich ja am liebsten tot. Die Einsamkeit da draußen in Kladow, und in der Kaubstraße ist es auch noch so leer – das alles ertrage ich nicht. Schade, dass der Kerl mich nicht richtig getroffen hat, dann wäre ich wenigstens von allem erlöst.»
Uwe Dreetz hatte den Tresor der Pulmo Sanitatem Berlin in den Höfen am Südstern ohne große Mühe und ohne Schneidbrenner knacken können und neben einem Bündel grüner Banknoten auch einige Schmuckstücke erbeutet – Ringe, Armbänder, Broschen. Offenbar hatte dieser Wittenbeck geglaubt, sie seien in seiner Firma sicherer als bei ihm in Kladow oder in seinem neuen Haus in der Kaubstraße.
Beim ersten Rendezvous war es Dreetz gelungen, Gisela Wittenbeck ein paar Schlüssel zu entwenden, um Nachschlüssel anfertigen zu lassen. Darunter waren die für die Firma ihres Mannes und für die Villen in Kladow und in der Kaubstraße. Wo genau sich diese dort befand, wusste er noch nicht, aber das ließ sich sicher irgendwie herausfinden. Noch würde Wittenbeck ja einige Zeit im Krankenhaus verbringen müssen. Dreetz verfluchte sich, weil er ihn niedergestochen hatte. Das war im reinen Affekt geschehen. Er war in Panik geraten, weil er sich in Gedanken schon wieder im Knast gesehen hatte. Er hatte nicht vorgehabt, Wittenbeck zu attackieren oder gar zu ermorden. Denn er wusste, dass die Aufklärungsquote bei Morden bei nahezu hundert Prozent lag, und er wollte den Rest seines Lebens nicht in der JVA Tegel verbringen.
Dreetz nahm sich eine Taxe, um zu seinem Hehler zu fahren. Der Schmuck musste verhökert werden. Wahrscheinlich gehörte er Gisela Wittenbeck. Er überlegte, ob es klug war, sie heute Abend wiederzusehen. Oder sollte er besser untertauchen?