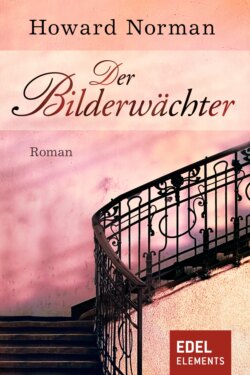Читать книгу Der Bilderwächter - Howard Norman - Страница 4
EIN EHRBARER BERUF
ОглавлениеDas Gemälde, das ich für Imogen Linny stahl, Jüdin auf einer Straße in Amsterdam, kam am 5. September 1938 im Glace-Museum hier in Halifax an. Ich hatte mein Zimmer im Lord Nelson Hotel morgens um 6.45 Uhr verlassen und mich um 7 Uhr an meinem Arbeitsplatz eingefunden, um meinem Kurator, Mr. E.S. Connaught, beim Einrichten einer neuen Ausstellung zu helfen, »Acht Gemälde aus Holland«. Mr. Connaught hielt nichts von hochfliegenden Titeln, im Gegensatz zu den Gepflogenheiten in manch anderen Museen.
Wir machten uns daran, die Kisten auszupacken. Für die Niederländer war Raum C vorgesehen, der Margaret-Glace-Raum, benannt nach der Gattin des Gründers. Ich konnte nie nachvollziehen, warum sich Mr. Connaught beim Hängen der Bilder für diese oder jene Stelle entschied. Er forderte mich auf, die Jüdin auf einer Straße in Amsterdam an die Südwand zwischen die Fenster zu hängen, durch die man gerade noch den Hafen von Halifax sehen konnte. Dabei hatte ihn wohl die Intuition geleitet, denn als das Gemälde dort hing, sagte er: »Perfekt.«
Im Glace-Museum gibt es lediglich die großen Räume A und C, beide 6 Meter auf 7,5 Meter, und den Raum B, 3 Meter auf 7 Meter, der eher wie ein Verbindungsgang wirkt. Obwohl auch der Raum B eine gewisse Bedeutung besitzt, weil dort die ständige Sammlung untergebracht ist, ein Fundus von Aquarellen und Ölgemälden kanadischer Künstler. Darunter befinden sich eine Trapperhütte, ein Totempfahl über einem Felsstrand, ein blinder Cellospieler und ein sehr unglücklich dreinblickender Akt. Außerdem hängt dort noch ein Ölbild im Format von 45 x 30 Zentimeter, Das Glace-Museum, gemalt von Simon Glace, dem Gründer des Hauses. In diesem Bild stimmen die Proportionen nicht, fiel mir auf. Die Masten der Schoner dürften eigentlich nur im Hintergrund zu sehen sein, denn der Kai liegt vier Straßen vom Museum entfernt, das sich in der Agricola Street befindet. Doch Simon Glace hat sie so dargestellt, als würden sie direkt aus dem Museumsdach sprießen. Ansonsten ist es ein ganz hübsches Bild.
Ich versuchte immer, mir neue Kenntnisse anzueignen und so viel über unsere neuen Bilder in Erfahrung zu bringen, daß ich elementare Fragen beantworten konnte. Aber ich war nur Aufseher und machte keine Führungen. Diese Aufgabe oblag Miss Helen Delbo, Dozentin für Kunstgeschichte an der Dalhousie-Universität.
Jenen ganzen Oktober lang beaufsichtigte ich den Raum C, der am weitesten vom Eingang entfernt lag. Der zweite Aufseher war mein Onkel, Edward Russet. Er hatte den Raum A unter sich. Wir konnten beide den gesamten Raum B überblicken und waren deshalb gemeinsam für ihn zuständig.
Es dauerte zwei Stunden, bis alles gesagt und getan war und alle »Acht Gemälde aus Holland« an den Wänden hingen. Danach verschränkte Mr. Connaught die Hände im Rücken und inspizierte den Raum. Dies war ein Ritual. Er stellte sich in die Mitte neben die Bank, die Mrs. Yvonne Glace, die Nichte des Gründers, gestiftet hatte, selbst eine Hobby-Aquarellmalerin. Keine ihrer Arbeiten hatte Eingang in die ständige Sammlung gefunden. Mr. Connaught drehte sich langsam im Kreis, kaute an seiner Lippe, setzte seine Bifokalbrille auf, dann ab, dann wieder auf. Er war ein hochgewachsener Mann mit schlohweißen Haaren. Vor einer Woche hatte er seinen Fünfzigsten gefeiert; ich hatte ihm eine Krawattennadel geschenkt, mehr hätte ich mir von meinem Gehalt nicht leisten können. In tiefer Konzentration wie jetzt neigte er dazu, sich über die Wangen und den Unterkiefer zu reiben, als knete er Brotteig durch. Mein Onkel konnte eine hervorragende Imitation davon geben. Mr. Connaught hatte ein müdes, intelligentes Gesicht mit dichten, ebenfalls weißen Augenbrauen, das bisweilen einen Ausdruck echter Verwirrung annehmen konnte. Wenn er forschend die Museumswände betrachtete, blähte er oft die Wangen auf, seufzte in plötzlicher Qual und sagte: »Nein – das da muß niedriger sein. Und dieses Bild hängen Sie dort drüben hin«, und dergleichen. Auf diese Weise beurteilte er nun die Anordnung der Holländer. Doch letztlich beließ er die Bilder genau dort, wo er sie als erstes hatte aufhängen lassen. »Ich muß mich ein paar Tage an dieses Arrangement gewöhnen«, sagte er. »Die Anordnung der Stilleben bereitet mir leichtes Unbehagen. Zuviele Stilleben an derselben Wand können abstumpfend wirken. Aber lassen wir’s für den Moment dabei.« Er kam zu mir herüber, legte mir die Hände auf die Schultern, schloß die Augen und schlug sie wieder auf. »Also, DeFoe«, sagte er, »das sind Ihre neuen Schützlinge.« Als wollten wir eine förmliche Vereinbarung besiegeln, daß ich für jedes einzelne dieser Gemälde mein Leben hingeben würde, schüttelten wir uns feierlich die Hand. »Übrigens«, sagte er, »Mrs. Boardman kann sich heute nicht um den Bücherstand kümmern. Sie ist sehr krank, wurde ich informiert. Sie müssen den Verkauf der Postkarten mit übernehmen.« Dann kehrte er in sein Büro gleich hinter dem kleinen Bücherstand zurück, vom Eingang gesehen auf der linken Seite. Die Eingangstür hatte einen Türklopfer aus Messing in Form eines Widderkopfes; das Haus war, bevor es 1920 mit Fanfarenpomp und dem Durchschneiden von Bändern als Museum eingeweiht wurde, Simon Glaces privates Wohnhaus gewesen.
Gegen 9.15 Uhr brach Mr. Connaught nach Dartmouth auf, das auf der anderen Seite des Hafens liegt. Dort wollte er einen Vortrag halten, mit dem er Spendengelder flüssig zu machen hoffte. Um 10 Uhr schloß ich die Tür für das Publikum auf. Das taten ich oder er jeden Vormittag außer montags, wenn das Museum geschlossen blieb.
Mein Onkel stolperte gegen 11 Uhr, vielleicht auch 11.30 Uhr herein. Sein verlotterter Zustand beunruhigte mich kaum, derlei kannte ich schon zur Genüge. Er hatte eine zerknitterte schwarze Hose an und ein weißes Hemd, dessen Zipfel über den Hosenbund hingen, die Ärmel waren unterschiedlich hoch aufgekrempelt. Seine Füße steckten sockenlos in schwarzen Schuhen, dabei war es an diesem Morgen recht kalt draußen. Seine Aufseheruniform, damit meine ich Hose und Jackett, hatte er sich samt dem Bügel, auf den die Hotelwäscherin Mrs. Klein sie gehängt hatte, über die Schulter geworfen. Seine Augen waren gerötet und verschwollen, sein Gesicht aufgedunsen. Seine ganze Erscheinung wirkte von Alkohol und Schlafmangel zerrüttet. Aber trotz seines heruntergekommenen Äußeren ließ sich wieder einmal die Tatsache nicht leugnen, daß er ein attraktiver Mann war. Mit seinen zerwühlten, aber dichten schwarzen Haaren, die einem jungen Mann gehören könnten. Er war achtundvierzig Jahre alt. Und trotz seiner Bartstoppel und den nach vorn sackenden Schultern sah er meinem Vater auf geradezu unheimliche Weise ähnlich. Mein Vater war zwei Jahre älter gewesen als er.
Mein Onkel blickte sich flüchtig in der neuen Ausstellung um. »Ich bin fast zweimal so alt wie dieser Junge hier ...«, verkündete er mehr zu den Holländern als zu mir gewandt. »... und schaut euch mal die mißbilligende, böse Grimasse an, zu der er sein Gesicht verzieht, ja?« Er lallte fast. »Ich hab zehnmal soviel gelebt wie mein Neffe hier, wie er jemals leben wird.«
Dann lachte er sein beleidigendes Verdammungsurteil, das umso härter traf, weil es der Wahrheit entsprach, einfach wieder weg. Er kam zu mir, gab mir einen Klaps aufs Kinn und umarmte mich, wobei er sich schwer gegen meine Brust fallen ließ. »Ach DeFoe, ist ja schon gut«, sagte er. »Du weißt doch, was ich für’n Zeug daherrede.«
»Mr. Connaught ist drüben in Dartmouth«, sagte ich. »Er kommt erst nach dem Mittagessen wieder zurück. Geh jetzt lieber in die Putzkammer und mach dich ein bißchen frisch. Schlaf eine Runde.«
»Wie ich sehe, sind hier die Holländer eingefallen, was?« sagte er. »Ich hatte vor, dir beim Aufhängen zu helfen. Aber Natalie hat vergessen, den Wecker zu stellen.«
»Wer ist Natalie?«
Er musterte mich einen Augenblick. »Egal, wie schlimm ich heute aussehe«, sagte er, »Neffe, du siehst noch schlimmer aus. Ich meine, klar bist du ordentlich verpackt, wie immer. Hast deine Krawatte gebügelt und so. Aber der Abend gestern muß dir ganz schön zugesetzt haben. Was ist denn bloß passiert? Oje, oje, ich sage nur: Imogen. Stimmt’s? Hat dich wieder nicht rangelassen. Hast wieder mal die ganze Nacht lang den Mond angeheult, was? Darüber unterhalten wir uns noch. Da ist so’n richtig schön altmodisches Gespräch von Onkel zu Neffe fällig.«
Ich hakte ihn unter und führte ihn in die Putzkammer, die neben Mr. Connaughts Büro lag, dessen Tür sich allerdings direkt in den Raum A hinaus öffnete. Mein Onkel legte sich sofort aufs Feldbett. Außerdem gab es in der Kammer ein tiefes Waschbecken mit schwenkbarem Hahn. Mops standen aufrecht in einem Eimer, Scheuerbürsten hingen an einem Korkbrett. Im Schrank bewahrte ich ein Bügeleisen auf, das ich von meinem eigenen Geld gekauft hatte. Ein zusammengeklapptes Holzbügelbrett mit Asbestüberzug lehnte hinter der Tür. Auf dem Regal stand ein Radio. Der Hausmeister Mr. Tremain kam drei Abende die Woche, um die Böden zu wischen, die Fenster von innen zu putzen, die Bilderrahmen abzustauben, das Büro und den Bücherstand aufzuräumen und die Toiletten zu reinigen. Bei günstiger Witterung holte er am Montagmorgen die Leiter, den Eimer und die Schwämme hervor und putzte die Fenster von außen.
Bevor ich meinem Onkel ein Glas Wasser hinstellen konnte, war er auch schon eingeschlafen. Ich schloß die Tür und kehrte in den Raum C zurück.
Hätte Mr. Connaught an jenem Tag mitbekommen, wieviel sich mein Onkel verspätet hatte, hätte er ihn vielleicht abgepaßt und ihm »säumig!« entgegengerufen – ein Ausdruck, den mein Onkel als idiotisches Oberlehrerwort bezeichnete. Mr. Connaught hatte ihn schon unzählige Male öffentlich zurechtgewiesen. Manchmal kam mein Onkel zehn Minuten zu spät, manchmal tauchte er überhaupt erst um zwölf Uhr auf und nahm dann sofort seine Mittagspause. Einmal begann er seinen Arbeitstag erst um 13.30 Uhr, wobei er zu mir bemerkte: »Ich habe gerade noch Mittag gemacht, sonst wäre ich schon Punkt eins dagewesen.« Sein Verhalten war schlichtweg unberechenbar. Er konnte zwei, drei, sogar vier Wochen hintereinander absolut pünktlich sein. Doch mehr als drei Wochen Pünktlichkeit führten unweigerlich zu einer Häufung »unentschuldigten Fernbleibens« – ein weiterer von Mr. Connaughts Ausdrücken. 1937 kam mein Onkel im Januar jeden Tag zu spät. Mitte Januar kam er an einem Tag überhaupt nicht. Um 17.00 trat Mr. Connaught aus seinem Büro und sagte: »Zweifellos haben Edward seine, wie drückt er es doch gleich aus, amourösen Recherchen zu stark in Mitleidenschaft gezogen. Mit einer Hotelangestellten, wie üblich, nicht wahr? Einer Matilda oder Isabel, richtig? Oder heißt sie Altoon? Jedenfalls schweift er nicht gerade in die Ferne.« Mein Onkel wohnte ebenfalls im Lord Nelson Hotel. Ich hatte Zimmer 22, mein Onkel Zimmer 34, einen Stock höher.
Das Seltsame war, wenn Mr. Connaught meinen Onkel abkanzelte, sich dicht vor ihm aufbaute und verkündete: »Ich kürze Ihr Gehalt um eine volle Woche, bis zum letzten Penny!«, dann schluckte mein Onkel einfach die bittere Pille, verbeugte sich und sagte: »Sehr wohl, Euer Gnaden« oder etwas ähnlich Überspanntes, bevor er wieder Posten in seinem zugewiesenen Raum bezog. »Ich habe eine solche Strafe sowohl verdient als auch erwartet«, sagte er einmal nach einer dieser Auftritte, »warum sollte ich mich also darüber aufregen?«
Als ich 1936 als Museumsaufseher anfing, arbeitete mein Onkel bereits seit dreizehn Jahren für Mr. Connaught, der ihn einstellte, nachdem er selbst erst eine Woche zuvor das Amt des Kurators übernommen hatte. Vorher war mein Onkel auf dem Bahnhof von Halifax in der Gepäckaufbewahrung beschäftigt gewesen. Im Museum hatte es davor nur einen einzigen Aufseher gegeben, Trevor Salk, der sich nach seiner Pensionierung nach Peggy’s Cove zurückzog; ich bin ihm nur einmal begegnet. Schon sehr früh spürte ich, daß Mr. Connaught und mein Onkel einander mochten, und genau daran lag es, daß sie sich gegenseitig so leicht ärgern konnten. Mein Onkel nutzte Mr. Connaughts Toleranz aus, das merkte sogar der Dümmste. Mr. Connaughts Toleranz gegenüber meinem Onkel schien wiederum grenzenlos zu sein. Entsprechend spielte sich ihr Verhältnis ein. Geben und nehmen, oder, was meinen Onkel betraf, nehmen, nehmen und nochmals nehmen. Ich glaube, daß mein Onkel seine tiefste Befriedigung im Museum darin fand, ungeniert zu spät zu kommen und trotzdem nicht gefeuert zu werden. Das Zuspätkommen sogar auf die Spitze zu treiben, um zu beweisen, daß er nicht gefeuert würde. Eine bessere Erklärung fällt mir dazu nicht ein. Im großen und ganzen war mein Onkel wohl ein guter Museumsaufseher. Obwohl er gelegentlich einen Besucher anzischte – ich meine damit ein wirklich lautes Ssssss! – und vorwurfsvoll den Kopf schüttelte, auch wenn das Opfer keinen Grund dafür entdecken konnte und ich eigentlich auch nicht. Ziemlich oft überkam ihn ich weiß nicht welche Anwandlung, er zog sich in die Putzkammer zurück, drehte das Radio voll auf und schloß nicht einmal die Tür. Ich könnte leicht ein Dutzend solcher Vorfälle aufzählen. Eines Abends sagte er beim Essen im Speisesaal des Hotels zu mir – ich war damals schon über ein Jahr lang Museumsaufseher –: »Im Grunde habe ich nicht gern mit Menschen zu tun. Oder mit Bildern. Aber was bleibt mir in einem Museum schon anderes übrig? Ich tue eben mein Bestes.« Am leichtesten kam ich mit ihm zurecht, wenn ich seine Schrullen mit einem Achselzucken überging, einen Bogen um seine wunden Punkte machte, um ihn nicht zu reizen, und seine Verstöße gegen die Vorschriften nach Kräften ignorierte, auch wenn sie ganz und gar nicht amüsant waren. Schließlich hatte er jahrelange Berufserfahrung. Er hatte mir den Job besorgt. Ich hatte von meinem Onkel viel gelernt.
Ich weiß, daß ich vorgreife. Aber da das Folgende immer noch zum Thema gehört, will ich es erzählen. Eines Vormittags, ungefähr sechs Monate nach meiner Einstellung, winkte mich Mr. Connaught in sein Büro. »Was nun Ihren Onkel angeht«, begann er und setzte sich hinter seinen Schreibtisch. Ich saß auf dem Stuhl gegenüber. »Ich weiß, Sie haben selbst schon vieles bemerkt. Bei einem Kollegen wie Edward müßte man schon blind sein, damit einem nichts auffiele. Sie haben mitbekommen, daß er seine Aufseherpflichten recht individuell auslegt. Ich bin nicht sicher, was er Ihnen über seine Jahre im Glace erzählt hat und was nicht. Wußten Sie zum Beispiel, daß sich Edward in den beiden Wochen, als ich mit einer Erkrankung, die hier nicht weiter interessiert, im St. Rita-Hospital lag, ganz allein um das Museum gekümmert hat?«
»Nein, Sir. Das wußte ich nicht.«
»Natürlich habe ich später herausgefunden, daß Edward einfach die Tür zugesperrt und ein Schild aufgehängt hat: ›Wegen Renovierungsarbeiten geschlossen‹. Er hat auf Kosten des Museums Urlaub gemacht – wie er ihn verbracht hat, weiß ich nicht. Ich fand das überhaupt nicht komisch. Vor allem nicht in meinem geschwächten Zustand. Nachdem ich einen Abend lang sehr mühsam über die Sache nachgegrübelt hatte, gelangte ich zu der Auffassung, so hätte ein Mann gehandelt, der seine eigenen Grenzen kannte. Sehen Sie, Edward konnte die Aussicht, zwei Wochen lang ganz allein die Verantwortung für das Museum zu tragen, einfach nicht verkraften. Ganz zu schweigen davon, daß er in jenen Tagen dem Alkohol sehr ergeben war. Ich glaube, er hat das Trinken etwas eingeschränkt, nicht wahr?«
»Manchmal.«
»Zu dieser Zeit beschäftigten wir nur einen Aufseher. Das war Edward. Sein Verhalten gelangte dem Kuratorium zur Kenntnis – einer der Treuhänder wollte mittags dem Museum einen kurzen Besuch abstatten und war, gelinde gesagt, überrascht, als er die Tür verschlossen fand. Nun, meine Probezeit wurde um ein Jahr verlängert, weil ich für Edwards Einstellung verantwortlich war. Eine schmerzhafte öffentliche Demütigung. Nicht nur das; ich mußte meine ganze Beredsamkeit aufbieten, damit Edward nicht gekündigt wurde.«
»Vielleicht sollte ich diese Frage nicht stellen, aber warum haben Sie ihn denn nicht entlassen?«
»Warum behalte ich ihn immer noch, das ist die Frage, richtig? Eine berechtigte Frage, DeFoe. Daß ich Sie eingestellt habe, war die Antwort auf die Frage, wie ich es umgehen könnte, Edward zu entlassen. Wir brauchten einfach einen zweiten Aufseher. Weil Edward, auch wenn wir ihm eine volle Stelle bezahlen, bestenfalls eine halbe Kraft ist. Damit meine ich, daß er während der Arbeitszeit so oft irgendwo außerhalb des Museums zu tun hat. Zwischen Edward und mir herrscht, was man als einen Waffenstillstand bezeichnen könnte. Einen fortlaufend verlängerten Waffenstillstand. Ja, das Wort erscheint mir höchst passend. Man muß erst kämpfen, bevor die Waffen ruhen können, nicht wahr – in unserem Fall gab es Hunderte von Kämpfen. Vielleicht hat uns das auf eine seltsame Weise einander näher gebracht. Freundschaft kann man das nicht nennen. Vielmehr eine Art Wachsamkeit. Als Museumsaufseher ist Edward – nun, lassen Sie es mich so ausdrücken: Anfangs hatte ich höhere Erwartungen. Ich erwartete von ihm, daß er sich an die primitivsten Gebote der Höflichkeit hält. Daß er in seiner Aufmerksamkeit nicht nachläßt. Daß er nicht, wenn ihm gerade danach ist, vor den Museumsbesuchern Ovid Lamartine zitiert. Den Radiosprecher Ovid Lamartine, den Edward geradezu zwanghaft verehrt. Und daß er nicht lauscht und dann auch noch am Gehörten persönlichen Anstoß nimmt. Wenn ihm eine Meinung über ein Kunstwerk zu Ohren kommt, mit der er nicht übereinstimmt, haben Sie bemerkt, was er dann macht? Mit großer Wahrscheinlichkeit ruft er laut: ›Blödsinn!‹ Ja, ja, und noch Schlimmeres.
Um noch direkter auf Ihre Frage einzugehen, warum ich Edward nicht entlasse: Ich weiß, daß er seinem Naturell nach nicht für das Amt eines Museumsaufsehers geschaffen ist. Nun ja, es ist seltsam, daß meine Sympathien mein sachliches Urteilsvermögen dermaßen zu trüben vermögen, nicht wahr?«
»Also, ich weiß nicht, was er ohne diesen Job anfangen sollte, Mr. Connaught. Zum Bahnhof würde er jedenfalls nicht zurückkehren, da bin ich sicher.«
»Vorwürfe mache ich nur mir selbst. Der Raum, der diesem Museum zur Verfügung steht, ist klein. Edward bringt es mit seinen Faxen durchaus fertig, diesen Raum noch unendlich zu verkleinern. Vielleicht haben Sie das auch schon einmal so empfunden. Ich weiß nicht, warum – ich habe Edward ohne Referenzen oder ein tieferes Verständnis seines Charakters eingestellt. Das war nicht seine Schuld. Er hat mir nichts vorgemacht. Er hat sich einfach um die Aufseherstelle beworben. Nun ja, sein Charakter. Der hat sich vom ersten Tag an offenbart. Und offenbart sich weiter mit einer bemerkenswerten Beharrlichkeit, finden Sie nicht auch?«
»Ich könnte es nicht besser ausdrücken.«
»Ab und zu zermartere ich mir den Kopf über diese Dinge. Ich grüble und grüble und grüble. Aber meist ziehen die Arbeitstage einfach so vorbei.«
»Aber er empfindet durchaus Respekt für Sie. Mein Onkel.«
»Hat er das gesagt?«
»Er hat das Wort Respekt benutzt. Einmal, in Halloran’s Restaurant.«
»Vermutlich der Lohn für meine Geduld. Habe ich Sie in eine mißliche Lage gebracht, weil ich Ihnen mein Leid über Edward geklagt habe? Das möchte ich doch nicht hoffen.«
»Er ist mein Onkel. Er hat mich großgezogen. Aber ich werde alles, was Sie mir erzählt haben, für mich behalten. Sie hätten es mir nicht zu sagen brauchen. Sie hatten sicher Ihre Gründe dafür.«
»Museumsaufseher ist ein ehrbarer Beruf. Soweit ich es bisher beobachten konnte, handeln Sie danach.«
»Danke.«
»Verstehen Sie mich nicht falsch, DeFoe. Ich mag Edward, weiß Gott. Habe ihn sehr gern, auf eine Weise, die ich eigens erfinden mußte. Vielleicht ist das der wahre Grund, warum ich ihn weiter beschäftige. Ich mußte meine Toleranz kreativ weiterentwickeln. Daraus ist inzwischen wohl einfach eine Gewohnheit geworden.
Wir, Ihr Onkel und ich, haben dreizehn Jahre lang in denselben Räumlichkeiten gearbeitet. Wir haben unzählige großartige Ausstellungen veranstaltet, manche auch von geringerer Qualität. Das Glace ist unsere gemeinsame Adresse. Doch über sein Leben außerhalb des Museums weiß ich nicht mehr als ich möchte. Nämlich so gut wie gar nichts. Mit Ausnahme der Berichte über seine nächtlichen Abenteuer, die er mir in meinem Büro aufdrängt. Und ich habe Edward noch nie zu mir und meiner Schwester zum Weihnachtsessen eingeladen. Oder zu sonstigen Anlässen.«
Erschöpft und verkatert wie er war, hatte mein Onkel meinen Zustand dennoch sofort durchschaut. »Wieder mal eine Nacht lang den Mond angeheult« – mit welcher schonungslosen Scharfsicht mein Onkel das erfaßt hatte. Tatsächlich hatten Imogen und ich eine der schlimmsten Nächte des ganzen Jahres hinter uns. Sexuelle Verweigerung und Streit. Nicht nur das, Imogen hatte wieder einmal an ihren lähmenden Kopfschmerzen gelitten, die so unvorhersehbar auftraten. Schließlich war sie eingeschlafen. Kein Schlaf für mich. Ich fühlte mich angeschlagen, geistig, körperlich, seelisch – wie man sich nur angeschlagen fühlen kann. Doch auch darin hatte mein Onkel wieder recht: meine Uniform, das schwarze Jackett, die Hose, das weiße Hemd, die schwarze Krawatte, die ich tatsächlich gebügelt hatte – das alles war tadellos sauber, adrett und faltenfrei, wie Mrs. Klein sagen würde. Meine schwarzen Schuhe waren auf Hochglanz poliert, mein Namensschild, DEFOE RUSSET, genau waagerecht über meiner Brusttasche festgepinnt. Um 6 Uhr früh hatte ich mich in meinem Hotelzimmer rasiert, meine Koteletten einen Millimeter gekürzt, ein Bad genommen.
Trotzdem stieg mir den ganzen Vormittag lang Imogens Duft, der an meiner Haut haftete, in die Nase. Weil ich neben ihr gelegen hatte, Brust an Brust gepreßt. Ihre Arbeitsbluse lag säuberlich zusammengefaltet auf ihrem Schreibtisch. Imogens Schreibtisch hatte sechs Schubladen. Ich hatte die Bluse selbst zusammengelegt. Imogen hätte das nie getan. Auch ihr Parfum begleitete mich den ganzen Tag. Imogens Schweiß, ihre Zigaretten. Mein unerfülltes Verlangen verschlimmerte das Ganze, oder mehr noch diese Erinnerungsflut, wie ich in jenem kurz zugestandenen Moment mit meinem Finger in sie hineingleiten durfte. »Kurz zugestandener Moment« ist ein Ausdruck, den Miss Delbo bei ihrer Führung durch die Ausstellung »Französische Kriegsgemälde« benutzt hatte, ich kann mich nicht genau entsinnen, in welchem Zusammenhang. Ich glaube, es ging um etwas Philosophisches, Leben und Tod in der Schlacht, was einem gegeben wird, kann einem genauso plötzlich wieder genommen werden. Im Bett hatte ich gefragt. Ich hatte gefragt: »Imogen, ist das in Ordnung für dich?«, und Imogen hatte gesagt, es wäre in Ordnung. Aber dann schrie sie sofort auf, als stieße ihr ganz unerwartet etwas Ungehöriges, Unerträgliches zu. Sie krümmte sich. »Was um Himmels Willen machst du denn da«, sagte sie. Ihre Stimme klang so distanziert, als läge der ganze Raum zwischen uns. Trotzdem schrak ich zusammen. Dann zog sie sich das Leintuch um die Schultern und floh aus ihrem Schlafzimmer in die benachbarte Küche. Dort setzte sie sich an den Küchentisch. Nach ungefähr zehn Minuten sagte ich: »Imogen?« Doch sie erstarrte nur. Eine Stunde verging, dann noch eine. Imogen rauchte und füllte ihr Glas immer wieder mit Eiswürfeln aus dem Eisbehälter auf, dann mit Wasser aus dem Hahn. Sie hatte immer noch das Leintuch umgewickelt.
»War’s ein schlimmer Tag auf dem Friedhof?« fragte ich schließlich. Denn von 1929 bis 1938, dem Jahr, in dem sie dreißig wurde, betreute Imogen den kleinen jüdischen Friedhof in der Windsor Street, der zur Robie Street-Synagoge gehörte und etwa zehn Straßen vom Citadel Park im Stadtzentrum entfernt lag. Als ich am Tag zuvor beim Friedhof vorbeischaute und Imogen fragte, ob sie nicht Lust hätte, mit mir essen und dann ins Kino zu gehen, hatte sie erzählt: »Neues Grab heute vormittag. Mrs. Esther Rossman. Macht insgesamt einhundertelf.« Imogen war mit allen Insassen ihres Friedhofs so vertraut, daß sie sie beim Vornamen nannte, und kannte darüber hinaus jedes Gräschen, jedes Unkraut, jeden Busch. Darauf war sie sehr stolz.
»War’s ein schlimmer Tag auf dem Friedhof?« hatte ich jedenfalls deshalb gefragt, weil ich einen Vorstoß wagen wollte. Ich versuchte, ein Gespräch mit ihr anzuknüpfen. Obwohl wir seit zwei Jahren miteinander schliefen, mußte ich sie ziemlich oft mit Worten umkreisen, um herauszufinden, wie sie gelaunt war. Sogar wenn ich neben ihr im Bett lag, im Schlafzimmer, das entweder stockdunkel oder nur ganz schwach von dem Lichtstreifen aus der Küche erhellt war, der unter der geschlossenen Tür durchdrang, schien sie nicht immer unmittelbar zugänglich. Es war mir auch ein Rätsel, warum sie stets darauf bestand, die Schlafzimmertür zu schließen, obwohl doch nur wir beide in der Wohnung waren.
»Heute habe ich viel gearbeitet«, sagte sie, stand auf, immer noch in das Leintuch gehüllt, goß sich ein weiteres Glas Wasser ein und setzte sich wieder an den Tisch. »Ich habe viel geschafft. Wenn ich so auf Händen und Knien arbeite, DeFoe, komme ich zum Nachdenken wie sonst selten. Ich meine, wirklich zum Denken. Beim Unkrautjäten oder allein im Bett, im Dunkeln. Mit einem Waschlappen über den Augen, wenn die Kopfschmerzen nachgelassen haben, oder einem kalten Waschlappen auf der Stirn, der sie lindert. Weißt du, manchmal kommt es mir vor, als dürfte ich nur zwischen den Kopfschmerzen leben. Ich erwarte nicht, daß du mich verstehst. Jedenfalls kann ich nicht richtig denken, wenn du in meiner Wohnung bist. Nicht wirklich. Du bekommst nichts davon mit, aber ich muß immer eine Entscheidung treffen: Entweder unterhalte ich mich mit dir, oder ich habe den Freiraum zu denken. Vermutlich können manche Leute auch nachdenken, wenn eine weitere Person im Zimmer ist. Ich gehöre nicht dazu. Ich hätte unsere Verabredung heute abend absagen sollen. Wirklich. Denn während wir hier so sitzen, genau in diesem Moment, muß ich über einen neuen, sehr, sehr schwierigen Satz nachdenken, und damit würde ich gern so bald wie möglich anfangen. Miss Delbo hat ihn zu mir gesagt, als sie vor zwei Tagen das Grab ihrer Mutter besuchte.«
»Darf ich ihn wenigstens hören?«
»Du darfst, aber du mußt gut aufpassen. Es ist nur ein Satz, aber er hat viele Teile. ›Das Leben besteht aus Dramen der Entfremdung und Wiederversöhnung der Seele.‹ Mein Gott, ist das kompliziert.«
»Ich würde dazu ein Wörterbuch brauchen.«
»Ich brauche, um den Sinn zu erfassen, Stunden im Dunkeln, mit geschlossenen Augen. Es besteht eine wenn auch geringe Möglichkeit, daß Miss Delbo mit diesem Satz jemanden zitiert hat. Sie liest viele Bücher, weißt du. Aber für mich klang der Satz original. Direkt von ihr. Miss Delbo zeigt in ihrem Denken wirklich Originalität.«
»Auf mich hat sie schon immer intelligent gewirkt, das ist wahr.«
Imogen kam herüber und küßte mich auf die Stirn. »Bitte nimm’s nicht persönlich und reg dich auch nicht darüber auf, DeFoe«, sagte sie. »Aber ich wünsche mir ganz ehrlich, du würdest jetzt gehen. Ich habe kein bißchen Hunger. Wir unternehmen später diese Woche was zusammen, ja?«
Aber ich verließ ihre Wohnung doch erst um 5.30 Uhr früh. Sie schloß die Schlafzimmertür und grübelte über ihren Satz nach. Dann kam sie ins Bett. Auch wenn wir nicht miteinander schliefen, taten wir doch alles andere. Und den ganzen Tag roch ich im Museum Imogen auf meiner Haut. Ich dachte, ich hätte mir alle Spuren ihres Lippenstifts von Ohren, Hals, Kinn, Nase, Rücken und Beinen abgewaschen, und sein Duft verblaßte wohl auch im Lauf des Tages, aber ganz verschwand er nicht. Zwischen 10 Uhr und der Ankunft meines Onkels hatte ich meinen Posten im Raum C bezogen. Eine Weile stand ich neben dem Stuhl in der Ecke. Dann ging ich zur Bank hinüber und setzte mich. Dann stand ich auf. Ich rückte die Jüdin auf einer Straße in Amsterdam gerade, verschob eine Ecke um vielleicht einen halben Zentimeter. Ich hatte bemerkt, daß das Bild schief hing, ohne seinen Inhalt wahrzunehmen. Eigentlich hatte ich von allen Holländern nur flüchtig Notiz genommen. Ich schaute aus dem Fenster zum Hafen hinüber. Regenwolken jagten über die alten Schoner aus dem vorigen Jahrhundert hinweg, diese Touristenschiffe, die man gegen eine Gebühr besichtigen konnte. Meine Haare waren ordentlich gekämmt. Ich setzte mich wieder auf die Bank. Dann stand ich auf. Ich ging zum Fenster zurück. In mir tobte ein Sturm.
Ich ging in die Putzkammer, um nach meinem Onkel zu sehen. Er lag immer noch schlafend auf der Liege. In den Jahren, in denen wir ein Hotelzimmer teilten, als ich noch klein war, nicht zu erwähnen die Dutzende Male, die er in der Putzkammer eingeschlafen war, sah er im Schlaf oft unglücklicher und verzweifelter aus als in seinen schlimmsten wachen Momenten. Erst befremdete mich dies, doch dann gewöhnte ich mich daran, weil er mein Onkel war. In der Putzkammer starrte ich gebannt in sein Gesicht, und der Ausdruck der Erschöpfung, die zusammengebissenen Zähne, die hart zusammengepreßten Lippen ließen mich nicht mehr los. Es war genau jener Ausdruck, den sein Gesicht am Vormittag des 23. Juli 1921 zeigte. Meine Eltern, Cowley und Elizabeth Russet, kamen an diesem Vormittag beim Absturz eines Zeppelins auf dem Festplatz im Fleming Park ums Leben.
Meine Eltern hatten jeder 50 Cents bezahlt, um in der Gondel mitzufahren, über Halifax und den Hafen hinwegzuschweben und dann wieder im Park zu landen.
An jenem Tag war ich mit meinem Onkel auf der Veranda des Lord Nelson Hotel gesessen, wo mein Onkel schon damals wohnte. Wir hatten uns die Veranda ausgesucht, weil er in der Zeitung gelesen hatte, daß die Route des Zeppelins direkt über das Hotel hinwegfuhren sollte. Es war ein heißer Tag. Ein Kaffee nach dem anderen – so arbeitete mein Onkel das Besäufnis des Vortags ab, und ich aß ein Sandwich und löffelte dazu ein Ingwerbier mit Vanilleeis. Mein Onkel wollte gerade davon probieren, als ein Mann – ich erinnere mich an seinen Schnauzbart, an die bis zu den Ellbogen hochgekrempelten Ärmel seines schweißdurchtränkten weißen Hemds – die Treppe heraufstürmte und rief: »Ist ein Dr. Moore hier?« Am anderen Ende der vollbesetzten Veranda erhob sich Dr. Moore und zog die Stoffserviette aus seinem Kragen. »Hier!« rief er zurück und hob die Hand wie ein Schuljunge. »Ist etwas mit meiner Tochter?«
Der Mann mit dem Schnauzbart stieg auf einen Stuhl. Mittendrin erstickte ihm die Stimme, aber er brachte noch hervor: »Sie werden auf dem Festplatz gebraucht. Dort ist alles voller Leichen!«
Was dann passierte, werde ich nie vergessen. Ich riß meinen Onkel am Ärmel. »Ich will hin! Ich will hin!« Aber er hob mich einfach von meinem Stuhl. Als Achtjähriger war ich ein schmächtiger Junge, und mein Onkel stellte mich mitten auf den Tisch. Dabei umschlang er mich so fest, daß ich glaubte, er würde mir die Rippen brechen. Es erschreckte mich, wie fest er mich umklammert hielt. Ich spürte die Teller und das Besteck unter meinen Schuhen, hörte den Tumult, der hier und weiter weg losbrach, sah Leute von der Veranda rennen, die nach ein paar Sekunden leergefegt war bis auf uns zwei. Mein Onkel hielt sein Gesicht dann ganz nahe an meins und sagte: »Du rührst dich nicht vom Fleck, DeFoe. Du wartest hier. Hier kann dir nichts passieren. Setz dich hin und rühr dich nicht von der Stelle, verstanden?«
Mein Onkel rannte ins Hotel. Ich blieb auf dem Tisch stehen, weil ich von dort die beste Aussicht auf die Leute hatte, die die South Park Street entlang ausschwärmten, in die Parkanlagen hinein. Ich sah einige Männer und Frauen, die Pferdekutschen heranwinkten und den Fahrern das Geld fast entgegenwarfen. Inmitten des Chaos und der Menschen, die schreiend kreuz und quer durcheinanderliefen, bäumten sich zwei der Pferde mit hysterischem Wiehern auf und eines von ihnen begann, seine Kutsche rückwärts zu bugsieren. Die Kutsche geriet in Schräglage und der Kutscher und die Dame, die mitfahren wollte, sprangen beide rasch heraus. Ich erinnere mich noch, wie ich dachte: »Alle diese Erwachsenen sind in eine schreckliche Sache verwickelt.« Das Pferd schob die Kutsche tatsächlich den ganzen Park entlang rückwärts, der Kutscher rannte hinterher, wild mit den Armen fuchtelnd, was das Ganze wahrscheinlich noch verschlimmerte. Der alte Konditor Dunsten Brooken, den mein Onkel oft dazu überredete, Kuchen mit Rumfüllung zu backen, hastete mit seiner Kochmütze und seiner vollgespritzten Schürze dicht an mir vorbei, auf die Straße hinaus. Ich verfolgte seine zwischen den Rosensträuchern auf und ab hüpfende Mütze, bis sie sich im Park verlor.
Nach wenigen Minuten kam mein Onkel zurück. Er brachte eine Frau mit, die ich schon im Hotel gesehen hatte. Gelegentlich setzten mich meine Eltern hier ab und ich machte an einem Ecktisch meine Hausaufgaben, während mein Onkel mit den Hoteldienern Karten spielte und ein Auge auf mich hatte.
Ich hatte gesehen, wie mein Onkel diese Frau vor dem Aufzug im Hotel geküßt hatte. Sie war sehr hübsch und hatte rote Haare, die zu einem Bubikopf geschnitten waren. Aber jetzt wirkte sie furchtbar nervös. Mein Onkel hob mich auf die Veranda herunter. »Schau mal, DeFoe«, sagte er. »Das ist Altoon Markham. Eine gute Freundin von mir. Sie wird auch deine gute Freundin sein, ja? Und sie bleibt bei dir, solange ich ... Auf dem Festplatz werden jetzt Erwachsene gebraucht. Verstehst du mich?«
»Ich komm mit dir mit.«
»Nein, ich fürchte, das geht leider nicht.«
»Wir werden uns prima vertragen, wir beide«, sagte Altoon Markham. Sie zwinkerte mir heftig zu und zwang sich ein Lächeln ab.
»Auf dem Festplatz sind ein paar Leute gestürzt«, sagte mein Onkel. »Ich helfe sie aufheben.«
»Okay. Ich bleib hier. Aber sag Mama und Papa, wo ich bin. Ich möchte nicht, daß sie glauben, ich wäre allein. Du weißt ja, was sie anhaben, Onkel Edward. Du findest sie bestimmt. Mein Vater hat einen neuen Haarschnitt.«
»Ich weiß«, sagte mein Onkel. Er gab mir einen Kuß auf den Scheitel.
»Also los, mein Schatz«, sagte Altoon Markham, »wir besorgen uns ein Eis. Die Köche und Kellner sind alle auf und davon, wir brauchen uns das Eis nur zu nehmen. Wir sind Eisräuber, dieses eine besondere Mal, ja? Und Kuchen klauen wir uns auch.«
»Du hast doch heute Geburtstag, nicht?« sagte mein Onkel.
Die Verwirrung in Altoons Gesicht schlug rasch in übertriebenes Einverständnis um. »Ach ja, natürlich. Bei der ganzen Aufregung hätte ich fast meinen Geburtstag vergessen. Hast du nicht Lust, mit mir zu feiern, DeFoe? Eine kleine Geburtstagsparty nur mit uns beiden?«
»Laß ihn nicht aus den Augen«, sagte mein Onkel.
Er drückte Altoon ein paar zusammengeknüllte Dollarscheine in die Hand. Dann warf er mir einen strengen, liebevollen Blick zu, in den sich auch eine Spur Mitleid einschlich, was mir auffiel, weil ich einen solchen Blick noch nie an ihm gesehen hatte. Er löste in mir den Drang aus, Altoon Markhams Hand ganz fest zu umklammern, obwohl mir diese Frau völlig fremd war. »Altoon hat auf ihrem Zimmer ein Kurzwellenradio«, sagte mein Onkel. »Mit dem kriegst du London rein – alle möglichen Städte auf der ganzen Welt. Frag sie, ob sie dir zeigt, wie es funktioniert, ja?«
»Wenn’s mir gefällt, besorgst du mir dann auch eins?«
»Abgemacht. Ich versprech’s dir.«
»Okay«, sagte ich. Die Gesichter der beiden, meines Onkels und Altoons, hatten mir inzwischen genug verraten, um mich davon zu überzeugen, daß etwas sehr, sehr Schlimmes passiert sein mußte. Mein Onkel rannte die Verandastufen hinunter.
»Edward hat hübsche Schuhe an«, sagte Altoon Markham, eine Bemerkung, die meinen momentanen Gefühlen dermaßen zuwiderlief, daß ich mich gleich daraufstürzte.
»Ich war dabei, als er sie gekauft hat«, erzählte ich stolz.
»In welchem Schuhgeschäft – bei Kerr’s?«
»Ja, Ma’am.«
»Nein, so was ... ich bin sicher, du hast ihm beim Aussuchen geholfen. Und wie ich sehe, habt ihr beide einen guten Geschmack! Also, jetzt schleichen wir uns in die Küche, einverstanden?«
Sie nahm mich an der Hand und wir gingen durch das verlassene Foyer ins Restaurant. Dort stieß sie die weiße Schwingtür auf, die in die Küche führte, und marschierte zum Gefrierschrank an der hinteren Wand. Sie öffnete die Tür und nahm Behälter mit drei verschiedenen Eissorten heraus. Dann blickte sie sich um und fand, was sie suchte. »Und da ist mein Kuchen!« rief sie und deutete auf einen Schokoladenkuchen, in dem schon Kerzen steckten. Sie hatte gar nicht Geburtstag, wie ich später herausfand. Aber Altoon und mein Onkel hatten sich diese Lüge ausgedacht, um zwischen uns eine größere Vertrautheit zu schaffen, während sie mich ablenkten. Es klappte, denn als Altoon sagte: »Dunsten Brooking hat absichtlich so wenig Kerzen reingesteckt, damit mir das Älterwerden nicht so viel ausmacht«, glaubte ich ihr. Mein Onkel hatte mir oft zu verstehen gegeben, daß alle, die im Lord Nelson Hotel arbeiteten – Hoteldiener, Kellner, Wäscherinnen, Köche, die Leute an der Rezeption, Putzfrauen –, eine große Familie wären. Sie kannten von einander kleine Geheimnisse, die nie über die Verandatreppe nach Halifax hinausdrangen. Daher hatte ich das Gefühl, Altoon Markham hätte mir ein Geheimnis anvertraut. Ich legte die Finger auf die Lippen und machte »Pssst!«, als würde ich nie im Leben einer Menschenseele etwas davon verraten. Altoon nahm die Eisbehälter und ging mit mir zum Kuchen hinüber.
»Wie war’s, wenn wir uns an einen Tisch drinnen im Restaurant setzen würden?« fragte sie.
»Ist mir schon recht«, sagte ich. Ich ging die Eissorten durch. »Ich möchte nur Vanille.«
Sie stellte die anderen beiden Behälter in den Gefrierschrank zurück. »Ich trage den Kuchen, du nimmst das Eis. Such dir irgendeinen Tisch aus, der sauber ist.«
Auf einigen Tischen standen die Reste eines abgebrochenen Mittagessens. Ich wählte einen Tisch in der Nähe des Fensters, das zum Park hinausging. Altoon stellte den Kuchen ab und lud Eis auf unsere Teller.
»Es ist Brauch, daß ich mir etwas wünsche«, sagte Altoon, »aber weißt du was?« Sie griff in die Tasche ihres weißen Kittels, nahm ein Streichholzheftchen heraus und ließ ein Hölzchen aufflammen. Während sie die Kerzen anzündete, sagte sie: »Ich trete meinen Wunsch an dich ab, DeFoe.«
»Ich hab Bauchweh.«
»Nanu, DeFoe, dabei hast du doch noch keinen Bissen Kuchen oder Eis gegessen.«
»Ich weiß. Ich hab trotzdem Bauchweh. Ich will mir nichts wünschen.«
»Iß doch ein winziges Stückchen Kuchen. Dann gehen wir in mein Zimmer hinauf und du kannst alle möglichen Länder im Radio suchen.« Sie schloß die Augen. »Ich wünsche mir etwas für dich, wie wäre das?« Sie blies die Kerzen aus. Dann schnitt sie für jeden von uns ein Stück Kuchen ab. Jetzt hatte ich schon richtige Magenkrämpfe, mußte mir sogar die Hände auf den Magen pressen. Altoon beugte sich über mich und sagte leise: »Na komm, mein Schatz. Wir gehen hoch, ja?«
»Ich will, daß meine Mama und mein Papa wiederkommen.«
»Edward ist sie schon suchen gegangen.«
Wir gingen in Altoons Zimmer hoch, das, wie ich mich bis heute erinnere, die Nummer 43 hatte. Ich sah das große Radio auf ihrem Schreibtisch, hatte aber das Interesse daran verloren. Ich legte mich sofort auf Altoons Bett. Statt der im Hotel üblichen Chenille-Tagesdecke lag ein Federbett darauf. Mir fiel gleich auf, wie gemütlich es in Altoons Zimmer war. Plötzlich überfiel mich eine große Erschöpfung und ich schlief ein. Als ich wieder aufwachte, bügelte Altoon ein Hemd. »Schlafmütze«, sagte sie lächelnd. »Ich habe meine Arbeit mit hochgenommen, aus der Wäscherei unten. Ich bin nur ein paar Minuten aus dem Zimmer gegangen. Zu lange hätte ich dich nicht allein gelassen. Die Hoteldiener haben mir geholfen, die Sachen hochzuschleppen.«
Auf dem Boden standen vier oder fünf Körbe voll Wäsche.
»Du bist so plötzlich eingeschlafen, als hätte ich eine Kerze ausgeblasen«, sagte sie.
»Ist mein Onkel schon zurück?«
»Ich fürchte, nein. Das heißt, ich furchte gar nichts, und er hat auch schon angerufen und gesagt, es würde noch etwas länger dauern. Hast du Hunger?«
»Draußen ist es dunkel.«
»Es ist dunkel geworden, während du geschlafen hast. Du hast geschlafen, als wäre es schon abends, DeFoe. Ich war ganz überrascht. Ich dachte, vielleicht wärst du krank, und hab dir die Stirn gefühlt. Aber du hast kein Fieber.«
»Meine Eltern sind gestern abend lange ausgegangen. Ich bin die ganze Zeit im Hotelfoyer gesessen. Mein Onkel hat Karten gespielt. Wahrscheinlich bin ich noch nie so lange aufgeblieben.«
»Das erklärt die Sache«, sagte Altoon, gab mir in allem recht.
»Wahrscheinlich helfen meine Mutter und mein Vater immer noch mit, die Leute aufzuheben. Die sind so.«
»Hast du Hunger?«
»Nein. Und es tut mir leid, daß ich dir dein Geburtstagsfest verdorben habe.«
»Du hast es mir ganz und gar nicht verdorben, junger Mann. Mir gefällt’s so. Nur wir zwei. Ich finde das sehr nett, du nicht? Eine Geburtstagsparty, eben ohne Kuchen und Eis. Deine Gesellschaft ist sehr angenehm, DeFoe. Egal, ob du schläfst oder wach bist.«
»Meine Mutter und mein Vater würden dich mögen.«
»Danke. Hilfst du zu Hause schon beim Bügeln?«
»Beim Bügeln nicht. Noch nicht.«
»Eigentlich wärst du alt genug dafür.«
»Da hast du wohl recht.«
»Was hältst du von folgender Idee: Du schenkst mir zum Geburtstag, daß ich dir das Bügeln beibringen darf. Vielleicht mußt du es eines Tages können.«
»Das wünschst du dir zum Geburtstag?«
»Gute, praktische Kenntnisse für dich. Eines Tages wird dich eine Frau dafür bewundern.«
»Ich wette, meine Mutter. Sie wird überrascht sein, daß ich bügeln kann.«
»Ich dachte jetzt eher, wenn du viel älter bist.«
»Das sind ja eine Menge Sachen, die du da bügeln mußt.«
»Das mache ich jeden Tag, sechs Tage die Woche. Aber weil ich schon lange hier arbeite, habe ich ein Vorrecht. Ich darf mir aussuchen, an welchem Tag in der Woche ich frei haben möchte. Es braucht nicht am Wochenende zu sein. Ich gehe zum Beispiel gern an einem Donnerstag in Halifax spazieren.«
»Dann mußt du wohl auch die Kleider meines Onkels bügeln. Weil er im Hotel wohnt.«
»Ja, so haben wir uns sogar kennengelernt, Edward und ich. Er ist in die Wäscherei heruntergekommen, um sich zu beklagen, wie schlecht ich seine Hemden gebügelt hätte, und ich habe ihm erklärt, sie wären einwandfrei gebügelt. Das war unser erstes Gespräch. Sehr romantisch, was?«
»Jetzt geht’s mir viel besser.«
»Bist du genügend bei Kräften für eine Unterrichtsstunde?«
»Ich glaub schon.«
Altoon stellte sich hinter mich ans Bügelbrett. Sie zeigte mir vor allem, wie man Hemden bügelt, und führte mir anfangs die Hand, als ich mit dem Dampfbügeleisen den Ärmel entlang, über den Rücken und zwischen die Knöpfe fuhr. »Das lernt man durchs Tun«, sagte sie. Und nach einer halben Stunde bügelte ich schon allein. Obwohl Altoon mir immer noch ausführliche Anweisungen gab, je nach Sorte Hemd. »Kontrolliere immer, ob Knöpfe fehlen«, sagte sie. »Wenn du zuviel Wasser aufsprühst, täuschst du dich leicht und kannst das Hemd sogar ansengen.« Dinge dieser Art.
»Wie alt bist du denn heute geworden?« fragte ich, legte ein Hemd zusammen, wie sie es mir gerade beigebracht hatte, und verstaute es in einem Korb. Sie saß auf dem Bett, blätterte eine Zeitschrift durch, sah aber immer noch zerstreut aus.
»Ich bin einunddreißig.«
»Meine Mutter ist dreiunddreißig. Mein Vater auch.«
»Großer Gott«, sagte Altoon. »Entschuldige mich bitte.« Und sie eilte ins Bad, schloß die Tür hinter sich und drehte den Wasserhahn auf, damit das Rauschen ihr Weinen übertönte. Tat es aber nicht. Ich bügelte mein Hemd weiter. Ein blaues Arbeitshemd, wie es mein Onkel am Bahnhof trug. Ich hörte Altoons Schluchzen und konnte mir nicht verzeihen, daß ich sie nach ihrem Alter gefragt hatte. Meine Mutter hatte mich einmal gewarnt: »Frage nie eine Frau, wie alt sie ist.«
Als Altoon wieder aus dem Bad kam, sah ihr Gesicht schrecklich aus. »Kann ich mich einfach mit dir aufs Bett legen, DeFoe? Ach, mein Schatz, wir haben uns gerade erst kennengelernt. Aber deinen Onkel Edward kenne ich sehr gut. Er hätte nichts dagegen. Es gibt nichts, weswegen wir uns dabei zu schämen hätten, nicht? Ich bin ja wie deine Tante. Du kannst mich ruhig als Tante sehen. Wir sind fix und fertig nach der vielen Büglerei, was? Komm doch her zu mir. Es ist schon spät. Zeit zum Schlafen. Wenn du nicht schlafen kannst, leg dich einfach mit offenen Augen hin.«
Ich ging zu dem Bett hinüber, wo Altoon sich hingelegt hatte, und sie schaltete die Nachttischlampe aus und umarmte mich. Im Stockdunkeln. Nach kurzer Zeit schon merkte ich an ihrem Atem, daß sie eingeschlafen war. Ich lag eine Weile wach. Aber schließlich wurde mir übel vor lauter ängstlichen Vorahnungen, und kurz darauf schlief ich erschöpft ein. Als ich wieder aufwachte, lag mein Onkel quer über dem Fußende des Betts und schlief ebenfalls. Ich packte ihn an den Schultern und rüttelte ihn wach. »Was hat so lange gedauert? Was hat denn so lange gedauert?« rief ich. »Onkel Edward!«
Er setzte sich auf. »Ach, DeFoe.« Altoon schlief tief und fest. »Neffe, ich habe schlechte Nachrichten für dich.«
Und dann sagte er es mir.
Ich saß mindestens eine Stunde im Bett auf demselben Fleck und konnte mein Zittern nicht unterdrücken. Ich weinte nicht, sondern schlotterte nur. Ich wickelte mich in das Federbett ein. Es war nicht kalt im Zimmer, eine Sommernacht. Ich erinnere mich, daß ich nichts weiter gesagt habe als: »Ich hab die ganzen Hemden gebügelt.« Mein Onkel ging nach unten und kam mit heißem Kakao zurück. Er goß einen kräftigen Schluck Rum dazu, das gab mir den Rest. Wir schliefen alle drei voll bekleidet auf dem Bett. Einmal bin ich in dieser Nacht noch aufgewacht, zerschlagen und erschrocken, und einen peinlichen Moment lang glaubte ich, ich sei zu meinen Eltern ins Bett gekrochen, wie ich es mit drei oder vier Jahren immer getan hatte. Das Radio weckte mich früh am nächsten Morgen. »... der Zeppelin ging etwa um 12.25 Uhr in Flammen auf und stürzte ab. Entsetzte Zuschauer ...« Ich schaltete ab. Ich sah, daß mein Onkel in den Schaukelstuhl übersiedelt war. Er schlief immer noch. Altoon war fort. Das Bügelbrett, das Bügeleisen und die zusammengefaltete Wäsche waren nirgends mehr zu sehen. Ich ging ins Foyer hinunter. Die Zeitung im Metallständer plärrte mir ihre Schlagzeilen entgegen:
BEI ZEPPELINABSTURZ 18 PASSAGIERE
UND 5 PASSANTEN GETÖTET
Kapitän und Besatzung sterben bei Unfall
auf dem Festplatz
Das Begräbnis fand eine Woche später statt. Ich erinnere mich, daß auf der anderen Seite des Friedhofs gleichzeitig ein weiteres Opfer des Zeppelinunglücks beerdigt wurde. Und als ich mit meinem Onkel und Altoon Markham an jenem anderen Grab vorbeiging, sah ich einen gleichaltrigen Jungen vor dem Sarg stehen. Unsere Blicke trafen sich und wir starrten uns einen flüchtigen Moment lang an. Es kostet mich Überwindung, hier zu gestehen, daß ich diesem Jungen einen Namen gegeben habe. Von diesem Tag an nannte ich ihn in meiner Erinnerung »Paul«. Ich habe keine Ahnung, warum. Der Name flog mir einfach so zu. In jener Nacht, als ich im Bett lag – vielleicht entspricht das einfach dem Denken eines Achtjährigen. Ich frage mich, ob er mir auch einen Namen gegeben hat.
Ab diesem Zeitpunkt lebte ich bei meinem Onkel. Vor dem Zeppelinunglück war ich jeden Tag in unserem Haus in der Brighton Street in meinem eigenen Bett aufgewacht und hatte gehört, wie sich meine Mutter und mein Vater in der Küche unterhielten. Plötzlich fand ich mich in einem anderen Leben wieder. Jetzt wachte ich auf dem Sofa im Zimmer meines Onkels im Lord Nelson Hotel auf. Auf diesem Sofa schlief ich die nächsten acht Jahre. Mein Onkel verkaufte das Haus meiner Eltern. Mit Ausnahme einiger Fotos, auf denen meine Eltern gemeinsam mit mir zu sehen waren, wurden die Erinnerungsstücke an meine ersten acht Jahre in Schachteln im Hotelkeller verstaut, in einem von Maschendraht eingezäunten, 3 x 5 Meter großen Verschlag. Ich ging weiter in dieselbe Schule. Hatte dieselben Freunde. Abends nach der Schule machte ich meine Hausaufgaben an einem Tisch, keine sieben Meter von meinem Onkel entfernt, der im Foyer Karten spielte. Ich beschäftigte mich vor allem mit Mathe, Geographie, kanadischer Geschichte und Weltgeschichte. Der Hoteldiener Jake Kollias, ein alter Freund meines Onkels, half mir ab und zu bei Geographie. »Das ist sowieso ein Hobby von mir«, sagte Jake. »Ich habe Landkarten schon immer geliebt. Wollte immer mal eine Expedition in ein exotisches Land machen. Aber jetzt mache ich nichts anderes, als in den Aufzug steigen, wieder aussteigen und Gepäck für Weltreisende schleppen.«
Ein Jahr nach dem Tod meiner Eltern heiratete mein Onkel Altoon Markham. Mit ihr war ich oft zusammen. Sie ging gern in den Zoo, in den botanischen Garten. Im Sommer fuhr sie mit mir an den Strand zum Schwimmen. Mein Onkel kam nie mit. Ich glaube, er konnte nicht schwimmen. Altoons Haare waren vom dunkelsten Rot, das ich je gesehen hatte, und auch seither ist mir nie wieder ein solches Rot begegnet. Als sie unvermittelt nach Saskatchewan zog und ich nach dem Grund fragte, antwortete mein Onkel mit einer Gegenfrage: »Wie kann es ihr nur in Saskatchewan besser gefallen?« Er weigerte sich, dieses Thema weiter mit mir zu besprechen. Eine andere Rothaarige, Constance Marchand, übernahm fast übergangslos Altoons Platz im Leben meines Onkels, soweit ich es beurteilen konnte. Vielleicht war sie sogar schon da gewesen, bevor Altoon ging. Constance wiederum überlappte mit Helene Fouset, einer hochgewachsenen Schwarzhaarigen, die gern über Kreuzworträtseln brütete, von denen sie gelegentlich hochblickte, um meinem Onkel beim Kartenspielen zuzusehen. Sie liebte das Foyer genauso wie er. Sowohl Constance als auch Helene waren im Hotel angestellt, wohnten aber nicht dort. Mein Onkel heiratete keine der beiden.
Was noch?
Der Kühlschrank unseres Hotelzimmers enthielt nie etwas Eßbares, alle Mahlzeiten nahmen wir im Speisesaal des Hotels, im Halloran’s oder manchmal im Bahnhofscafé ein. Was noch, was fällt mir sonst noch ein ...? Wie ich am Tisch saß und der Schein der Lampe auf meine Schulbücher fiel; das muffige Hotelfoyer; mein Onkel, der mit den Hoteldienern Witze machte und endlose Gespräche führte; die alte Standuhr in der südwestlichen Ecke. Das Geräusch des Kartenmischens. Wie ich mit dem Kopf auf dem Tisch einschlief. Vom Geräusch des Kartenmischens aufwachte. Wie mein Onkel Dinge sagte wie: »Ich wedel euch mal ’n bißchen von Abigails Parfum um die Nase, Jungs, damit ihr alle benebelt seid, dann schließ ich ne Wette mit euch ab und kann mich vom Gewinn den Rest meiner Tage mit Steaks ernähren!« Abigail Broyard. Die hatte ich ganz vergessen. Sie kam nach Helene. Eine sehr nette Frau. Und dann erinnere ich mich an einen neuen Nachtportier, der ins Lord Nelson kam, als ich vierzehn war. Er hieß Zachary Barth. Eines Abends machte ich meine Hausaufgaben, während Abigail Broyard auf der anderen Seite des Foyers in einem Buch las. Ich hörte, wie Mr. Barth zu einer Frau, die sich gerade ins Gästebuch eingetragen hatte, bemerkte: »Sehen Sie den Jungen da drüben? Der sitzt jeden Abend an diesem Tisch. Hat keine Eltern mehr. Erinnern Sie sich an den Zeppelinabsturz?« Mein Onkel hörte das. Er stand sofort vom Kartentisch auf, ging hinter die Theke, faßte Zachary Barth, der viel größer war als er, am Ohr – wie schmerzhaft: das war, zeigte nur sein verzerrtes Gesicht. So zog mein Onkel diesen Zachary Barth ins Hinterzimmer. Als mein Onkel wieder herauskam, setzte er sofort auf das Blatt, das er in der Hand hielt, verlor einen ganzen Haufen Münzen und Scheine und lachte eine Spur zu laut über sein Pech. Zachary Barth kam seinerseits mindestens zehn Minuten nicht mehr zum Vorschein. Als er schließlich auftauchte, hielt er sich einen Eisbeutel gegen den Unterkiefer. »An die Arbeit!« schnauzte er einen Hoteldiener an. Es war Alfred Ayers. Doch die Frau, die gerade angekommen war, war schon in ihr Zimmer hochgegangen. Es gab kein Gepäck, um das sich Alfred hätte kümmern können. Da verzog er sich einfach auf die Veranda, um eine zu rauchen.
Mit sechzehn schmiß ich die Schule hin. Mein Onkel und ich haben nie darüber geredet. Aber er besorgte mir gleich einen Job beim Bahnhof, bei der Gepäckaufbewahrung, wo wir Seite an Seite arbeiteten. »Jetzt, wo du einen neuen Job hast«, sagte er, »solltest du an eine eigene Wohnung denken.« Und eine Woche später wohnte ich in Zimmer 22. Mein Onkel hatte eine Monatsmiete für mich vorausbezahlt. Die er, wie er zugab, beim Pokern gewonnen hatte. »Was macht das schon aus?« sagte er. »Alfred und Jake – die kannten dich schon als Dreikäsehoch. Alle Hoteldiener hätten sowieso für deine Miete zusammengelegt, wenn ich ihnen das Geld nicht beim Kartenspielen abgeknöpft hätte. Laß bloß keine Schuldgefühle aufkommen oder mach dir groß Kopfzerbrechen. Eine Monatsmiete, was ist das schon? Ich bin dein Onkel, also ist kein Haken an der Sache.«