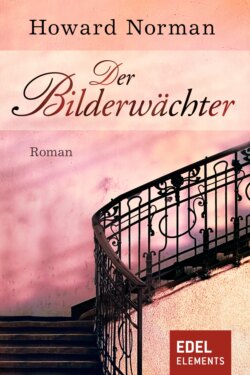Читать книгу Der Bilderwächter - Howard Norman - Страница 5
IMOGEN LINNY
ОглавлениеDer 19. September 1936, mein erster Tag als Museumsaufseher, war auch der Tag, an dem ich Imogen zum ersten Mal begegnete.
Um 8.30 Uhr stand mein Onkel mit einem übernächtigten, trübsinnigen Gesicht dabei, als mir Mr. Connaught, der wie üblich einen seiner elegant geschnittenen Anzüge trug, die grundlegenden Verhaltensregeln für meine Tätigkeit aufzählte. Er hatte sich zu diesem Zweck auf Museumsbriefpapier Notizen gemacht.
»Also. Jeder Besucher ist mit ›Ma’am‹ oder ›Sir‹ anzureden«, begann er. »Ohne Ausnahme, gleichgültig, wie sich die Leute benehmen. Sollte jemand ein Gemälde berühren, machen Sie ihn als erstes höflich darauf aufmerksam. Sie werden feststellen, daß die meisten Besucher dann äußerst überrascht sind. Sie haben gar nicht gemerkt, was ihnen da unterlaufen ist. Das ist wirklich oft so. Wenn Sie nun ein Kind zurechtweisen müssen, tun Sie es behutsam und setzen dann die Eltern in Kenntnis, falls sie nicht ohnehin daneben stehen. Manchmal ist auch ein Kindermädchen die Aufsichtsperson. Als Aufseher haben Sie absolut das Recht, einen Tadel auszusprechen. Präsentieren Sie sich als Autoritätsperson.« Er zog seine Liste zu Rate. »Jede Person, die sich auf irgendeine Weise ungebührlich benimmt«, fuhr er fort, »bekommt in meinem Museum kein zweites Mal die Gelegenheit dazu. Sorgen Sie dafür, daß solche Personen dieses Haus auf der Stelle verlassen. Ansonsten lassen Sie sich natürlich von Ihrem gesunden Menschenverstand leiten. Meiden Sie jeden Streit. Streiten ist unter der Würde eines Museumsaufsehers. Achten Sie auf eine gleichbleibende Stimmlage.
Sollten die Dinge allerdings – was selten vorkommt, aber doch passiert – sollten die Dinge also außer Kontrolle geraten, holen Sie Edward zu Hilfe, wecken Sie ihn auf, wenn’s sein muß, doch bitten Sie ihn um Beistand. Haben Sie sonst noch Fragen, DeFoe?«
»Nein, Sir.«
»Irgend etwas hinzuzufügen, Edward?«
Mein Onkel zuckte mit den Achseln. »Mein Neffe ist ein aufgeweckter Junge, Edgar. Wird den Bogen schnell raus haben, in zwei, drei Tagen.«
Mr. Connaught studierte noch einmal sorgfältig seine Liste. »Ach, ja«, sagte er dann. »Zwei Punkte noch. Bei uns wurde noch nie ein Gemälde beschädigt.« Er steckte die Liste in die Brusttasche seines Jacketts. »Und als letztes, DeFoe – wir hatten noch nie einen Diebstahl zu beklagen.«
Dann schüttelte mir Mr. Connaught die Hand. Ich schüttelte meinem Onkel die Hand. Für mich war es ein wunderbarer, sehr persönlicher Moment in meiner Berufslaufbahn. Mein Onkel ging in die Putzkammer. Wir hörten, wie er das Radio anschaltete. Er suchte mehrere Sender ab und ließ dann klassische Musik laufen. Es ließ sich nie voraussehen, für welche Radiosendungen er sich entscheiden würde. Ich ging in den Raum C, wo mich Mr. Connaught anschließend aufsuchte. »DeFoe«, sagte er, »ich habe etwas ausgelassen. Weil es sich um einen wunden Punkt handelt, wollte ich die Angelegenheit vor Edward nicht erwähnen. Im Grunde gehört die Sache längst der Vergangenheit an. Ich meine den Vorfall mit dem Cupido.«
»Cupido?«
»Das soll Edward Ihnen selbst erzählen. Es war eindeutig nicht der glanzvollste Tag in der Geschichte des Museums. Edward war damals in Höchstform. An dem Vorfall beteiligt war außer Edward noch unsere geschätzte Kunsthistorikerin Miss Delbo. Und mehrere Besucher.«
»In Ordnung«, sagte ich. »Ich werde versuchen, die Sache in ein Gespräch einfließen zu lassen.«
»Ich habe diese Angelegenheit nur erwähnt, weil sie Anlaß zur einzigen Beschwerde gab, die je bei uns eingegangen ist. Damit Sie sehen, daß Sie nun zu einer Einrichtung gehören, die hohes öffentliches Ansehen errungen hat. Bemühen Sie sich, diesem Anspruch gerecht zu werden.«
»Ich werde mein Bestes tun, Mr. Connaught.«
Mr. Connaught bedachte mich mit einem knappen Lächeln und kehrte in sein Büro zurück. Punkt 10 Uhr schloß mein Onkel die Tür der Putzkammer hinter sich und bezog seinen Posten im Raum A, in der Nähe des Fensters, das zur Straße hinausging. Er starrte auf die Agricola Street hinaus, in einen verregneten Vormittag. Mr. Connaught schloß die Eingangstüre auf. Sobald Mr. Connaught hinter der Tür seines Büros verschwunden war, schlenderte mein Onkel zu mir herüber. »Gehen wir nach der Arbeit doch ins Halloran’s«, schlug er vor. »Um deinen ersten Tag im Museum zu feiern. Egal, wie gut oder schlecht es dir dabei gegangen ist. Ich lade dich ein.«
»Das ist sehr großzügig von dir.«
»Wir unterhalten uns über dies und jenes.«
Am Vormittag lief alles glatt. Es gab nichts, was ich als Vorfall betrachtet hätte. Nun ja, in der Herrentoilette bin ich zufällig auf einen Mann gestoßen, der dort eine Zigarre rauchte, ich wußte aber nicht, ob das gestattet war oder nicht. Ein Zigarrenstummel in der Toilettenschüssel. Asche im Waschbecken. Ein gehässiger Blick von dem alten Knacker. Sonst nichts. Eigentlich überhaupt nichts. Bis Mittag waren dreizehn Besucher gekommen. Das weiß ich, weil mir mein Onkel den Knipser zeigte. Der Aufseher, der den Raum A unter sich hatte, bekam einen kleinen Knipser mit Zählwerk ausgehändigt. Am Ende des Arbeitstags war dieser Knipser auf Mr. Connaughts Schreibtisch zu deponieren. Der Kurator trug die Besucherzahl jedes Tages in einen Ordner ein und verglich sie mit dem Geldbetrag in der Schachtel, auf der ›Eintritt 25 Cents‹ stand. Kinder unter zwölf knipsten wir nicht. An meinem ersten Tag hörte ich, wie mein Onkel ein junges Mädchen ohne Umschweife fragte: »Wie alt bist du denn?« Ihre Mutter sagte: »Das geht Sie gar nichts an«, und schob dann einen Dollarschein in den Schlitz; auch wenn das Mädchen über zwölf gewesen wäre, bedeutete das immer noch eine Spende von 50 Cents.
Raum C beherbergte eine Ausstellung von zwanzig Landschaftsbildern aus der ganzen Welt. Das größte war, schätze ich mal, 45 x 50 Zentimeter groß, ein Gemälde aus Spanien.
Gegen 11.30 Uhr, als im Besucherstrom eine Flaute eintrat, schlenderte mein Onkel wieder zu mir herüber. »Was hältst du von diesen Landschaftsbildern, die du unter Einsatz deines Lebens bewacht hast, DeFoe?« wollte er wissen.
»Es ist wie reisen. Ich bin ja noch nie woanders als in Halifax gewesen, wie du weißt.«
»Dieser Haufen Bäume! Da überkommt mich der Drang, in einen Zug nach Toronto zu springen«, sagte er. »Städte sind mir viel lieber. Mir gefallen Bilder vom Großstadtleben.«
»Also, das da …« Ich deutete auf eine niederländische Landschaft von Jan van Kessel. Ich erinnere mich noch, daß ich dachte, ich würde den Namen sicher gleich falsch aussprechen, versuchte mich aber trotzdem daran. »Das hat Jan van Kessel gemalt. Die Felder und …«
»Das ›J‹ wird nicht wie das ›dsch‹ in ›Jeans‹ ausgesprochen«, verbesserte mich mein Onkel. »Jan beginnt mit demselben Laut wie ›Jahr‹, so sprechen die Holländer das aus. Du mußt deine Fremdsprachenkenntnisse aufpolieren, wenigstens, was die Aussprache betrifft. Solche Grundkenntnisse gehören mit zu den Aufseherpflichten. Den Rest kannst du der kunstsinnigen Delbo überlassen.«
»Schon gut. Na ja, du hast mich gefragt, und bis jetzt fand ich meine Arbeit interessant. Es war kein Hinweis, keine Verwarnung nötig. Und es gibt nur ein, zwei Landschaften, die ich nicht gern in Wirklichkeit sehen würde. Ich würde mich gern genau an dieser Stelle am Fluß hinlegen und ein Nickerchen machen, in dieser japanischen Landschaft da drüben, die wie eine Schriftrolle aussieht.« Ich deutete auf die Wand gegenüber. »Die mit den weißen Vögeln.«
»Diese Vögel sehen aber aus, als könnten sie dich ganz schön verletzen. Ne Art Reiher, glaub ich. Oder japanische Kraniche. Elegant, sicher, aber mit scharfen Fängen, und schau dir mal die Schnäbel an. Ich weiß nicht. In ihrer Nähe würde ich nicht so gern einschlafen.«
»Wenn du mich fragst, sieht der Ort ganz friedlich aus.«
»Aber, aber, DeFoe. Du darfst dich nicht zu stark von den Bildern mitreißen lassen. Schweif nicht ab und träum in den Tag hinein, sondern bleib wachsam, ja? In einer Woche oder so werden wir sicher eine Schulklasse kriegen. Bei denen mußt du echt auf Zack sein.«
»Das japanische Bild ist sehr friedlich, aber ich schlafe bei seinem Anblick trotzdem nicht im Stehen ein, Onkel Edward. Außerdem habe ich heute früh im Hotel zwei Tassen Kaffee getrunken. Ich bin hellwach. Mir entgeht nichts.«
»Willst du als erster Mittag machen? Ich schlage vor, du kaufst dir ein Sandwich beim Stand im Park. Ich finde den Park angenehm und ruhig. Sonst bietet sich natürlich immer noch die Veranda des Lord Nelson an.«
Doch ich hatte mich bereits zur Tür umgedreht, wo gerade eine junge Frau eingetreten war, die sich in ihrer Kleidung erheblich von der durchschnittlichen Museumsbesucherin abhob (nach meiner ganzen Erfahrung des ersten Vormittags jedenfalls): Sie trug eine Latzhose, eine blaue Bluse, einen schwarzen, etwas fadenscheinigen Pulli und Arbeitsschuhe. Ihre roten Haare hatte sie unter eine Art flache Strickmütze gestopft, die fast die Form einer Baskenmütze hatte. Ich muß zugeben, ich starrte sie unverblümt an.
Mein Onkel drehte sich ebenfalls um und folgte meinem Blick. »Ach, die«, sagte er dann. »Ja, sie kommt ab und zu rein. Die Delbo hat mir erzählt, sie ist Gärtnerin im jüdischen Friedhof. Ich persönlich habe noch keine zwei Worte mit ihr gewechselt. Mir ist allerdings aufgefallen, daß sie neulich einen anderen Museumsbesucher hat abblitzen lassen, der sie anquatschen wollte. Da dachte ich – ich erinnere mich, daß ich zweierlei dachte. Dunkelrote Haare wie die ihren haben die gefährliche Tendenz, mich zum Wahnsinn zu treiben. Zweitens: Sie und ich, wir haben wahrscheinlich etwas gemeinsam. Wir wollen in einem Museum nicht von anderen Leuten belästigt werden.« Mein Onkel lachte über seine eigenen Spekulationen. Dann kehrte er zum Thema zurück. Er griff in seine Tasche und holte einen Penny heraus. »Okay, dann werfen wir eben eine Münze, wer zuerst Mittag macht.« Er schnippte den Penny in die Luft und fing ihn mit einem Klatschen zwischen beiden Händen wieder auf.
»Kopf«, sagte ich.
Mein Onkel hob die obere Hand hoch und sagte: »Zahl. Ich bin in einer halben Stunde wieder da – so in etwa.«
Mein Onkel ging an Imogen vorbei und blieb bei den Postkarten stehen. »Mrs. Jonatis«, sagte er, »kann ich Ihnen irgend etwas mitbringen? Vielleicht einen Tee?« Mrs. Jonatis war eine ältere Dame um die sechzig, die damals ehrenamtlich den Bücherstand betreute. Ihre Haare erweckten auf den ersten Blick den Eindruck eines silbernen Helms. Sie hatte ein freundliches Lächeln und behandelte alle Besucher gleich zuvorkommend. »Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, den Klappentext jedes einzelnen Buches zu lesen, das wir in unserem Bücherstand führen, damit ich über den Inhalt Bescheid weiß«, hatte sie mir heute am späteren Vormittag erzählt, nachdem Mr. Connaught uns bekannt gemacht hatte. »Ein Vorschlag von Miss Delbo.« Sogar auf ihrem beengten Raum schien sie geschäftig hin und her zu eilen. Sie hielt den Stand in peinlicher Ordnung. Jeden Vormittag staubte sie die Postkarten und das Gestell ab, in dem sie steckten.
»Nein danke, Edward«, erwiderte sie. »Ich knabbere wie immer an meinem Hörnchen. Und trinke mein speziell verordnetes Mineralwasser. Auf Anweisung meines Arztes, wissen Sie.«
»Sehr wohl, Ma’am«, näselte mein Onkel und setzte dabei einen übertriebenen englischen Akzent auf. Er verließ das Museum.
Imogen – obwohl ich ihren Namen noch nicht kannte – durchquerte zielstrebig die Räume A und B und begann sich die Bilder im Raum C anzusehen. Ich stand vor der japanischen Landschaft. Imogen ging zum Jan van Kessel hinüber. Dann drehte sie sich um und sagte: »Sie sind neu hier, nicht?«
»Ja, Ma’am.«
Ich hatte sie unverfroren angestarrt, muß ich gestehen. Sie wandte sich von mir ab. »Sie stehen ein bißchen zu dicht an der holländischen Landschaft da«, behauptete ich. Das war mir einfach so entschlüpft. Es stimmte gar nicht.
Imogen trat noch näher an den van Kessel heran. »Ich habe dieses Museum schon öfter besucht«, sagte sie, ohne ihr Gesicht von dem Gemälde abzuwenden. »Ich weiß, wie ich mich zu benehmen habe. Ich sehe mir gern Bilder an und bin eine persönliche Bekannte Ihrer Kunsthistorikerin Miss Delbo. Professor Delbo. Sie hat mir sogar selbst empfohlen, ich solle mir diese Ausstellung ansehen.« Jetzt kam sie direkt auf mich zu. »Da Sie neu hier sind, werde ich Ihrem Kurator nicht berichten, wie ungehobelt Sie sich benehmen. Außerdem …« Sie besah sich mein Namensschild. »DeFoe Russet. Bilderwächter Russet. Was meinten Sie mit ›zu nah‹? Vielleicht zu nah für Ihren Geschmack. Nicht für meinen. Dabei war ich nur in Gedanken versunken. Übrigens die beste Haltung allem gegenüber, Gemälde eingeschlossen, finden Sie nicht auch?«
Es hatte mir die Sprache verschlagen, mir fiel wieder ein, was Mr. Connaught gerade vor ein paar Stunden gesagt hatte. »Streiten ist unter der Würde eines Museumsaufsehers.« Das sagte ich allerdings nicht laut.
»Ich hatte Kopfschmerzen«, fuhr Imogen fort. »Sie waren schon weg, aber jetzt sind sie wieder da. Mann, oh Mann, ein neuer Aufseher und schleudert mir gleich solche Anschuldigungen ins Gesicht – ›zu nah‹!«
»Das ist mein erster Tag hier.«
»Wie lange stehen Sie schon in diesem Raum?«
»Drei Stunden, ungefähr.«
»Sehen Sie auf diesem niederländischen Bild den Rechen, der da an der Scheune lehnt? So einen Rechen könnte ich gut gebrauchen. Ich bekomme von den Bildern in diesem Museum oft sehr praktische Anregungen, unabhängig davon, daß ich sie einfach gern betrachte. Ich werde eine kleine Skizze von diesem Rechen machen und sehen, ob meine Vorgesetzten so ein Gerät für mich anschaffen können. Damit könnte ich gut hinter Sträuchern, zwischen Gräbern und so weiter rechen. Ich arbeite auf dem jüdischen Friedhof.«
»Das hat man mir gesagt.«
»Was?«
»Wo Sie arbeiten.«
»Wer hat Ihnen das gesagt?«
»Mein Onkel. Er ist der andere Aufseher hier. Ihm hat es Miss Delbo gesagt. Die habe ich noch nicht kennengelernt.«
»Ich heiße Imogen Linny.«
»Ein hübscher Name.«
»Ich bin nicht zu nah an das Bild herangetreten, Mr. Russet.«
»Nein, das sind Sie tatsächlich nicht. Ich wollte probehalber eine Verwarnung aussprechen, doch sie war vollkommen fehl am Platz. Ich bitte um Entschuldigung.«
»Würde es Ihnen etwas ausmachen, in einem anderen Raum Aufsicht zu halten, bis ich mir den Rest dieser Landschaftsbilder angesehen habe?« Sie spähte durch den Raum B in den Raum A hinüber. »Außerdem sieht es so aus, als wäre Ihr Onkel verschwunden. Sie sind jetzt der alleinige Aufseher.«
Aus einem unerklärlichen Grund willigte ich sofort ein: »In Ordnung.« Ich, ein Museumsaufseher, folgte der Bitte einer Besucherin, ich solle doch den Raum verlassen!
»Am Bücherstand wäre weit genug weg.«
Und dort stellte ich mich auch auf, neben den Postkarten. Ab und zu blickte ich zu Imogen hinüber. Sie blieb vor jeder Landschaft stehen, vor den holländischen und deutschen am längsten. Andere Bilder betrachtete sie nur wenige Sekunden, schien sie rundweg abzulehnen, schüttelte sogar den Kopf. Ich kannte sie überhaupt nicht. Und doch fragte ich mich bereits, was sie wohl dachte. Über die Bilder. Über mich. Als sie vor der Landschaft aus Japan stand, blickte sie verstohlen zu mir herüber, dann wieder zum Bild. Sie zog ein Taschentuch heraus, beugte sich vor und wischte etwas von der linken unteren Ecke der Leinwand weg. Eine Geste, die dem Museumskodex zuwiderlief, aber eindeutig harmlos war. Anstatt Imogen zurechtzuweisen, sagte ich zu Mrs. Jonatis: »Ich brauche einen Schluck Wasser.«
»Sie wissen ja, wo der Trinkbrunnen ist, junger Mann«, erwiderte sie. »Niemand wird Sie davon abhalten.«
Der Trinkbrunnen stand neben dem Bücherstand. Nachdem ich meinen Durst gelöscht hatte, ging ich in den Raum A. Imogen hatte ihren Rundgang durch die Landschaftsbilder beendet. »Als Aufsicht taugen Sie vielleicht nicht sehr viel«, sagte sie lächelnd, »aber wissen Sie was, Mr. Russet? Wenigstens gelangen Sie hier auf eine höhere Ebene.«
»Wie das?«
»Einfach dadurch, daß Sie den ganzen Tag lang in diesem Raum stehen. Sie passen auf erhabene Dinge auf. Gemälde. Zeichnungen. Ob Sie jedes einzelne davon mögen oder nicht – es sind erhabene Dinge. Das hebt Sie empor. So sehe ich das.«
»Ich fasse das als Kompliment auf.«
»Vielleicht betrachten Sie Ihre Arbeit von nun als eine Arbeit, die Sie adelt.«
»Ich werde diesem Gedanken sicher nachgehen.«
»Ich habe mir übrigens über jedes einzelne dieser Kunstwerke eine Meinung gebildet. Jetzt muß ich wieder an meine Arbeit. Schließlich verdiene ich mir meine Brötchen selbst. Ich arbeite, wie ich bereits erwähnt habe, auf dem jüdischen Friedhof.«
»In der Windsor Street.«
»Der einzige jüdische Friedhof in Halifax.«
»Richtig.«
Sie schloß einen Moment lang die Augen, seufzte und öffnete sie wieder. »Wenn Sie vielleicht einmal nach Ihrem Dienst beim Friedhof vorbeischauen wollen? Ich bin gegen halb sechs fertig. Kommen Sie mit einer Meinung, Mr. Russet. Über dieses Bild da drüben …« Sie deutete auf den van Kessel. »Dann vergleichen wir, ob wir übereinstimmen. Wenn ja, dürfen Sie mich zum Abendessen einladen.«
»Ich sollte keine Privatgespräche dieser Art führen. Im Museum.«
»Nun, dann beenden Sie das Gespräch doch.«
»Und überhaupt – warum glauben Sie, daß ich Sie wiedersehen möchte?«
»Sollte ich mich irren, werde ich es daran merken, daß Sie nicht auftauchen.«
»Vielleicht möchten Sie sich noch die flämischen Gemälde im Raum A ansehen?«
»Also, die gefallen mir überhaupt nicht. Ich kenne sie schon, ich war letzte Woche hier. Dann auf Wiedersehen, Mr. Russet.«
Nachdem Imogen das Museum verlassen hatte, zog es mich plötzlich ganz stark zu den Postkarten. Ich hatte den dringenden Wunsch, eine Postkarte zu verschicken. Ich ging zu dem Gestell, um sie durchzusehen. Während ich es drehte, wurde mir bewußt, daß ich keinen Freund, Bekannten oder Verwandten besaß, dem ich eine Postkarte hätte schicken können. »Schöne Auswahl, nicht?« sagte Mrs. Jonatis. »Gut, wenn Sie sich damit vertraut machen.« Dann flüsterte sie weiter: »Die junge Frau, mit der Sie sich unterhalten haben. So eine wunderhübsche junge Frau! Also, die … die sollte wirklich einmal jemand malen, im Gegensatz zu manch anderen, die ich schon an diesen Wänden gesehen habe.«
Das Essen, zu dem mich mein Onkel an jenem Abend eingeladen hatte, fing gut gelaunt an. Wir verließen das Museum um 17.15 Uhr und gingen in die Robie Street zum Halloran’s, einem kleinen Restaurant mit familiärer Atmosphäre, wo man auch draußen sitzen konnte. Das Halloran’s hatte sich auf Steaks spezialisiert und war nicht gerade billig, aber schließlich hatten wir etwas zu feiern. Für September war die Nacht lau, ich erinnere mich, daß auf dem Hinweg eine Brise vom Hafen den Geruch von Salzlake herüberwehte. Wir setzten uns an einen Tisch auf dem Trottoir. »Vergiß nicht, ich zahle«, sagte mein Onkel. »Ich lade dich ein. Eine neue Stelle ist ein großes Ereignis im Leben. Auch, daß ich die Rechnung übernehme!« Er stupste mich am Kinn, wie er es seit meiner Kindheit zu tun pflegte. Ein Kellner kam zu uns an den Tisch und wir bestellten gleich.
»Nett von dir, daß du mich einlädst«, sagte ich. »Ich bin pleite, aber ich könnte ein ganzes Pferd vertilgen.«
»Dann hätten wir ins Vizenor’s gehen sollen. Man munkelt, wenn sich irgendwo im Hafenviertel ein Pferd das Bein bricht, landet es in der Küche vom Vizenor’s.«
Unsere Steaks wurden mit einer gebackenen Kartoffel serviert. Wir hatten dazu noch eine Portion gebratene Zwiebeln bestellt. Der Kellner hielt eine Flasche Rotwein vor meinen Onkel hin, der sich das Etikett besah und zustimmend nickte. Der Kellner entkorkte die Flasche und goß meinem Onkel einen Schluck ein, mein Onkel kostete und kommentierte: »Magnifique!« Das quittierte der Kellner mit einem »Sehr wohl«, und füllte unsere beiden Gläser, dann zog er sich zurück. Er lümmelte sich neben der Eingangstür an die Wand, gegen die er einen Fuß stützte; in seinem Mundwinkel klemmte eine noch nicht angezündete Zigarette. »Auf deinen neuen Job!« sagte mein Onkel und hielt mir sein Glas entgegen. Wir stießen an. »Auf daß er in deinem Leben einen Schritt nach vorn bedeute!«
»Das hoffe ich auch.«
»Wir sollten öfters hier essen, DeFoe. Die Kellner kennen mich. Es ist ihnen egal, wie schlecht meine französische Aussprache ist, und selbst wenn es ihnen nicht egal wäre, würden sie es nicht zeigen.«
Beim Essen redeten wir nicht viel. Wir leerten die Flasche Wein, beobachteten die Leute auf der Straße. Schließlich sagte mein Onkel: »Ich kann dir nur raten, dir eine zweite Aufseheruniform zuzulegen. Alles von Kopf bis Fuß, meine ich. Außer den Schuhen. Du brauchst nur ein Paar Schuhe, natürlich bequeme Schuhe, in denen du den ganzen Tag stehen kannst. Wie du weißt, habe ich zwei Uniformen.«
Ich wischte ein paar Brotkrümel von meiner Hose. »Was schlägst du vor, wo soll ich hingehen?« fragte ich. »Wieder zu Mayhew’s, wo ich diesen Anzug hier gekauft habe?«
»Klar. Klar. Aber die Verarbeitung ist schlampig. Probier doch für deinen zweiten Anzug den Schneider drüben in der McKeldon Road aus. Ein Jude, heißt Myerhoff. Spricht mit einem starken Akzent, da kann ein Wort noch so kurz sein. Kommt aus Polen, glaube ich. Oder irgendwo aus der Nähe von Polen. Ich weiß es nicht. Unser ehrenwerter Kurator Mr. Connaught hat mir vor Jahren erzählt, Myerhoff sei der beste Schneider im Hafenviertel. Er hat mir sogar einen Zeitschriftenartikel mitgebracht, mit der Überschrift ›Der beste Schneider im Hafenviertel‹. Ein ganzer Artikel über Myerhoff.«
»Bin schon überzeugt. Ich werde mir gleich, wenn ich meinen Lohn bekomme, einen zweiten Anzug machen lassen.«
»Brauchst du Geld, um dich bis dahin über Wasser zu halten?«
»Nein, aber vielen Dank.«
»Zahl aber erst deine Miete, bevor du dir den Anzug kaufst.«
Mein Onkel bestellte eine zweite Flasche Wein. »Also, Neffe«, sagte er. »Da wir gerade über dies und jenes plaudern: Mal ehrlich, was hältst du von Edward Connaught’s ›Verhaltensregeln‹?«
»Ich werde versuchen, sie mir zu merken.«
»Sicher eine gute Idee.«
»Auf das meiste käme jeder vernünftige Mensch von selbst.«
»Wart’s ab, du stehst ja erst am Anfang deiner Laufbahn. Wie sich die Leute im Museum benehmen, kann einen ganz schön überraschen.«
»Du hast mich ja selber schon vorgewarnt und auf ein paar Dinge hingewiesen, weißt du noch? Wie ist dein Steak?«
»Ausgezeichnet. Ich war erstaunt, daß du deins blutig bestellt hast. Das hat mich wirklich überrascht, DeFoe, nach hundert durchgebratenen. Vergiß übrigens nicht, daß ich es war, der dich zu deinem allerersten Steak eingeladen hat, da warst du neun, fast genau ein Jahr nach dem Tod deiner Eltern.«
»Ich hab’s eigentlich nur aus Versehen blutig bestellt. Aber wie sich herausgestellt hat, war das kein Fehler. Es schmeckt mir wirklich.«
»Gut.«
»Was hat Mr. Connaught eigentlich mit dem ›Cupido‹ gemeint? Er hat etwas von einem Cupido gemurmelt. Von einem ›Vorfall‹.«
»Ach, tatsächlich?«
Mein Onkel atmete mit einem tiefen Seufzer ein, dann ließ er die Luft in kürzeren Seufzern wieder ausströmen. Er sah höchst verärgert aus. Er schob sich ein Stück Steak in den Mund und kaute bedächtig darauf herum. Umständlich schenkte er uns beiden Wein nach, nahm sein Glas in die Hand und lehnte sich zurück. Er zwang sich, ganz ruhig zu sprechen: »Schau mal, DeFoe, ich weiß, daß du dir wegen deiner neuen Stelle Gedanken machst. Aber glaub mir, es wird prima laufen. Ich hatte heute so viel Vertrauen zu dir. An deinem ersten Tag so viel Vertrauen, daß ich in die Putzkammer gehen und Radio hören konnte, ohne mich im geringsten zu beunruhigen. Ich bin stolz auf dich. Du hast ein sehr sicheres Auftreten. Das meine ich wirklich so.«
»Ich hätte nicht gedacht, daß man mir meine Sorgen ansehen könnte.«
»Kann man, kann man.«
»Nochmal danke übrigens, daß du mir den Job beschafft hast. Ich hatte ja keine erwähnenswerten Qualifikationen.«
»Na, ist das nicht lachhaft? Edgar Connaught muß ganz schön in Bedrängnis gewesen sein, daß er eine Empfehlung von mir als gute Referenz betrachtet hat.«
»Du warst der einzige, der mich überhaupt empfehlen konnte.«
»Ich hab nur gesagt, daß du schnell kapieren würdest.«
»Mehr war nicht nötig?«
»Zum Vorstellungsgespräch hat’s gereicht. Ich wußte ja, daß Connaught die Stelle in Halifax groß ausschreiben würde. Da mußte ich schnell handeln.«
»Ich schulde dir viel.«
»Ich hab ihm noch gesagt, du könntest nichts dafür, daß wir verwandt sind, Onkel und Neffe. Und ihm versichert, wir seien so verschieden wie Tag und Nacht.«
»Was hat er darauf gesagt?«
»Er wirkte erleichtert.«
»Du hast mir auch den Job bei der Gepäckaufbewahrung am Bahnhof besorgt.«
»Wem sagst du das.«
»Sieht ganz so aus, als würde ich in Sachen Arbeit, wenigstens bis zu meinem fünfundzwanzigsten Lebensjahr, in deine Fußstapfen treten.«
»Auch wenn die Schritte noch so klein sind.«
Ich nippte an meinem Wein, dann trank ich einen Schluck Eiswasser. »Was hat das mit dem ›Cupido‹ auf sich?«
Mein Onkel sah jetzt aus, als würde er vor Gereiztheit gleich platzen. Er stand auf und winkte unserem Kellner, einem jungen, schlaksigen Mann, der dringend einen neuen Haarschnitt benötigt hätte, wie ich fand. Seinem Französisch nach, das er mit den anderen Kellnern sprach, konnte er gut aus Paris stammen. Jedenfalls sprach er kein kanadisches Französisch, soviel erkannte ich. Das Halloran’s war nicht einmal ein französisches Restaurant. Die konnten von Glück sagen, wenn sie echte französische Kellner bekamen, womöglich noch aus Paris, das heißt, falls sie wirklich von dort stammten. Als sich mein Onkel die volle Aufmerksamkeit unseres Kellners gesichert hatte, deutete er auf einen gerade abgedeckten Tisch. Er wartete, bis der Kellner nickte, ging dann hinüber und setzte sich an den leeren Tisch. Ich sah den Kellner an, der mit den Achseln zuckte, als wollte er sagen: »Was soll man da schon machen?« Ich nahm meinem Onkel gegenüber Platz.
»Onkel Edward, bestellst du dir eine Nachspeise?«
Unser Kellner räumte die Teller von unserem alten Tisch ab, brachte aber die Weinflasche und die Weingläser zu uns herüber. Ich bestellte Kaffee.
»DeFoe«, sagte mein Onkel und legte sich die Hand aufs Herz. »Ich bitte dich um Entschuldigung. Aus tiefstem Herzen. Du hast gerade mal die ersten sieben Stunden an deinem neuen Arbeitsplatz hinter dir. Dazu stachelt dein neuer Chef deine Neugier an. ›Cupido‹. Er hätte nicht unbedingt eine solch unangenehme Erinnerung auszugraben brauchen. Ich bin dein Onkel. Ich habe dich seit deinem achten Lebensjahr großgezogen. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Und dann versucht Mr. E.S. Connaught hintenrum, auf seine verschlagene Tour, würde ich gern hinzufügen, mich in deinen Augen herabzusetzen. Zu degradieren. Du hast dich sicher meinetwegen geschämt, was?«
»Vergiß, daß ich dich je danach gefragt habe.«
Mein Onkel saß eine Weile schweigend da, halb grübelnd, aber auch mit einem wachen Auge auf die Passanten. Einigen Leuten, die vorbeigingen, starrte er wütend ins Gesicht. Er konnte völlig Fremden mit einem drohenden Blick auflauern; ich glaube, er arbeitete an der Perfektionierung dieses Blicks, der einen mit Vorwürfen zu überschütten schien. Der Kellner brachte uns beiden eine Tasse Kaffee. Mein Onkel trank über die Hälfte des brühheißen Getränks in einem Zug. Dann überfiel ihn offensichtlich eine aufgeregte Erinnerung. Er setzte sich kerzengerade hin, löste den Knoten seiner Krawatte und zog sie sich vom Kragen. Dann knüllte er sie zusammen und stopfte sie in seine Hosentasche. Jetzt war er sprechbereit. »Einmal«, begann er, »hatten wir dieses Bild als Leihgabe. Du hast es mal gesehen, als du mich zum Mittagessen abgeholt hast. Es hieß Die Versuchung des Hl. Hilarion.«
»Ich erinnere mich sogar an den Namen des Malers, weil du mir gesagt hast, ich hätte ihn falsch ausgesprochen. Dominique Papety.«
»Papety, genau!«
»Es hing in einer Ausstellung über Heilige. Heiligenbilder aus der ganzen Welt, aus fünf oder sechs Ländern.«
Mein Onkel geriet dermaßen in Erregung, daß er sich auf einen anderen Stuhl setzte. »Und erinnerst du dich an den armen heiligen Hilarion selber?« fragte er. »Er stand da, an ein paar Felsen zurückgelehnt. Solche Felsbrocken. Streckte abwehrend die Arme aus …« Mein Onkel führte es mir vor.»… so. Er hatte eine braune Kutte an, üppiger Faltenwurf. Und eine Frau führte ihn in Versuchung. Sie stand direkt vor dem heiligen Hilarion und wollte ihn verführen. Sie hatte ein Nachthemd an, durch das man durchsehen konnte.«
»Eher ein seidenes Unterkleid.«
Mein Onkel zog eine Grimasse. »Aha, ich verstehe.« Seine Miene verfinsterte sich und blieb eine ganze Weile so. Er kippte seinen restlichen Wein hinunter. Der Kellner kam und goß uns Kaffee nach. Mein Onkel hob seine Tasse langsam an die Lippen. Er kaute einen Gedanken durch und versuchte sich zu beherrschen, damit er nicht explodierte. Die Anzeichen kannte ich nur zu gut. Wie er mit den Kiefern malmte. Wie er meinem Blick auswich. Und wie er seine Bewegungen und Gesten fast bis zur Reglosigkeit verlangsamte. Wenn er in einer gewissen Stimmung war, konnte es eine ganze Minute dauern, bis er endlich einen Schluck Kaffee getrunken hatte, obwohl er die Tasse schon an die Lippen hielt. Ein Zeichen, daß er wahrhaft gereizt war, wie jetzt. Widerspruch konnte er nicht ertragen, am wenigsten von mir.
»Bist du jetzt unter die Kunsthistoriker gegangen oder was?« fragte er schließlich. »Egal, wie du die Klamotte benamst, jedenfalls war sie durchsichtig. Was macht dich überhaupt zu einer solchen Autorität in Sachen weiblicher Dessous? Seidenes Unterkleid! Wie hieß sie doch gleich, diese Dame, mit der du früher befreundet warst? Ach ja, Cary. Gehörte ein seidenes Unterkleid zu ihrer nächtlichen Garderobe?« Er hatte sich in eine maßlose Erregung hineingesteigert und wußte das auch. Jetzt versuchte er sich zurückzunehmen und einen anderen Ton anzuschlagen. Er kämmte sich die Haare mit den Fingern aus der Stirn. »Was diese Frau betrifft, die den heiligen Hilarion verführen wollte«, setzte er erneut an. »Sie hatte ihr durchsichtiges Gewand nur umgeknotet, unterhalb der Taille. Oben hatte sie gar nichts an. Sie war oben ohne, DeFoe. Mit der einen Hand strich sie sich die Haare zurück, die andere hielt sie vor dem Mund, als ob sie gähnen würde – ein ausgiebiges Gähnen, wie eine Katze, die sich streckt. Und ihre Titten zielten direkt auf den heiligen Hilarion.«
An diesem Punkt ging unser Kellner, der in unserer Nähe gestanden hatte, ins Lokal hinein und postierte sich dicht hinter der Tür.
»Zwischen den beiden stand ein kleiner Tisch mit Obst und Wein«, fuhr mein Onkel fort. Seine Erregung erreichte einen neuen Höhepunkt. »Da draußen in der Wildnis, ein Tisch. Ich erinnere mich noch genau, wie mir dazu der Gedanke kam: Schleppt doch dieser heilige Hilarion überall, wo er hingeht, einen Tisch mit sich rum! Egal, die beiden waren jedenfalls allein, kein Mensch weit und breit. Und der heilige Hilarion konnte seiner Versucherin nicht aus dem Weg gehen. Hätte man ihm Worte in den Mund legen können, so hätte es wohl: ›Nein! Nein! Nein!‹ sein müssen.«
Ich habe einmal ein chinesisches Sprichwort gelesen, vielleicht in einem Glückskeks, in dem Chinarestaurant in der Gasse, die von der Asphodel Street abzweigt. »Öffne genug Türen«, hieß es, »dann wird aus irgendeiner ein Tiger herausspringen.« Wenn man sich, sagen wir, länger als eine halbe Stunde mit meinem Onkel unterhielt, konnte jedes beliebige Thema zu einer solchen Tür werden.
An unserem zweiten Tisch, den wir an diesem Abend im Halloran’s belegten, trank ich noch einen Schluck Kaffee. Ich wog meine Worte einen Augenblick ab. Dann sprang ich ins kalte Wasser.
»Miss Delbo hatte so einen Gedanken zum heiligen Hilarion«, sagte ich. »Ich hab’s in dem Katalog gelesen, als ich vor meinem Vorstellungsgespräch alles über die Geschichte des Glace-Museums lernte. Nicht, daß davon etwas zur Sprache gekommen wäre. Jedenfalls schrieb Miss Delbo, es wäre, als würde Gott zusehen. Ich zitiere hier nicht dem Wortlaut nach, sondern fasse nur ihre Ideen zusammen. Gott würde die Heiligen scharf im Augen behalten, schärfer als sonst jemanden. Gott beurteilte den heiligen Hilarion. Dehalb mußte sich der heilige Hilarion verweigern. Sonst wäre er kein Heiliger geblieben.«
»Oje, oje«, stöhnte mein Onkel. Er legte seine Hände flach auf den Tisch und schien seine Fingernägel zu inspizieren, war fast hypnotisiert von ihnen. Denn ballte er die Hände zu Fäusten und öffnete sie wieder. »Ich höre Miss Helen Delbo jetzt seit sechs Jahren bei ihren Museumsführungen reden«, sagte mein Onkel mit einer um eine Oktave heruntergeschraubten Stimme, die mir durch und durch ging. Er nippte an seinem Kaffee, seltsam kurzatmig, als müsse er verschnaufen. »Der heilige Hilarion, lieber Neffe, war ne Memme! Oder er hat den Schwanz nicht hochgekriegt …« – Kaffee sprühte aus seinem Mund – »… es gibt keinen gefälligeren Ausdruck für so was. Und ich werd dir genau wiedergeben, was ich von einem kleinen Mädchen gehört habe, keiner intellektuellen Kunsthistorikerin von der Dalhousie-Universität … Eines Tages also, als Die Versuchung des Hl. Hilarion in Raum C hing, kam ein kleines Mädchen daher, ein Genie, nicht älter als sieben oder höchstens acht. Sie guckt sich die Zwangslage des Heiligen genau an, starrt ihn an, starrt seine Versucherin an, nimmt alles in sich auf. Dann zupft sie ihre Mutter am Ärmel. Sie war richtig außer sich. Sie sagt: »Mama, was fehlt dem Mann? Hat der Grippe oder was?«
»Wie laut hat sie das gesagt?«
»Laut genug, daß sich die Köpfe drehten. Ich meine, dieses kleine Mädchen war weitaus zu lebhaft für die Museumsetikette, DeFoe. Dazu kam, daß es auch noch stimmte: Der heilige Hilarion war leichenblaß. Fahle Haut, eingefallene Augen, ach, das Leben war für ihn in diesem Moment einfach zuviel. Und er ließ diese Frau schlichtweg abblitzen. Er wählte aus freien Stücken die Enthaltsamkeit.«
»Das ist eben ein religiöses Gemälde, Onkel Edward. Komm schon, das weißt du doch. Du hast Stunden mit religiösen Gemälden verbracht. Das Leben eines Heiligen ist schwierig. Darüber gibt es Bücher. Mir ist eins am Bücherstand im Museum aufgefallen, ein Buch über religiöse Malerei. Dreihundert Seiten oder so. Du mußt doch zugeben, bei so vielen Seiten muß es um Komplizierteres gehen als darum, ob der heilige Hilarion die Grippe hatte oder nicht.«
»Die Grippe oder nicht …« Jetzt dämpfte mein Onkel wenigstens die Stimme, nahm aber nicht die geringste Notiz von den anderen Gästen. Das Lokal war voll, die Stimmung ausgelassen. »Grippe oder nicht, ich habe die Weiber gef …«
Ich fuhr zurück und hielt mir die Ohren zu. »Bitte …«
»Schon gut, Herr im Himmel! Mit ihnen geschlafen dann eben«, sagte er in einem spöttisch affektierten Flüsterton. »Mit Weibern geschlafen, als ich todkrank mit Grippe im Bett lag. Matilda, die im Lord Nelson gearbeitet hat. Du erinnerst dich doch an Matilda? Also, sie und ich, wir haben fünf Nächte hintereinander miteinander geschlafen, Montag bis Freitag, und wir hatten beide die Grippe. DeFoe – also, beruhig dich wieder, ja?«
»Ich mich beruhigen?«
»Richtig unangenehm, wie du neben der Rolle stehst, mit deinem neuen Job und allem. Ich wollte lediglich darauf hinaus, daß den heiligen Hilarion seine Vernunft ganz schön im Stich gelassen hat.«
Der Kellner brachte uns auf dem Dessertwagen eine Auswahl von fünf Nachspeisen, und mein Onkel und ich deuteten beide gleichzeitig auf den gestürzten Ananaskuchen. »Ich fürchte, davon haben wir nur noch ein Stück«, sagte der Kellner.
»Warum haben Sie’s uns dann beiden angeboten?« fragte mein Onkel.
Ich ließ eine Woche verstreichen, bis ich Imogen besuchen ging. Obwohl ich gestehen muß, daß ich in dieser Zeit jeden Tag an sie dachte.
Als ich am 26. September das Museum verlassen wollte, fragte mein Onkel: »Hast du Lust, ins Halloran’s zu gehen? Oder zum Bahnhof? Unser alter Chef, Billy Tecosky – William –, beklagt sich, daß du gar nicht mehr vorbeischaust. Er würde dich gern sehen. Wir drei könnten zusammen essen gehen.«
»Heute abend bin ich schon anderweitig beschäftigt.« Mein Onkel benutzte diesen Ausdruck immer, wenn er auf sein momentanes Tun und Treiben nicht genauer eingehen wollte.
»Was könnte das nur sein, was könnte das nur sein?« sagte er. »Geht mich wohl nix an, was?«
»Es ist noch nichts. Nichts, was der Rede wert wäre.«
»Na, dann jede Minute viel Glück bei dem, was nicht der Rede wert ist. Falls es überhaupt Glück ist, was du brauchst.«
»Bei dieser jungen Frau, Onkel Edward, brauchte ich vielleicht mehr als nur Glück.«
»Naja, Neffe, der Abend wird entweder gut oder schlecht laufen. In Seligkeit oder im Desaster enden. Oft muß ich feststellen, daß es wenig dazwischen gibt. Oder ich bin nicht scharf auf das Dazwischen.«
»Ich würde einfach gern schön mit ihr essen gehen. Falls wir gehen, dann ins Halloran’s, hab ich mir gedacht.«
»Okay, ich hab kapiert. Dann werde ich auf jeden Fall nicht im Halloran’s essen. Darauf kannst du dich verlassen. Du wirst nicht rumgucken und plötzlich deinen alten Onkel im Visier haben.«
»Na, dann will ich dich einweihen, Onkel Edward. Es ist die junge Frau, die letzte Woche hier war. Du hast gesagt, du hättest sie schon vorher im Museum gesehen. Sie arbeitet auf dem jüdischen Friedhof und heißt übrigens Imogen Linny. Ich schau jetzt bei ihr vorbei.«
»Die sieht klasse aus. Stell dir mal vor, wenn sie schon in diesen Arbeitsklamotten so gut aussieht … Vielleicht hab ich mich doch getäuscht, daß sie nicht von anderen Leuten belästigt werden will.«
»Ich habe nicht vor, sie zu belästigen. Ich würde mich gern beim Essen mit ihr unterhalten, weiter nichts.«
Ich ging quer durch die Stadt bis zur Windsor Street, dann ein paar Straßen weiter bis zum Friedhof. Ich war schon oft daran vorbeigelaufen, hatte aber nie jemanden dort arbeiten sehen. Die Grabsteine drängten sich dicht an dicht, auf knapp einem halben Hektar. Der Friedhof war mit einem Eisengitter eingezäunt, beim Eingang stand ein großer Geräteschuppen. Es war schon fast dunkel, als ich dort ankam. Imogen war nirgends zu sehen. Ich trat durch das Tor. Dann hörte ich: »Nanu! Hallo, Mr. Russet.« Das war Imogens Stimme, doch sie klang dumpfer als im Museum. »Im Schuppen.« Die Tür stand weit offen. Ich ging hinüber. »Hoffentlich habe ich Sie nicht erschreckt«, sagte Imogen im Schuppen. »Ich bin fast fertig. Ich setze mich nämlich immer hier herein, um meine Kopfschmerzen zu überwinden, wissen Sie. Noch zwei Minuten oder so, dann hab ich’s geschafft und kann rauskommen, okay?«
»Lassen Sie sich so viel Zeit, wie Sie wollen.«
»Spazieren Sie doch ein bißchen herum. Wir haben hier einige alte Grabsteine.«
»Vielleicht ein anderes Mal.«
Ich stand beim Tor, bis Imogen auftauchte. Sie kam zu mir herüber. Einem Passanten wären wir vielleicht als ungleiches Paar aufgefallen, ich in meiner Museumsuniform, Imogen in ihrem Gärtnerkittel, mit Erde an den Knien und dem Pflanzenheber, der aus ihrer Gesäßtasche herausschaute. »Folgen Sie mir«, sagte sie. »Ich möchte Ihnen etwas zeigen.« Ich folgte ihr auf einem Gang zwischen den Grabsteinen. Wir hielten vor einem Stein mit der Inschrift: Agi Delbo. 1859–1930. »Das ist Miss Delbos Mutter«, sagte Imogen. »Und nebenan, hier …« Sie faßte an den Stein gleich zu ihrer Linken. »… das ist meine Mutter. Mein Name, Linny, ist nicht jüdisch. Mein Vater war kein Jude. Aber meine Mutter stammte aus einer jüdischen Familie, aus Holland. Einer der Gründe, warum ich ins Museum gegangen bin. Um mir die beiden niederländischen Landschaften anzuschauen, die ich Miss Delbos Meinung nach sehen sollte. Sie sagte, manche Menschen besäßen tief im Inneren Erinnerungen an Orte, wo sie nie gewesen sind, aber wo ihre Mutter lebte. Erinnerungen, die sich im Mutterleib auf einen übertragen, sagte sie. Aber beim Betrachten der niederländischen Landschaften erinnerte ich mich an gar nichts, was mit Holland zu tun hat. Ich zermarterte mir das Hirn, aber alles, was ich dabei hervorkramte, war ein Paar Touristen-Holzpantoffeln, das meine Mutter aus Amsterdam mitgebracht hatte, als ich vielleicht drei oder vier war.«
»Wo ist denn dann Ihr Vater begraben?« Ich hatte das Gefühl, meine Frage wäre etwas intim, aber dennoch gerechtfertigt, nachdem mir Imogen ihre Mutter auf diese Weise vorgestellt hatte.
»Ach, der liegt auf der anderen Seite der Stadt«, erklärte sie nüchtern, als wäre es ganz normal, daß ihre Eltern auf verschiedenen Friedhöfen lagen. »Als Kind bekam ich einmal mit, wie sie diese Entscheidung trafen. Eines Abends nach dem Essen. Ich war im Kinderzimmer. Wir wohnten in der Kastan Street. Ich war damals zehn oder elf, schätze ich. Ich glaube nicht, daß sie in ihrer Ehe Probleme damit hatten, daß sie unterschiedlichen Religionen angehörten. Meine Mutter ging in die Synagoge, mein Vater in die Kirche. Die anglikanische. Ich begleitete meine Mutter, bis ich etwa sechzehn war, dann ging ich nicht mehr mit. Sie starben, als ich etwa zwanzig war.«
»Was für mich am schlimmsten war, als meine starben … ich war damals erst acht. Es war bei diesem Zeppelinunglück im Fleming Park.«
»Daran erinnere ich mich, mein Gott! Das war ja eine Katastrophe!«
»Viele Jahre später kam mir der Gedanke, egal, wie alt man ist, wenn die Eltern sterben, ist man verwaist. Die meisten Leute denken bei ›Waise‹ an ein Kind. Aber man könnte sechzig sein und sich als Waise fühlen, wenn es plötzlich passiert. Kein sehr origineller Gedanke, ich weiß. Aber als ich zum ersten Mal darüber nachdachte, empfand ich diese Erkenntnis trotzdem als einen ziemlichen Schock.«
»So sieht’s also aus mit uns beiden. Im zweiten Gespräch unseres Lebens kommen wir darauf, daß wir beide Waisen sind. Eine Waise plus eine Waise ergibt… was?«
»Sie haben recht. Ein ziemlich trübsinniges Thema. Tut mir leid. Trübsinnige Art, einander kennenzulernen.«
»Ach, ich weiß nicht.«
»Naja … trotzdem.«
»Setzen Sie sich doch. Sie dürfen sich ruhig an die Grabsteine lehnen. Das mache ich auch immer.«
Ich lehnte mich an den Grabstein von Miss Delbos Mutter, Imogen lehnte sich den Grabstein ihrer Mutter. Wir starrten vor uns hin, dann sahen wir einander an und brachen in Gelächter aus. Keiner von uns sagte, warum.
»Dieses Bild von Jan van Kessel …« sagte Imogen.
»Sie haben eine sehr gute holländische Aussprache.«
Sie nahm ihre Mütze ab und hielt sie in den Händen. Dann zog sie den Pflanzenheber aus der Tasche, hängte die Mütze darauf und wirbelte sie herum. Nach einer Weile legte sie beides zu Boden. »Also, was meinen Sie zu dem Gemälde?«
»An meinem ersten Arbeitstag … nachdem Sie gegangen waren. Da habe ich es mir lange angesehen. Ich sagte zu mir, mein ganzes Wissen über Bilder stützt sich auf die Ansichten meines Onkels. Er ist der andere Museumsaufseher. Er hat mit Bildern gelebt, ich noch kaum. Beim Abendessen an jenem Tag haben wir uns sogar über ein Bild gestritten, was mich überrascht hat. Also, was halte ich von der Jan-van-Kessel-Landschaft? Daß ich, wenn ich die nächsten zwei Monate daneben stehe, vielleicht die richtigen Worte dafür finden werde, wie sehr ich sie bewundere. Aber ich bin kein Kunsthistoriker. Ich bin nur ein Museumsaufseher.«
»So weit, so gut.«
»Und was meinen Sie dazu?«
»Naja, es ist eine friedliche Szene. Die Schwäne. Der Fluß. Die Hügel. Als ich das zu Miss Delbo sagte, antwortete sie: ›Der Fluß birgt schreckliche Geheimnisse.‹«
»Wenn es Geheimnisse sind, woher weiß sie dann, daß sie schrecklich sind?«
»Genau das habe ich sie auch gefragt. Ganz genau dasselbe. Und sie sagte: ›Ein Fluß hat noch nie jemanden vor dem Ertrinken gerettet, nicht?‹ Darüber mußte ich lange nachdenken. Ich bin eine halbe Nacht im Bett gesessen und habe darüber nachgedacht. Ich habe immer noch nicht den ganzen Sinn ihrer Worte erfaßt. Ich weiß nur, daß sie mich beunruhigt haben. Diese hochintelligente Miss Delbo sieht einen holländischen Fluß und denkt dabei ans Ertrinken.«
»Egal, was einem dabei einfällt – die Gedanken kommen eben. Man kann nichts dafür.«
»Miss Delbo fallen viele erhebende Dinge ein. Mehr als den meisten Leuten, davon bin ich überzeugt.«
»Ich habe Miss Delbo noch nicht kennengelernt.«
Ich wußte nicht, ob auf unsere Beziehung eher die Bezeichnung normal oder ungewöhnlich zutraf. Ich konnte wenig Vergleiche ziehen. Doch ich sah Imogen mindestens zwei oder drei Abende die Woche. Wir gingen essen, ins Kino, ich begleitete sie nach Hause. Sonntags saß ich bei ihr auf dem Friedhof, wenn sie ihre gut bezahlten Überstunden machte. Wir telefonierten. Dabei war ich voller Hoffnung, doch nach sechs Monaten hatte ich immer noch keinen Fuß in ihre Wohnung gesetzt. Eines Abends schlug ich vor, wir könnten uns mit meinem Onkel zum Abendessen im Hotel treffen. »Lieber nicht, DeFoe«, sagte sie. »Noch nicht. Familienangehörigen vorgestellt zu werden ist keine Kleinigkeit. Warten wir lieber noch.« Mein Onkel ließ mir jedoch keine Ruhe. »Was hast du ihr denn über mich erzählt?« fragte er ständig. »Daß ich Hörner habe?« Ich mußte Entschuldigungen erfinden, warum Imogen ihn nicht näher kennenlernen wollte. Er neckte mich und quatschte mir die Ohren voll. »Was mag sie am liebsten … du weißt schon, wie mag sie’s am liebsten?« Er selbst erging sich nämlich immer in sämtlichen Schlafzimmerdetails, wenn er von seinen Erlebnissen mit seinen Ladies erzählte, wie er sie nannte. Er marschierte schnurstracks in den Raum, in dem ich Aufsicht hielt, und schoß sofort los: »Matilda ließ mich dies oder jenes machen«, oder: »Matilda hat dies oder jenes gemacht. Ich war völlig von den Socken.« Es störte ihn auch nicht, wenn ein Museumsbesucher etwas mitbekam. Manchmal glaube ich, daß er Publikum sogar bevorzugte. Ob das stimmte oder nicht, allein schon das Erzählen regte ihn an und schien ihn zu beglücken. Obwohl er – widerstrebend – aufhörte, wenn ich ihn darum bat.
Ich hatte nicht viel Erfahrung. Ich hatte vor Imogen nur mit einer einzigen Frau geschlafen, sie hieß Cary Milne. Damals arbeitete ich noch auf dem Bahnhof. An einem bitterkalten Abend, als überall Schneematsch in den Straßen lag, wurde ich dazu ausersehen, dieser wunderhübschen, aber sehr nervösen Frau die Koffer zum Taxistand hinauszutragen. Sie war schlank, hatte dunkelbraune Haare und einen blassen Teint. Sehr hübsch, dachte ich gleich nach dem ersten Blick. Es schneite heftig. Die Straßen waren vereist. Kein Taxi in Sicht. Bis eines auftauchte, verging fast eine Stunde. In dieser Zeit saßen wir drinnen auf einer Bank und unterhielten uns. Jedenfalls war Cary die erste Frau, die ich ganz nackt gesehen hatte, von den Aktgemälden abgesehen, die ich anläßlich meiner Besuche bei meinem Onkel im Museum betrachtet hatte. Wir schliefen recht häufig miteinander, was mich jedesmal freudig überraschte, und das ging acht, neun Monate so. Aber meine Verliebtheit wurde niemals stärker als im ersten Monat unserer Beziehung. Und mir war nie ganz klar, welche Ziele ich bei ihr eigentlich verfolgte, weil wir nie aufs Heiraten zu sprechen kamen. Sie arbeitete im Büro einer Schiffahrtsgesellschaft und ich begleitete sie an fünf Abenden in der Woche vom Hafen nach Hause; am Samstagabend sah ich sie auch noch. Dann, an einem herrlichen Augusttag im Jahre 1935, verabredete sich Cary mit mir auf der Veranda des Lord Nelson Hotel. Gegen sechs Uhr kam sie Arm in Arm mit einem Mann angeschlendert, der seinem Aussehen nach um die Vierzig sein mochte. »DeFoe«, sagte sie mit nervöser Heiterkeit, »wie nett, daß wir uns hier über den Weg laufen. Ich möchte dir gern Boyd Jessup vorstellen, meinen Verlobten. Boyd – wie ich dir erzählt habe – hat die ganze Welt bereist. Wie du weißt, ist er gerade aus Nordafrika zurückgekommen, wo er ein Jahr lang gewesen ist. Ich habe dir seine Briefe gezeigt. Du hast die Briefmarken bewundert, erinnerst du dich? Er war auch schon in ganz Asien. Er ist – von Beruf – also, er ist in der Luftfahrt tätig.«
»Das hast du mir nie erzählt«, sagte ich.
»Na, dann weißt du’s eben jetzt«, sagte Cary. »Boyd, jetzt begrüß doch DeFoe.«
Boyd streckte seine Hand aus und ich schüttelte sie. »Wie Cary mir geschrieben hat, schulde ich Ihnen Dank dafür, daß Sie meine künftige Frau abends manchmal nach Hause gebracht haben«, sagte er. »Nicht, daß euer Halifax gefährlich ist. Verglichen mit, sagen wir, Kairo. Trotzdem war’s nett von Ihnen, alter Junge.«
»Nicht der Rede wert«, sagte ich.
»Schönen Abend noch«, sagte Cary. Dann gingen sie hinein ins Hotelrestaurant.
Später an diesem Abend, als der betäubende Schock dieser Demütigung und das Selbstmitleid am heftigsten an mir nagten, saß ich im Hotelfoyer und brütete dumpf vor mich hin. Mein Onkel spielte wie sonst auch mit den Hoteldienern Karten. Er kam zu mir herübergeschlendert, reichte mir ein Glas Whisky und sagte: »Dieser Drink wurde von drei Hoteldienern und deinem Onkel zu gleichen Teilen spendiert. Verständnisvolle Männer, die mit dir fühlen. Und die dir gern sagen möchten: ›Wenn sie es nicht wert war, daß du dich für sie schlägst, dann bring dich ihretwegen jetzt nicht um.‹ Sondern iß lieber was Anständiges, auf Kosten des Hauses. Ein Riesensteak um Mitternacht mit uns, hier im Foyer. Um die Tatsache zu feiern, daß das Leben uns das Glück nicht nachschmeißt.«
Ich blickte zum Kartentisch hinüber. Jake Kollias, der alte Paul Amundson, Alfred Ayers hoben ihr Glas und prosteten mir zu. Sie wohnten alle im Hotel. Plötzlich flog mit einem Schwung die Küchentür auf und Chefkoch Maximilian Cheuse, der auch im Hotel wohnte, erschien mit einem Tablett voller dampfender Steaks, Kartoffeln und zwei Flaschen Wein in den Händen. Mein Onkel klopfte mir auf den Rücken und sagte so leise, daß die Hoteldiener nicht mithören konnten: »Vielleicht würdest du dich am liebsten ins nächste Loch verkriechen, Neffe, aber tu ihnen den Gefallen und mach mit, ja?« Ich stand auf und ging mit meinem Onkel zum Spieltisch hinüber. Mit einer dramatischen Handbewegung fegte Jake alle Karten, Pokerchips und etwas Geld vom Tisch. Mein Onkel zog einen Stuhl für mich heran. Wir setzten uns. Max Cheuse servierte uns das Essen, dann setzte er sich zu uns und aß mit. Um zwei Uhr früh lärmten wir dermaßen herum, daß wir einen Hotelgast störten. In Schlafanzug, Morgenmantel und Pantoffeln kam er die Treppe herunter, die Haare hingen ihm wirr in sein vom Schlaf verquollenes Gesicht. Er ließ den Blick durchs Foyer wandern und sagte: »Ihr Jungs seid vielleicht laut, aber es gibt wohl niemanden, bei dem ich mich beschweren könnte.«
Ich fand, daß er gut mit der Situation umging. Jake lud ihn ein, sich zu uns zu setzen, aber er winkte ab und ging wieder nach oben.
Manchmal steigen die Erinnerungen glasklar hoch. Zum Beispiel kann ich mich an die erste Nacht, die Imogen und ich miteinander im Bett verbrachten, von Anfang bis Ende in allen Einzelheiten erinnern, während so viele andere Nächte danach in einem Nebel verschwimmen. Natürlich kommen einzelne Momente zurück, aber die erste Nacht ist wie die Seite eines Buchs, die ich auswendig gelernt habe. Bis zu dieser Nacht hatten wir zwar Zärtlichkeiten ausgetauscht, waren aber voll bekleidet geblieben. Wir saßen bis spät in die Nacht in ihrer Wohnung und küßten uns. Das ging zwei Monate so, dann legten wir das eine oder andere Kleidungsstück ab, hörten dann aber auf, uns auszuziehen. An etlichen solcher Abende bügelte ich dann ihre Blusen und Unterhosen, während sie in der verdunkelten Küche ihre Kopfschmerzen aussaß, einen kalten Waschlappen oder Eisbeutel auf der Stirn. Oder wir redeten. Oder hörten Radio. Oder sie las ein Buch, das Miss Delbo ihr empfohlen hatte. Ein Geschichtsbuch. Oder ein aus dem Museum entliehenes Buch. Inzwischen hatte ich Helen Delbo kennengelernt und mindestens zwei Dutzend ihrer Führungen mit angehört – Führungen mit Schulklassen, wohlhabenden Mäzenen, Kunstprofessoren, die dem Museum einen Besuch abstatteten, Würdenträgern und so weiter. Oder mit dem Damenkunstverein Halifax.
Ich erinnere mich, daß es in der Nacht des 7. Februar 1938 geschah, weil das mein Geburtstag war. Wir gingen ins Halloran’s zum Essen. »Dein Geburtstagsgeschenk wartet in meiner Wohnung«, sagte sie, als wir fertig waren. »Ich habe einen Kuchen gebacken, wir brauchen hier keine Nachspeise.« Wir brachen auf und gingen, ohne zu reden, zu ihrer Wohnung in der Quinpool Street Nr. 29 im dritten Stock. Die Wohnung hatte ein Schlafzimmer, eine beengte Wohnküche, ein Bad, ein Wohnzimmer mit zwei großen Fenstern. Ein anderer Flügel desselben Wohngebäudes versperrte teilweise den Blick auf den Hafen. Die Wohnung war nicht gerade gemütlich. Doch an den Wänden hing eine Reihe von Fotos, die Imogen als Kind zeigten, oder Imogen, als sie älter war, mit ihrer Mutter und ihrem Vater. Das Schlafzimmer war mit Möbeln vollgestopft, während der Rest der Wohnung karg wirkte, sogar vernachlässigt. Die Wände des Schlafzimmers waren mit einer Blumentapete ausgekleidet. Es gab darin ein Pfostenbett, einen Sekretär, eine Holztruhe mit Vorhängeschloß, offensichtlich ein Erbstück, einen großen ovalen Spiegel, einen wuchtigen, reich verzierten Kleiderschrank und drei kleine geflochtene Läufer. Einen Nachttisch. Eine Stehlampe neben einem Holzstuhl mit handbesticktem Bezug, auf dem Krankenschwestern dargestellt waren, die in einer indischen Freiluftklinik Kranke versorgten. (Links vom Krankenhaus stand ein Elefant mit einem juwelenbesetzten Sattel). »Das ist ein interessanter Stuhl«, sagte ich, nachdem ich mich in der Wohnung umgesehen hatte. Imogen antwortete nichts darauf, sondern warf dem Stuhl nur einen wehmütigen Blick zu. Dann setzten wir uns auf die Küchenstühle, deren Rückenlehnen mit ihren Querstreben wie Leitern aussahen. Imogen brachte den Geburtstagskuchen. »Mit Zitronenglasur«, sagte sie. »Rezept von meiner Mutter.« Auf dem Kuchen steckten dreißig Kerzen, dazu noch eine Glückskerze. Imogen zündete sie an. Sie schaltete die Küchenlampe aus. »Wünsch dir was«, sagte sie.
Ich blies die Kerzen aus.
Wir saßen im Dunkeln. Im Radio lief Klaviermusik.
»Na, da sind wir also«, sagte Imogen.
Und diesen Satz interpretierten wir beide so, daß wir eigentlich in einem anderen Zimmer sein sollten, und dann waren wir auch schon dort. In ihrem Schlafzimmer trug Imogen Lippenstift auf, und wir begannen uns im Stehen zu küssen. Sie knipste die Nachttischlampe aus. Wenn ich mich recht erinnere, zog sie mir mehr Kleidungsstücke aus als ich ihr, aber zum Schluß hatten wir beide nichts mehr an und sie sagte: »Bitte mach die Türe zu.«
Die Erinnerung daran ist, wie gesagt, glasklar geblieben. Nicht nur, weil es das erste Mal war und daher mit einer gewissen Nostalgie behaftet ist – daran allein liegt es nicht. Es war die ehrlichste Nacht, die wir je miteinander im Bett verbringen sollten. Da wir nichts voneinander wußten, ich meine, über unsere nackten Körper, war alles eine Enthüllung. Imogen konnte sagen: »Das ist sehr schön«, und ich spürte, daß sie es meinte. Auch ich sagte einiges. Als wir mit dem ersten Mal in dieser Nacht zu Ende gekommen waren, streckte sich Imogen auf mir aus, ihre Brüste an meinen Rücken gepreßt – es war himmlisch, muß ich gestehen. So schliefen wir eine kurze Zeit. Ich erinnere mich noch, wie ich dachte: Wie ungewöhnlich, daß ich etwas Wunderbares träume, und erst recht, daß es tatsächlich geschieht, wenn ich aufwache! Imogen sagte: »Ich werde jetzt jede Stelle suchen, auf der ich Lippenstift hinterlassen habe, und dann noch ein paar Spuren dazu machen.« Ich sagte nicht nein. Später schliefen wir ein, nur um erneut aufzuwachen. Imogen lag mit ihrem Kopf an meiner Brust und gab mir Ratschläge für meine Tätigkeit im Museum. Ich hatte nichts dagegen. Es war schön, so im Dunkeln zu reden.
»Ich habe nachgedacht, DeFoe«, sagte sie. »Wenn ich mal länger in der einen oder anderen Ecke des Friedhofs arbeiten muß, weißt du, was ich anschließend mache? Ich gehe bewußt zur entgegengesetzten Seite hinüber. Und irgendwie bewirkt das eine Veränderung. Ich wette, dir kommen Raum A oder C nach einer Weile ziemlich klein vor.«
»Manchmal gehe in die Putzkammer und spritze mir kaltes Wasser ins Gesicht.«
»Wie wär’s mit Folgendem? Du schaust auf die Uhr und stellst dich alle fünfzehn Minuten auf einen neuen Platz. Gehst in die Nähe eines anderen Bildes. Oder von der Bank zum Fenster. In beliebiger Reihenfolge, den ganzen Tag lang. Merkst du, worauf ich hinaus will?«
Sie küßte mich auf die Ohren, dann auf die Brust, und als ich antwortete, erkannte ich meine eigene Stimme kaum wieder. »Das könnte funktionieren. Denn schon nach einem halben Jahr – und ich möchte diesen Job vielleicht mein ganzes Leben lang behalten – habe ich angefangen, mir Sorgen zu machen, vor allem an Tagen, wenn wenig los war. Das Problem ist nicht, daß du wachsam bleiben mußt, wenn du mit den Bildern allein bist. Aber jeden Moment könnte ein Besucher hereinkommen.«
Ich spürte, wie sich Imogen plötzlich aufsetzte. »Du willst vielleicht noch dreißig Jahre lang Bilder bewachen?«
»Vielleicht. Was hältst denn du davon?«
»Das soll doch kein Heiratsantrag sein, oder? Fragst du vielleicht, ob ich bereit wäre, mit einem Bilderwächter zusammenzuleben?«
Sie rutschte zur anderen Bettkante hinüber.
»He, du hast mich wohl satt, weil du auf die andere Seite abwanderst?«
»Und siehst du, es hat schon geklappt. Weil ich wieder interessiert bin.« Sie rollte wieder zu mir herüber und gab mir einen tiefen Kuß, tastete mit der Hand nach unten, wir küßten uns weiter und sie glitt über mich. »Ach, das mit dem Heiratsantrag war nur ein Witz«, sagte sie und stöhnte dann auf.
In Wirklichkeit hatte ich mir gar nichts gewünscht. Kein Wunsch wäre das Beste, dachte ich.
Mitten in der Nacht wachte ich auf und entdeckte Imogen am Küchentisch. Das Radio lief leise. Die Straßenlampen warfen schwaches Licht durchs Fenster.
Imogen war in ein Nachthemd geschlüpft und hatte ein Stück von dem Zitronenkuchen gegessen. »Darling, willst du ein Stück – das Rezept ist von meiner Mutter. Hab ich das schon erwähnt?«
»Hast du. Und ja, ich hätte gern eins.«
Imogen gab mir ein Stück Zitronen-Geburtstagskuchen in die Hand; als ich es fertig gegessen hatte, setzte sie sich auf meinen Schoß und leckte jeden einzelnen meiner Finger ab. Ich wollte ihre Wohnung nie mehr im Leben verlassen. »Du hast über zwei Stunden geschlafen«, sagte sie. »Willst du’s hier machen oder wieder im Bett?«
»Hier«, sagte ich.
Aber das hatte Imogen schon gewußt, ihr Morgenmantel war schon auf den Boden geglitten.
Den ganzen nächsten Tag erprobte ich Imogens Strategie. Allerdings wechselte ich meinen Standort nur jede halbe Stunde statt alle fünfzehn Minuten. Ich ging von der Bank in der Mitte zu dem Fenster, von dem aus man zum Hafenhinüberschauen konnte. Ich ging von einer Ecke in die andere. Ich stand abwechselnd neben jeder der Landschaften. Als mein Onkel und ich nach der Arbeit zum Hotel zurückkehrten, sagte er: »DeFoe, mir ist aufgefallen, daß du heute so zappelig warst wie ein Kind auf einem Tretroller. Also ich sitze auf einem Stuhl und lese Zeitung. Um meine Kräfte zu schonen.«
»Ich mußte mir jede halbe Stunde einen neuen Standort suchen. War nicht meine Idee.«
»Wessen Idee dann?«
»Imogen Linnys.«
»Aha! Na schön, wenn dich das – wach hält?«
»Wir hatten heute viele Besucher, findest du nicht? Wie viele übrigens?«
»Einundfünfzig. Gut, daß du so aufmerksam warst.«
»Ja, gute Sache.«
»Habt ihr beide im Bett schon mal Sendungen von Ovid Lamartine gehört?«
»Nein.«
»Oder überhaupt Radio?«
»Das steht in der Küche. In ihrer Küche.«
»Seine Sendungen sind wichtig, DeFoe.«
»Ich weiß.«
»Wenn ihr anfangt, euch im Bett Ovid Lamartine anzuhören, gib mir Bescheid, ja? Dann kann ich Hoffnung für eure gemeinsame Zukunft schöpfen. Es ist schön, daß du jemanden hast. Du hattest noch keine … Liebesbeziehung … Vielleicht wird Ovid Lamartine zu einer gemeinsamen Erinnerung für uns alle.«
»Ich werde Imogen fragen, ob sie sich einmal eine Abendsendung anhören möchte.«
»Das würde mich riesig freuen.«
»Schön.«
»Hat sie überhaupt ein Radio im Schlafzimmer?«
»Sie hat ein Radio, Onkel Edward. Das steht zufällig in der Küche. Ich hab’s dir doch gerade erzählt.«
»Du brauchst nur den Stecker rauszuziehen und es ins Schlafzimmer rüberzutragen. Für diese einfache Handlung wird doch noch Zeit bleiben in den Pausen zwischen euren sonstigen Beschäftigungen.«
»Das reicht, Onkel Edward.«
»Im Pfandhaus gibt’s billige Radios. Da könntest du eins fürs Schlafzimmer kaufen. Wenn du nicht aufstehen und in die Küche gehen willst. Wenn ihr ineinander verschlungen daliegt. Du könntest dich gleichzeitig bei Ovid Lamartine informieren, was in Europa los ist.«
Wir hatten das Hotel erreicht. Mein Onkel ging in den hintersten Teil des Foyers, setzte sich zu den Hoteldienern Jake Kollias, Alfred Ayers und Paul Amundson und goß sich einen Drink ein.
Ich ging in mein Zimmer hoch. Ich hatte noch eine Stunde bis zu meiner Verabredung mit Imogen. Heute abend würde es kalt werden und schneien. Ich badete rasch und zog mich um – braune Hose, Wollsocken, Unterhemd, dunkelblaues Hemd, grauer Pulli, Mantel, Schal, schwarze Schuhe, Galoschen. Dann ging ich hinunter und trat noch kurz auf die Hotelveranda hinaus, bevor ich zum Halloran’s aufbrach. Der Wind wirbelte die Schneeflocken herum, daß einem schwindlig wurde, peitschte sie mir den ganzen Weg – etwa zehn Straßen weit – ins Gesicht. Als ich das Restaurant erreichte, sah ich Imogen schon durchs Fenster. Sie saß an einem Tisch in der Nähe der Küche und trug ein anthrazitfarbenes Kleid. Sie war schicker gekleidet als sonst, noch schicker als an meinem Geburtstag, dachte ich. Warum, wußte ich nicht. Sie hatte wahrscheinlich einfach Lust gehabt, sich fein zu machen. Ich hatte schon hundertmal in diesem Restaurant gegessen, bevor ich sie kannte. Jetzt hieß mich sein schimmerndes Licht auf ganz neue Weise willkommen. Imogen sah wunderschön aus. Ihre beiden Zöpfe hatte sie mit juwelenbesetzten Spangen hochgesteckt. Ich hatte die Spangen auf ihrem Sekretär liegen sehen. Nie würde ich mir die Frage erlauben, ob die Steine darauf echt waren. Die Spangen wirkten altmodisch, vielleicht hatten sie Imogens Mutter gehört.
Anscheinend war Imogen auch gerade erst gekommen. Der Kellner hängte ihren Mantel auf und Imogen blies sich in die Hände, die sie dann gegeneinanderrieb. Wir küßten uns zur Begrüßung. Wir küßten uns auch, als wir mit unseren Gläsern anstießen. Beim Kaffee sagte sie: »Wir könnten es immer noch ins Kino schaffen. Aber wenn wir nicht in zehn Minuten im Bett sind, sterbe ich.« Von diesem Moment an schlug mein Herz an diesem Abend noch höher.
Am Morgen wachte ich um 8 Uhr auf. Manchmal spürt man es, wenn es draußen schneit, auch bei heruntergelassenen Jalousien. Ich muß nach Hause, meine Uniform anziehen, früh ins Museum gehen, war mein erster Gedanke. Mr. Connaught will einige Bilder in Raum A umhängen. Ich stieg aus Imogens Bett, zog mich an und fand Imogen in der Küche. »Hast du Lust auf Kaffee?« fragte sie. »Ich habe mir schon eine Tasse gemacht.«
»Bitte, gern.«
Sie hatte ihr Nachthemd und ihren Morgenmantel an. Sie goß mir eine Tasse Kaffee ein, und ich setzte mich zu ihr an den Tisch. »Du hättest nicht gedacht, daß ich ein Geschenk für dich besorgt habe, was? Trotzdem hab ich eins. Aber es hat gestern ja schon die halbe Nacht gedauert, bis wir überhaupt dazu kamen, den Kuchen anzuschneiden.«
Sie legte ein kleines Päckchen auf den Tisch. Es war in rotes Geschenkpapier eingewickelt. Ich machte es auf. Eine Krawattenklemme. »Die ist aber hübsch«, sagte ich. »Und ich brauche auch wirklich eine. An meinem ersten Arbeitstag im Museum empfahl mir mein Onkel, mir eine zu kaufen, aber jetzt bin ich froh, daß ich es nicht getan habe.«
»Ein in zweierlei Hinsicht praktisches Geschenk. Erstens sorgt die Klemme für einen ordentlichen Sitz deiner Krawatte. Zweitens war sie für mich erschwinglich.«
»Danke, Imogen. Ich werde sie jeden Tag zur Arbeit tragen.«
»Weißt du, dieser Stuhl, den du gestern bewundert hast?«
»Der mit dem Elefanten?«
»Der hat meinen Eltern gehört.«
»Du hast ein trauriges Gesicht gemacht, als ich darauf zu sprechen kam, deshalb habe ich das Thema fallen gelassen.«
»Meine Eltern hießen Grace und Quinn«, erzählte sie. »Ich war dreiundzwanzig, als sie starben. Wir wohnten zwei Straßen auseinander; ich war damals schon beim Friedhof angestellt. Ich hatte keine nennenswerte Schulbildung. Meine Mutter war mit dem Rabbiner der Synagoge befreundet und ging immer zum Gottesdienst, wie ich dir schon erzählt habe. Sie hatte erfahren, daß der damalige Friedhofsgärtner, Mr. Grenwald, bald in Rente gehen würde, man brauchte sich die Stelle nur zu schnappen, und da fragte meine Mutter ganz einfach. Beim Gärtnern hatte ich schon immer eine geschickte Hand. Ich hatte schon viele Gärten in der Nachbarschaft angelegt und wurde manchmal sogar dafür bezahlt. Mr. Grenwald machte einen Versuch mit mir. Ich ging einen Monat bei ihm in die Lehre, dann guckte er mir noch zwei Monate auf die Finger. Der Sommer ging vorbei, und Mr. Grenwald empfahl mich für die Stelle. Ich glaube, er war anfangs überzeugt, Gärtnern sei Männersache, aber ich konnte ihn eines Besseren belehren. Und mir gefiel die Arbeit von Anfang an. Weißt du, Miss Delbo hat mir erzählt, daß die Juden in der alten Heimat den Friedhof das ›Dorf der Noch-Lebenden‹ nennen. Ich würde gern den Menschen, die ich geliebt habe, so stark im Gedächtnis bleiben, als wäre ich immer noch hier, du nicht auch? Ich auf jeden Fall.«
»Manchmal rede ich mit meinen Eltern. Ich bin dreißig Jahre alt und unterhalte mich laut mit ihnen.«
»Eine Waise plus eine Waise ergibt – was glaubst du?«
»Einfach uns beide in deiner Küche. Nicht mehr und nicht weniger.«
»Sie sind im Abstand von drei Tagen gestorben, an einer Infektion, die sie sich in Indien geholt haben. Meine Eltern.«
»Indien?«
»Meine Tante Maggie, die Schwester meiner Mutter. Sie war Missionsschwester in Indien. Meine Eltern haben sie besucht. Maggie war nie krank. Nach dem Tod meiner Eltern hatte sie etliche Nervenzusammenbrüche, wie sie es nannte. Sie hat meine Eltern auf dem Dampfer zurückgebracht. Von Indien nach England, dann nach Kanada.«
»Siehst du sie immer noch?«
»Maggie? Sie gab ihren Beruf als Krankenschwester auf und wurde Gerichtsstenographin in Yarmouth. Sie machte dafür eine Ausbildung an der Abendschule. Während dieser Zeit habe ich sie ziemlich oft gesehen. Aber dann hat sie einen Buchhändler geheiratet und ist mit ihm nach Vancouver in British Columbia gezogen. Jeden Monat bekomme ich einen Brief mit den letzten Neuigkeiten von ihr. Aber gesehen habe ich Tante Maggie nun schon lange nicht mehr, wart mal, letztes Weihnachten waren es vier Jahre.«
»Wenigstens habt ihr noch Kontakt.«
»Ich weiß nicht, warum ich diesen Stuhl behalte. Es ist, als wären sie auf einem Stuhl gesessen, der ihr Schicksal vorweggenommen hat. Diese Krankenhausszene.«
Wir tranken Kaffee und schwiegen eine Weile.
»Also«, sagte sie schließlich. »Du willst doch nicht zu spät zur Arbeit kommen.«
»Wenigstens bin ich den ganzen Winter in geheizten Räumen.«
»Mir geht’s gut da draußen. Ich sorge dafür, daß ich viel zu tun habe. Mir wird eigentlich nie kalt. Außerdem gibt’s gleich ein Café in der Nähe und die Bude, wo du Fisch und Pommes kriegst. Ich mache Teepause, wann ich will. Ich kann meine Arbeitszeit im Grunde selbst bestimmen. Solange ich mein Pensum schaffe.«
»Ich geh jetzt lieber.«
»DeFoe, herzlichen Glückwunsch zum gestrigen Geburtstag.« Sie schob mir die Krawattenklemme in die Hosentasche.
»Hast du Lust auf Kino? Es läuft ein amerikanischer Western.«
»Ich bin heute abend schon mit meinem Onkel zum Essen verabredet. Das wäre gegen 17.30 Uhr. Möchtest du dich anschließen?«
»Nein danke. Aber wir können uns um sieben im Robie Street Kino treffen.«
»Bis dann.«
»Um noch einmal auf Indien zurückzukommen, auf den Stuhl und alles, was ich dir erzählt habe. Ich dachte einfach, du solltest diese Dinge über mich wissen.«