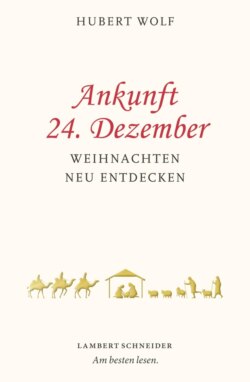Читать книгу Ankunft 24. Dezember - Hubert Wolf - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеTröst mir mein Gemüte
„Tröst mir mein Gemüte, durch alle deine Güte“ – so lauten zwei Verszeilen in einem bekannten und beliebten Weihnachtslied. Es ist schon ein wenig verrückt: Das ganze Jahr über würden die meisten Menschen „In dulci jubilo“ für sentimentalen Kitsch halten, in der Adventsund Weihnachtszeit aber bekommen viele nicht genug davon. Und vielleicht gilt das, was für den so seltsam veränderten Musikgeschmack zutrifft, auch in viel grundsätzlicherer Weise?
Menschen, die sonst aus Umwelt- und Kostengründen Energiesparlampen verwenden, illuminieren in der Adventszeit ganze Fensterfronten mit Lichterketten in allen Farben und Formen. Es können gar nicht genug Lichter sein auf Tannenbäumen, Lorbeerhecken, Balkonbrüstungen und anderswo. Unsere Dörfer und Städte sind dieser Tage voll davon.
Menschen, denen sonst eine funktionale, klar strukturierte, praktische Wohnungseinrichtung über alles geht, sehnen sich nach Heimeligkeit und Gemütlichkeit in ihrem Haus. Sie freuen sich plötzlich an Adventskränzen und festlich geschmückten Tannenbäumen und nicht zuletzt am Duft von Zimt und Mandel.
Menschen, die sonst jeden Euro zweimal umdrehen, bevor sie ihn ausgeben, kaufen wie verrückt Geschenke, die eigentlich keiner braucht, die aber hoffentlich zumindest ein wenig Freude bei den Beschenkten auslösen, zumindest weil Geschenke auspacken einfach so schön ist.
Menschen, die sonst das ganze Jahr keine Kirche von innen sehen und auf fromme Übungen und dergleichen keinen Wert legen, sagen dann: Wenn ich am Heiligen Abend nicht in der Christmette oder der Mitternachtsmesse war, dann fehlt mir etwas Wichtiges. Die Wenigsten aber können es auf den Punkt bringen und anderen Menschen nachvollziehbar erklären, was ihnen dann eigentlich genau fehlt.
Was ist das, was aufgeklärte, postreligiöse, „vernünftige“ Menschen unserer Tage in der Advents- und Weihnachtszeit so fundamental verändert? Was ist schuld daran, dass in uns plötzlich ganz andere Saiten zu klingen anfangen – Saiten, von denen wir gar nicht mehr wussten, dass sie bei uns überhaupt vorhanden sind? Warum überkommen uns immer um den Heiligen Abend herum solch sentimentale Erinnerungen an die Weihnachtsfeste der Kindheit, als man noch an das Christkind mit seinen Gaben glauben konnte? Als der Weihnachtsmann noch heiliger Nikolaus hieß und einmal im Jahr am 6. Dezember kam und nicht hundertfach und wochenlang in allen Kaufhäusern herumlungerte. Oder ganz anders gefragt: Warum sind für uns nur weiße Weihnachten richtige Weihnachten?
In dulci jubilo
aus dem fünfzehnten Jahrhundert
1. In dulci jubilo, nun singet und seid froh:
Unsers Herzens Wonne liegt in praesepio
und leuchtet wie die Sonne matris in gremio.
Alpha es et o, Alpha es et o.
2. O Jesu parvule, nach dir ist mir so weh.
Tröst mir mein Gemüte, o puer optime,
durch alle deine Güte, o princeps gloriae.
Trahe me post te, trahe me post te.
3. Ubi sunt gaudia? Nirgends mehr denn da,
wo die Engel singen nova cantica
und die Zimbeln klingen in regis curia.
Eja qualia, eja qualia.
Die Antwort auf diese Fragen hängt mit dem Zauber der Heiligen Nacht, mit dem Geheimnis von Weihnachten, mit der Grundbotschaft des Christentums eng zusammen. Auch wenn sich Geheimnisse und Verzauberung nicht so leicht in Worte fassen lassen: Hier geht es weniger um religiöse Sätze, als vielmehr um eine fundamentale Wahrheit, die wir zunächst in Erfahrungen und Gefühlen gewinnen und die sich uns deshalb zuerst auf dieser Ebene erschließt. Wir können zwar den Katechismus-Satz nachsprechen, dass Gott an Weihnachten Mensch geworden ist, und im Glaubensbekenntnis beten: „geboren aus Maria der Jungfrau“, wir können zwar versuchen, der Botschaft von der Menschwerdung Gottes einen Sinn abzugewinnen – mit den Kategorien der Logik allein können wir dieses Geheimnis jedoch nicht aufschließen.
Denn wie soll man sich rein nach den Gesetzen einer philosophischen Logik vorstellen, dass der eine ewige, tragende Grund aller Wirklichkeit, den wir Gott nennen, zur Welt kommt, in die Geschichte eintritt, Mensch wird und sich dadurch den Gesetzen der Zeit unterwirft? Wie soll der Ewige ein Zeitlicher werden können und zugleich der Ewige bleiben? Die Hegelsche Dialektik, nach der Gott der Vater im Anderen seiner Selbst, nämlich im Sohn bei sich selbst sei, ist eben doch nicht jedermanns Sache. Und auch die dogmatischen Spekulationen in den systematischen Lehrbüchern der Theologie führen einen nicht weiter. Vielleicht sollte man sich auch hier an Wittgensteins berühmten Satz halten: Worüber man nicht reden kann, darüber soll man schweigen.
Die Menschwerdung Gottes macht auch die Menschwerdung des Menschen wieder zum Thema
Was Menschwerdung Gottes für uns bedeutet, ist aber keine Angelegenheit des theologischen Spezialwissens. Denn Menschwerdung Gottes hat fundamental mit unserer eigenen Menschwerdung und unserem Menschsein zu tun. Sie hat damit zu tun, dass wir zwar biologisch alle durch Geburt zur Gattung Mensch gehören, aber deswegen noch lange keine Menschen im eigentlichen Wortsinn sind. „Werde Mensch“, das ist ein ständiger Imperativ, der in der Weihnachtszeit wieder hörbar wird. Die Menschwerdung Gottes macht auch die Menschwerdung des Menschen wieder zum Thema.
Leiden wir nicht alle an einem entmenschlichenden Zeitmanagement? An steigendem Leistungsdruck? Führen uns nicht die ständig gegenwärtigen Abschlussbilanzen und Evaluationen das ganze Ausmaß unserer Fremdbestimmung vor Augen? Wir kaufen uns dann vielleicht irgendwelche Ratgeber mit Titeln wie „Mehr Zeit zum Glücklichsein“ oder „Momente für mich“, von denen wir aber heute schon wissen, dass wir sie nicht lesen und schon gar nicht beherzigen werden. Wie wir Mensch werden und sein können, das können wir letztlich nicht wissen, schon gar nicht schwarz auf weiß nach Hause tragen, weil man das nicht wissen kann, sondern selber leben und er-leben muss mit Haut und Haar.
Vielleicht ist dies das eigentlich Faszinierende an den beiden Weihnachtsgeschichten der Heiligen Schrift, die uns die Evangelisten Lukas und Matthäus aufgeschrieben haben: Die einfachen Hirten auf ihren Feldern genauso wie die gebildeten Weisen aus dem Morgenland machen sich auf den Weg zu einem Kind, das in einer Krippe liegt.
Die Wahrheit der Weihnachtsbotschaft liegt tiefer
Beide Weihnachtsgeschichten sind aber nicht in erster Linie als historische Berichte zu verstehen. Markus, das älteste Evangelium, beginnt mit der Taufe Jesu im Jordan, von seiner Geburt berichtet es so wenig wie das Johannes-Evangelium. Aber die Wahrheit der Weihnachtsbotschaft liegt tiefer. Sie will uns in einfachen, eingängigen und zugleich tief anrührenden Bildern sagen: So wie Gott Mensch wurde in Bethlehem, im Kind im Stall, das nicht viele Worte macht und schon gar keine dogmatischen Wahrheiten von sich gibt, weil es noch nicht sprechen kann, so stehen dir, Mensch, vor Gott stets alle unverbauten Möglichkeiten der Menschwerdung offen. Die Zukunft liegt als Möglichkeit und große Chance vor dir – wie bei einem neugeborenen Kind.
Wer Sehnsucht hat, wer nach dem Sinn seines Lebens sucht, der muss aufbrechen, herausgehen aus den gewohnten Bahnen
Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder (Matthäus 18,3) – dieser Satz des Evangeliums fordert uns nicht auf, kindisch zu werden, sondern kindlich begeisterungsfähig zu bleiben, echt in der Trauer wie in der Freude, selig und glücklich manchmal schon durch ein großes tolles Eis. Weihnachten macht uns ohne Worte aufmerksam auf eine große Sehnsucht, auf die Sehnsucht, wirklich Mensch zu sein, wirklich menschlich leben zu können. Wer Sehnsucht hat, wer nach dem Sinn seines Lebens sucht, der muss aufbrechen, herausgehen aus den gewohnten Bahnen, egal ob er als Hirte von den Feldern kommt oder als Gelehrter oder König aus dem Morgenland.
Wenn wir uns auf den Weg der Hirten und Weisen begeben, von denen die Evangelien erzählen, dann macht es durchaus Sinn, voller Sehnsucht zu singen „Tröst mir mein Gemüte, durch alle deine Güte“, weil wir uns selber nicht trösten können, weil wir uns diesen Trost selber nicht zusprechen können.
Weihnachten ist als Fest der Menschwerdung ein Protest gegen die Entmenschlichung des Menschen. Wir spüren es genau, wenn wir wenigstens am Heiligen Abend für einige Stunden jenes Andere in uns zulassen, was uns mindestens so ausmacht wie unser Intellekt, nämlich das Gemüt, unser ganzes Fühlen und Sehnen. Wir spüren es – noch: Tannenbäume, Geschenke, Lichterketten, sentimentale Lieder, Räuchermännchen und gemeinsamer Kirchgang am Heiligen Abend sind hoffnungsvolle Zeichen, dass wir doch noch ahnen, was Leben eigentlich ist; dass die Umstände und wir selber es zwar fast, aber doch noch nicht ganz geschafft haben, uns in die farblos grauen Uniformen menschlicher Maschinen zu pressen.
Vielleicht sollten wir das Gemüt wieder zulassen und uns von der Menschwerdung Gottes trösten lassen. Vielleicht sollten wir versuchen, länger als die drei Weihnachtstage weihnachtliche Menschen zu sein, indem wir alle Saiten in uns klingen lassen. Vielleicht sollten wir ernsthaft meinen, was wir singen: „Tröst mir mein Gemüte, o puer optime, durch alle deine Güte, o princeps gloriae.“ O Kind, in dir zeigt Gott mir, was Menschsein eigentlich heißt. In dir zeigt mir Gott, dass er mich liebt mit Haut und Haar, nicht nur meine rationale Seite, meine wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und beruflichen Leistungen, sondern mich als ganzen, unverwechselbaren, einmaligen Menschen.
Kann man im Leben wirklich alles begreifen und logisch erklären?
Manche werden sagen, das ist mir zu gemütvoll, zu wenig rational, zu wenig logisch. Aber kann man im Leben wirklich alles begreifen und logisch erklären? Da sagt ein Mensch zu einem anderen Menschen: Du, ich liebe dich! Versuche einer einmal, das logisch zu erklären. Das kann man nicht begreifen, davon kann man sich nur ergreifen lassen. Wenn Menschen voller Liebe „Ja“ zueinander sagen, dann wird ein Fest gefeiert, das nicht umsonst Hochzeit heißt und die hohe Zeit im Leben von zwei Menschen meint. Dann dürfen wir feiern und singen und uns freuen, dass es so etwas gibt wie das Geheimnis der Liebe.
Du musst das Leben nicht verstehen
Du musst das Leben nicht verstehen,
dann wird es werden wie ein Fest.
Und lass dir jeden Tag geschehen
so wie ein Kind im Weitergehen
von jedem Wehen
sich viele Blüten schenken lässt.
Sie aufzusammeln und zu sparen,
das kommt dem Kind nicht in den Sinn.
Es löst sie leise aus den Haaren,
drin sie so gern gefangen waren,
und hält den lieben jungen Jahren
nach neuen seine Hände hin.
Rainer Maria Rilke
Und wenn Gott sagt: „Du Mensch, ich liebe dich mit Haut und Haar, deshalb bin ich einer von euch geworden“ – wie sollen wir das dann mit Worten erklären, wenn wir die Liebe zwischen zwei Menschen schon nicht recht begreifen können? Auch davon kann man sich nur ergreifen lassen, ein Fest – nämlich Weihnachten – feiern und singen: „O Jesu parvule, nach dir ist mir so weh. Tröst mir mein Gemüte, o puer optime, durch alle deine Güte, o princeps gloriae. Trahe me post te, trahe me post te.“