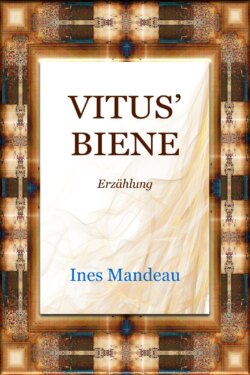Читать книгу Vitus' Biene - Ines Mandeau - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Tour Odéon
Оглавление„Na, mein Röslein, froh und munter heute“, sagt Vitus, der Kaffee trinkt und beobachtet, wie ich Orangenmarmelade in verschwenderischem Ausmaß auf das Butterbrot häufle.
„Bin ich das nicht von früh bis spät?“, frage ich kokett.
„Das bliebe zu klären“, schmunzelt er.
„Es ist die Marmelade. Du hast sie köstlich gemacht!“
Vitus ist der beste Koch der Welt. Ich kann mir keinen Besseren vorstellen. Sein jüngstes kulinarisches Experiment galt der Verwertung jener wildwachsenden Pomeranzen, die ich letztes Wochenende aus dem Jardin des Douaniers, eines neulich in Cap d’Ail eröffneten Gemeindeparks, mitgebracht hatte. Meines bescheidenen Wissens nach ist es schwierig, saure Orangen in deliziöse Marmelade zu verwandeln, doch Vitus glückte das Pilotprojekt auf Anhieb. Das Resultat schmeckt auf spannende Weise bitter und süß gleichzeitig, ohne zu bitter oder zu süß zu sein.
„Wie hast du bloß diese tolle sämige Konsistenz hingekriegt? Mit Gelierzucker?“
„Wo denkst du hin! Nein, da kommt einzig Rohrzucker in Frage. Rohr, nicht Rübe.“ Leidenschaftlich legt er los: „Den gibt es in der Bioecke im Carrefour. Ich nehme also von dem getrockneten Rohrsaft, nur ein paar Löffel voll, sonst wird’s zu zuckerig, sodann von den Orangen alles, was orange ist“, – und weiter redet er über einen Trick, wie Kerne auszulösen und weiße Häute ohne Substanzverlust abzutrennen seien, und endet mit dem Tipp: „Händisch rühren, bis der Kochlöffel schwitzt und das Kasserol singt. Pausenlos rühren – das macht’s!“
Diese Ausdauer am Herd möchte ich auch haben, aber das wird ein frommer Wunsch bleiben. „Köstlich“, sage ich noch einmal. „Kann in Serie gehen.“
„Okay, wenn du die Zutat pflückst und mich belieferst.“ Daran soll es nicht scheitern. Ich liebe es, auf den Ausflügen in die Natur die diversesten, in unserer Küche verwendbaren Gewächse zu sammeln und heimzubringen. Seit Weihnachten reifen an den unzähligen Zitrusbäumen in und um Monaco die Früchte, die leider meist höher hängen als ich mit den Händen hinkomme. Ich kenne nicht viele Bäume, deren untere Äste ich ohne Hilfsmittel, eine Leiter etwa, abklauben kann. Am Boden liegende Früchte hebe ich nur auf, wenn sie den Aufprall ohne Riss in der Haut überstanden haben, so auch die Pomeranzen im Jardin des Douaniers, meine aktuellste, höchst befriedigende Ausforschung zum Thema erntereife Wald- und Flurgenüsse.
„Du grunzelst vor dich hin, als wärst du schon in Feierlaune“, sagt das Geburtstagskind und schiebt die Marmeladenschale näher zu mir. Seine grünen Augen funkeln im Licht der Morgensonne, das zur Stunde beinahe waagrecht über den Esstisch hinweg bis tief in die Küche strömt. Ich schlecke meinen Löffel sauber und kichere völlig unmotiviert.
„Die Vorfreude ist es, mein Lieber, die Vorfreude. Ich kann deinen Ehrentag kaum erwarten. Noch dreimal schlafen bis dahin. Ganz schön kindisch, oder? Nicht mal Kinder sind so kindisch.“
„Hm, dann schmeißen wir halt eine Lolly-Poppy-Baby-Party, wär’ das was?“ Lüstern schlürft er an der Kaffeetasse und macht andere schlüpfrige Geräusche mit seinem Mund.
So kaspern wir herum und necken uns, und mampfen in Mengen wie Bergsteiger, die eine Kalorien zehrende Gipfelerklimmung vor sich haben. Dabei möchten wir bloß unseren üblichen Sonntagsvormittagsbummel durch das Städtchen unternehmen. Heute besichtigen wir den Tour Odéon, ein mit Pomp lanciertes Wolkenkratzerprojekt, das fast bezugsfertig ausgeführt ist und bereits den Rang eines neues Wahrzeichens von Monte Carlo genießt. Vitus, der die Baustelle gelegentlich inspiziert hat, will den nun abgerüsteten Turm fotografieren.
Während er seine lederne Umhängetasche der Marke Opa mit den Kamera-Utensilien packt, verrichte ich die morgendliche Hygiene und ziehe meinen Vintage-Trainingsanzug an, der eher durch sein florales Stoffmuster auffällt denn eine wie auch immer geartete Sportlichkeit. Zum wiederholten Male werfe ich einen Blick in das klimperkleine fensterlose Kabinett hinter dem Bad, zu dem Vitus keinen Zutritt hat und wo ich die gestrige Besorgung verstecke. Ich habe den gewichtigen Kübel mit dem Marillenbäumchen eigenhändig vom Carrefour zum Étoile de Mer transportiert und an meinem Mitbewohner vorbei in das Abstellkämmerchen geschleust. Hoffentlich wird es in diesem schummerigen Gefängnis die Zeit bis zum Mittwoch überstehen, ohne Schaden zu nehmen. Die Thymiantöpfe werde ich erst dienstagabends aus dem Supermarkt holen, denn lagerte ich sie jetzt in unseren vier Wänden ein, könnten die harzwürzigen Aromaschwaden die Geschenkeaktion auffliegen lassen, weil Vitus’ Nase eine verdächtige Sache wittert und ihr auf den Grund gehen will.
„Du darfst bald raus“, flüstere ich dem Bäumchen zu und verriegle die Tür zum Kabinett.
Als die gläserne Automatiktür unseres Hauseinganges zur Seite surrt und ich ins Freie trete, schießt ein altvertrauter Vers durch meinen Kopf, der lautet: „Biene Blume Hungga“, und stammt von meiner Tante Burgi. Heilige Güte, aus welchem toten Gedächtniswinkel kommt denn das hervorgeblitzt, dieses Gsatzl, wie die Tante es bezeichnet? Sie fügt die drei Worte stets ihrem „Grüß Gott“ hinzu, wenn wir uns begegnen, als wären sie eiserner Bestandteil einer speziell ausgefeilten Begrüßungsformel. „Grüß Gott!“, schmettert Burgi, die Bäuerin mit Stentorstimme, wechselt sodann in Sopranhöhen und rezitiert, langgezogen und süßlich: „Bie – nee – Blu – mee – Hungg – ahh!“
Der Art des Vortrags nach zu schließen könnte es sich um ein Zitat aus einer bedeutsamen lyrischen Avantgarde-Schöpfung handeln, doch Tante Burgi beteuert, dies seien meine ersten Worte als Kind gewesen. „Biene Blume Hungga“ – das soll ich gesagt haben? Glauben tu ich’s nicht und wissen kann ich es nicht, denn an meine frühkindlichen sprachlichen Ergüsse fehlt die Erinnerung und überhaupt: Ich habe jetzt keine Lust auf ein Nachgrübeln über Bienen und Blumen, was ohnehin ergebnislos enden würde, sondern ich will mit Vitus losmarschieren und dabei nicht von einem dummen Tantenspruch verfolgt werden. Es lockt ein heller linder Tag voller Verheißungen an den Frühling, den ich uneingeschränkt auskosten möchte und gewiss nicht diesen paar Silben opfere, die sich allzu leicht in das Bewusstsein nisten und dort ihr brütendes Unwesen als Ohrwurm treiben. Solche Nervensägen gehören ignoriert, und damit basta!
Ich ziehe den Zipper des Trainers bis zum Kinn und schalte die Beine in den vierten Gang, wie Vitus zu sagen beliebt, wenn ich turbodampfrasante von dannen springe.
„Nicht so fix!“, ruft er prompt.
„Nun mach schon, Oldie!“, gebe ich zurück und bremse mich ein bisschen ein, indessen Vitus einen Zahn zulegt. Wie gewöhnlich dauert es eine kleine Weile, bis wir uns auf einen synchronen Schritt eingependelt haben und, Seite an Seite gehend, über Dies und Das zu sprechen beginnen.
„Was hältst du vom schicken Odéon?“, frage ich Vitus, den Fachmann im Bereich der Sanierung von historischer Gebäudesubstanz. Ein halbes Leben hat er auf Baustellen in Wien verbracht und bespricht immer noch gerne Immobilienangelegenheiten, obwohl er sein österreichisches Unternehmen vor einigen Jahren an einen Konzern verkauft hat und aus dem Geschäft raus ist – zu meinem heftigsten Bedauern übrigens.
„Mal schauen, wie das derzeit aussieht“, sagt Vitus. „Die Baugrube war gewaltig. Zehn Tiefgeschosse mindestens, schätze ich“, und er redet über die Widrigkeiten und die Vorzüge des Bauens auf felsigem Grund, selbiges man hier eindrücklich habe verfolgen können. Vitus nennt den Turm in anglizistischer Manier Odeon-Tower, was uns Ausländern gnädigst nachgesehen wird.
„Na schön, der Tower steht. Mensch, bin ich gespannt auf diesen Stängel.“
Der „Stängel“ hatte im Laufe von Planung und Bauzeit für Debatten gesorgt und sogar gröbere Kontroversen mit den Anrainern entfacht, die vor Gericht geschlichtet werden mussten. Es soll eines der gegenwärtig höchsten Wohngebäude Europas sein und ist auf spektakuläre Weise aus einer unglaublich kleinen und obendrein verwegen abschüssigen Parzelle in Randlage von Monte Carlo herausgewachsen. Wir sehen den Turm in seiner vollen Länge erst, als wir um eine Häuserecke biegen und das Überdrüberkonstrukt frontal vor uns emporragt.
Ich neige den Kopf in den Nacken und schaue die gebogene, bläulich schimmernde Fassade von rund fünfzig Etagen hinauf bis in den Himmel. „Das sind ja zwei Türme! Teils steckt der eine drin im andern. Sieht aus, als wären es siamesische Zwillinge.“
„Interessant“, meint Vitus. „Elliptischer Grundriss.“ Er guckt sich die Augen aus und sagt nichts mehr. Mit geübtem Griff dreht er sein ASM-Schildkäppi exakt um einhundertachtzig Grad, zückt den Fotoapparat und macht sich schweigend an das Shooting.
„Imponierend“, bemerke ich höflich und denke, als ich zum Gebäudegiebel hochschaue: „Was für ein seltsamer Zacken. Wie ein schnödes Geodreieck.“ Ich ziehe die Stirn in Falten. „Der arme Himmel. Er wird von dem Betonspitz da oben durchstochen.“
Das ist natürlich eine Einbildung. Der Himmel ist in sicherer Ferne und sein Blau rein und unverletzt bis auf den Kondensauspuff eines Flugzeuges, der einen scharfen weißen Strich ins sphärische Gewölbe ritzt.
Ich senke den Kopf in Normalposition, bewege die steifen Halswirbel hin und her und überlege, warum diese sterile Wohnmaschine den musischen Namen „Odeon“ verliehen bekommen hat. Mit Wehmut denke ich an das Wiener Odeon Theater, das sich in einem monumentalen Neorenaissance-Gebäude befindet nebst der österreichischen Börse für landwirtschaftliche Produkte und manch anderen Etablissements. Wie hatte mich dieses feudale Palais fasziniert, als ich es das erste Mal sah und seine hehren Säulenhallen betrat! Kein dergleichen prickelndes Gefühl regt sich heute angesichts des funkelnagelneuen Bauwerks vor mir. Da kann es noch so schillern und prangen und ein exzellentes Zeugnis der Stahlbetonkunst und des Glasfronten-Hightech liefern, mich lässt diese Demonstration postmoderner Leistungen kalt.
Vitus ist auf Motivjagd, besser gesagt Perspektivensuche, um die Vertikale seines Zielobjektes in ein rechtes Bild zu rücken. Mein alter Weggefährte biegt und wendet seinen massigen Körper und federt in den Knien in einer verblüffenden Geschmeidigkeit; er ist beneidenswert agil, und indem ich seinen kindlichen Eifer beim Knipsen beobachte, denke ich, vielleicht stimmt ja doch, was er von sich behauptet. Er sei ein Künstler, beharrte er stets, und kein Geschäftsmann, und ich glaubte ihm nie. „Du bist sehr wohl ein Geschäftsmann, ein begnadeter, ein echter Unternehmer, das spürt jeder!“, pflegte ich hitzig zu entgegnen. „Wie kannst du nur sagen, du seist es nicht?“
„Ich wollte etwas Künstlerisches tun. Schon als Bub! Hatte leider nie Gelegenheit dazu. Jetzt endlich bin ich frei fürs freie Schaffen. Endlich!“
„Du und Künstler? Das ist ein Widersinn, totaler Widersinn! Ein Unternehmer bist du, ein geborener Unternehmer, das ist beglaubigt und bewiesen! Du hast eine Firma aufgezogen und groß gemacht. Und dann: verkauft! Wie konntest du bloß verkaufen! Es lief so gut! Ich versteh das nicht. Ich wünschte, ach wie sehr wünschte ich nur einen Hauch von deinem Geschäftstalent!“
„Ja, nicht schlecht, die Nase fürs Geschäftliche. So what? Ich musste mich bewähren, und ich konnte es. Das ist alles. Aber ich wollte ein Künstler sein – und kein Businessman.“
„Jetzt bist du ein Weder-Noch. Dein Business ist passé. Detto das Prestige als Firmenchef. Ende der Aufführung vom Lokalmatador in Wien, und in Monaco kennt dich kein Mensch.“
„Es hat mich eine Menge gekostet, unberühmt zu werden.“
„Endstation Privatkoch und Hobbyknipser. Brillanter Schlussakt fürwahr.“
„Wo ein Ende, da ein Anfang.“
„Vitus, in Wirklichkeit bist du an der Côte d’Azur gestrandet.“
Und er lacht: „Auswandern wollte ich auch schon immer. In das Licht des Südens.“
„In Wien scheint doch ebenso die Sonne! In Wien warst du wer. Hier bist du nur ein Monsieur, nichts weiter.“
„So ist es, und du ahnst nicht, wie froh ich bin.“
Vitus besteigt eine Rampe und versucht, an die Nordseite des Wolkenkratzers zu gelangen, aber die Maschenzäune blockieren den Weg. „Wir kommen wieder, wenn komplett abgeräumt ist und die Leute einziehen. Ich wüsst’ zu gern, ob die Lobby gelungen ist. Der Eingang liegt zu niedrig. Das hätte ich anders gelöst“, murmelt er vor sich hin, während er seine Foto-Utensilien in der Ledertasche verstaut.
„Lieferung ist angeblich in einem Monat. Dann fahren die Umzugswagen auf. Die stolzen Erstbesitzer warten darauf, ihr Domizil aufschlagen zu dürfen.“ Ich las es in der Regionalgazette.
„Möchtest du hier kaufen?“, fragt Vitus unvermittelt.
„Nein, solche Appartements passen nicht in mein Portefeuille. Ich investiere in Aktien.“
„Und zur Miete wohnen? Ich wette, es wird reichlich vermietet.“
„Auch nicht. Zu glatt, zu hoch, zu windig da oben. Nein, ich mag den kompakten Étoile de Mer lieber. Nun denn“, ich schnaufe übertrieben, „wer weiß, was kommt.“
„Richtig. Wer weiß, was kommt.“ Andächtig betrachtet er die blendende Fassade aus dem Material, das ich stur und altbacken als Glas tituliere, obwohl mir der zutreffende Fachbegriff für diesen futuristischen Verbundwerkstoff bekannt ist. Nach einer Weile sage ich: „Das Äußere eines Hauses ist nämlich bloß ein Aspekt beim Wohnen und beileibe nicht der Wichtigste. Viel wesentlicher sind die Innenräume, ihr Zuschnitt, die Ausrichtung und so fort. Ich muss spüren, wie es sich anfühlt, wenn ich mich in den Zimmern bewege. Dann kann ich beurteilen, ob es angenehm ist – oder eben nicht.“
Vitus lacht. „Du hast ja so recht.“ Er greift meine Hand und hält sie fest. „Ausgezeichnet, ich habe fürs Erste alles im Kasten. Wir können weiter.“
Zwischen malerischen Belle Époque-Villen und nüchternen Komplexen aus der Nachkriegszeit führen mehrere Stiegen und ein öffentlicher Aufzug hangabwärts zum Larvotto-Strand, der sich dank des milden Wetters mit Erholungsaktivisten bevölkert, als wär’s bereits der frühe Sommer und die Schwimmsaison startete. Das Eintauchen ins Meer jedoch steht heute nicht auf dem Programm, auch kein Sonnenbad, und so lassen wir die heimelige Bucht links liegen und marschieren schnurstracks nach Fontvieille.
Unterwegs auf dem Dachgarten des Carrefour-Centers pflücken wir sprießende Nadeltriebe von den üppig erblühten Rosmariensträuchern und stopfen sie in die vordere Tasche meiner Trainingshose, bis sie an unzüchtigem Örtchen ausbeult, als trüge ich ein männliches Organ spazieren.
Zum Mittagessen sind wir zurück in unserer Wohnung. Ich bin schlapp und matt und leer im Kopf. Vitus wärmt den gestern gekochten Linseneintopf auf und streut gehackten Rosmarien drüber. Ich liebe Vitus’ Linsengericht ohne Fleisch, dafür mit viel Erdäpfeln und gegarten Knoblauchzehen, und dekoriert mit grüner Garnitur. Wir stellen die kupferne Pfanne in die Tischmitte, löffeln direkt daraus und verspeisen restlos alles. Anschließend erledigen wir gemeinsam den spärlichen Abwasch. Dann verschwindet jeder in sein Zimmer. Nach dem Zähneseiden und einem erneuten Blick zum Zwergenbaum im Kabinett lege ich mich ins Bett.
„Biene Blume Hungga“, summt es zwischen den Ohren – und ich schlafe ein.