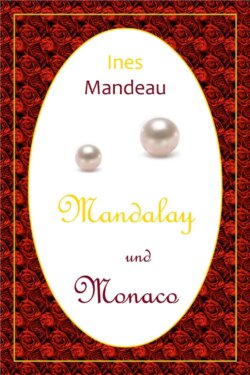Читать книгу Mandalay und Monaco - Ines Mandeau - Страница 8
Im Zug nach Kreuzegg
ОглавлениеDas war knapp. Abfahrt geschafft auf den Pfiff exakt. Ich bin im Zug, den ich keinesfalls verpassen durfte, will ich in Waldberg den letzten Anschluss des Tages nach Kreuzegg erwischen. Meinen treuen Drahtesel konnte ich vorhin gerade noch ordnungsgemäß in seinem Stall, sprich im Hauskeller, anhängen, aber für einen Kleiderwechsel in meiner Wohnung hat die Zeit nicht mehr gereicht. Das ist nicht weiter tragisch, da es auf dem Bauernhof meiner Eltern niemanden stört, wenn ich in Trainingsklamotten umherschwirre, und was für ein paar auswärtige Übernachtungen an Utensilien nötig ist, habe ich in meinem Rucksack permanent dabei. Einzig der Neoprenanzug ist fehl im Gepäck, denn in Kreuzegg kann ich ihn mangels Schwimmgelegenheit nicht gebrauchen.
Ohnehin wird morgen nicht geschwommen, sondern der achtzigste Geburtstag meines Vaters gefeiert. Wie genau das Festprogramm organisiert sein wird, weiß ich nicht, weil ich keinen Plan vom Ablauf der Party habe und die Einladung sich auf wenige mickrige Sätzchen am Telefon beschränkte: „Komm uns doch besuchen“, bat meine Mutter. Sie und Bernadette, meine Schwester, haben sich beratschlagt mit dem Ergebnis, niemand von uns sei erpicht auf eine pompöse Zeremonie, weshalb man eine solche auszuklügeln gar nicht erst in Betracht ziehe; stattdessen sollten wir eine schlichte und zwanglose Familienversammlung abhalten und alle mögen anwesend sein, denn wann waren wir zuletzt vereint im Hause, ohne dass nicht irgendwer gefehlt hätte? Eine gefühlte Ewigkeit ist das her und es sei sicherlich von jedem erwünscht, einfach nur mal wieder zusammenzutreffen. Unser Jubilar, der wie gewöhnlich auf sperrige Art vorgab, von seinem Geburtstag nichts zu wissen, werde sich fraglos freuen, wenn sein eigen Fleisch und Blut samt Anhang geschlossen anrückt auf dem Hof zu Plancken, dem Nabel des Universums meiner Eltern.
Das Zugabteil ist rammelvoll. Die halbe Stadtbevölkerung scheint freitags nach der Arbeit auf das Land zu flüchten. Ich lümmle mich in einen wundersamerweise leer gebliebenen Fenstersitzplatz und checke den Nachrichteneingang auf meinem Handy. Neue SMS in Mengen, keine von Bedeutung. Ein witziger Spruch für diese und jene Freundin als Antwort, das reicht. Klaudia allerdings, meine Schwägerin und die Jungbäuerin von Plancken, sollte ich anrufen und mit einem Statusbericht versorgen. Als sie abhebt, schallen wilde Geräusche an mein Ohr, es scheppert und kracht, zackige Rufe von Männern im Hintergrund und dann ein dünnes: „Servus, Cäcilia, einen Moment, warte, ja, hier bin ich.“ Die Fistelstimme hat fast keine Chance gegen die Lärmkulisse.
„Klaudia, hey, wo bist du?“
„Im Stall. Die Kühe sind nervös. Jetzt rühr dich, Soraya!“ Ich nehme an, damit ist eine Kuh gemeint. Mein Anruf kommt offenbar ungelegen, also fasse ich mich kurz und bündig.
„Du, ich bin im Zug und um halb neun am Bahnhof in Kreuzegg.“
„Ich hol dich ab. Magdalena ist auch in diesem Zug und ich kann gleich euch beide aufladen. Soraya! Rühr dich, marsch!“
„Toll, alles klar, wir sehen uns in Bälde.“
„Passt, ich freu mich schon.“ Und piep-piep, das war’s.
Lena ist auch im Zug? Wenn sie aus Nizza anreist, wovon ich ausgehe, dann steigt sie wie ich in Waldberg in die Lokalbahn, die durch das Gebirgstal hineinführt zur Endstation Kreuzegg. Auf einmal rückt mir die große Schwester verflixt nah. Wir haben uns jahrelang nicht mehr getroffen. Irgendwie klappt es nie mit dem leibhaftigen Kontakt. Vorhin am Mallsee sah ich sie zwar im James Bond-Filmchen von Richi, aber unwirklich erscheint mir der Auftritt, diffus wie eine Erinnerung an eine Sequenz aus einem schmalzigen Hollywoodstreifen. Roter Ferrari und weißgekleidetes Model auf den Stufen des Casinos von Monte-Carlo – bitte, was hat diese kitschige Szenerie mit Lena zu tun, meiner Schwester? Was treibt die eigentlich?
Ich bin kein Mensch, der sich in Grübeleien verliert, dennoch, als ich aus dem Fenster in die vorbeigleitende Hügellandschaft schaue, über die sich leise die Dämmerung legt, und ich eine weiche Mattigkeit in meine Glieder kriechen spüre, da zieht so einiges durch meinen Sinn – zöge durch den Sinn, wenn nicht der Magen rebellierte und meine Aufmerksamkeit auf das mulmige Gefühl lenkte, das zum Zwerchfell hochsteigt und dort ich weiß nicht welches Organ zusammenstaucht. Ominöse Sache. Ich muss aufstehen und tüchtig durchschnaufen, um diese Klemme zu lockern. Bevor jedoch die Mitreisenden wegen einer hechelnden Yogini in Wallung geraten, die sich zwischen ihren Beinen aufgepflanzt hat, beschäftige ich mich mit einer plausibleren Übung als exotischer Atemgymnastik: Ich hieve meinen Rucksack aus der Ablage über den Sitzplätzen.
Habe ich nicht ein paar Energieriegel vom letzten Triathlonbewerb im Gepäck? Bingo, hier schlummert die Athletenlabe griffbereit in einer Innentasche, und bei ihr jene Schachtel Schmerztabletten, die ich stets mit mir herumtrage. Die Pillen brauche ich, falls meine Narbe am Bauch, die zur Stunde eh recht brav ist und bloß dezente grantelt, sich stärker melden und mir den Nachtschlaf rauben sollte. Wohlmeinende Ärzte haben mich vor Gebärmutterhalskrebs bewahren wollen, aber leider die diesbezügliche Operation nicht optimal hingekriegt. Seit dem Eingriff vor drei Jahren verfolgen mich Schmerzen, gegen die keiner der Experten einen Rat gefunden hat, außer eben diverse Pillen schlucken.
Erstmal den murrenden Magen besänftigen. Ich nasche von dem Power-Imbiss, meine erste Mahlzeit seit der Käsesemmel am Vormittag im Büro, und hoffe, auf das hin herrscht Frieden im heiklen Streckenabschnitt von der Gurgel bis zum Nabel. Ergänzend zum kulinarischen genehmige ich mir einen akustischen Leckerschmaus, indem ich mir Nevermind ins Ohr stöpsle, eines meiner Lieblingsalben, ah, ja, das tut so gut zu hören:
Come as you are …
As a friend, As a friend,
As an old enemy …
Bin ich weggedöst? Ich reiße meine Augen auf. Draußen ist es dunkel. Ich darf meine Haltestation nicht verdusseln! Alles bestens, nur die Ruhe, Waldberg sei zehn Minuten vor uns, versichert mein Sitznachbar auf Anfrage. Ich schultere vorsorglich meinen Rucksack und postiere mich vor dem Waggonausgang, um an vorderster Front auf den Bahnsteig hüpfen zu können.
Das schmucke Züglein nach Kreuzegg wartet am gegenüberliegenden Gleis. Ich muss ein Stück nach vorne laufen und springe in die erste offene Zugtür. Und dann ist sie plötzlich da, meine Schwester Lena. Wie aus der Luft gezaubert steht sie vor mir in dem Abteil, in das ich eingestiegen bin, und grüßt lächelnd: „Hallo, Cilia!“, – ohne geringstes Zeichen einer Überraschung, als hätten wir uns am Morgen erst verabschiedet und würden nun, nach getanem Tagwerk im Büro, zum Feierabend wieder vereint sein.
Lena versucht, mich zu umarmen, was wegen meines wuchtigen Gepäckstückes am Rücken nicht richtig gelingen will. Ein feiner Duft weht in meine Nase. Das ist garantiert ein französisches Edelparfum. „Komm, wir setzen uns.“ Sie nimmt mich am Oberarm. „Du bist ganz kalt!“, ruft sie. „Hast du keinen Pullover dabei?“
„Mir ist nicht kalt“, widerspreche ich.
„Aber schau, hier, du hast eine Gänsehaut!“ Lenas Fingerkuppen streichen flüchtig über meine nackte Haut.
„Mir ist nicht kalt“, beharre ich, schiebe meine Ellbogen nach hinten und schäle mich aus den Tragegurten, die in die Schultern schneiden. Der Rucksack donnert auf den Fensterplatz und ich sinke in den Sitz daneben. Lena setzt sich gegenüber, zurrt ein ponchoartiges Stoffteil vor ihrer Brust fest und lächelt mir zu, als ich zum Wetter ein paar Worte sage, nämlich, heute sei es affenbrüllehitzeheiß, jawohl.
Was rede ich mit einer Schwester, mit der ich seit längerem nur unverbindliche E-Mails austausche, die in ihrer inhaltlichen Dürftigkeit an der Grenze zur Unhöflichkeit liegen, selbst wenn sie von Zeit zu Zeit aufgehübscht sind mit einer gewissermaßen pressetauglichen Fotodatei im Anhang? Mit einer Schwester, von der ich nicht wesentlich mehr weiß als die staubtrockenen Eckpfeiler ihres Lebenslaufes? Name: Magdalena Planck, Stand: ledig, Kinder: keine, Alter: fünfzig. Geboren in Kreuzegg und nach der Hochschule berufsbedingt verzogen ins Ausland mit diesem Tick, keinem Familienmitglied die Postadresse preiszugeben und niemals jemanden von den Verwandten zu sich einzuladen. Sie zieht häufig um. Vor einigen Jahren ist sie in Südfrankreich gestrandet und wohnt irgendwo in oder um Nizza. Angeblich.
„Hey, und wie geht es dir so?“, frage ich schnell, bevor ein komisches Schweigen entstehen könnte, nachdem die Außergewöhnlichkeit der aktuellen meteorologischen Lage zügig abgehandelt worden ist.
„Gut, ich hab’s fein, aber du, Schwesterlein?“ Sie fixiert mich mit diesem Kontrolleursblick, den ich seit jeher an ihr hasste. „Du schaust furchtbar zerzaust aus, meine Kleine, und abgehetzt. Wie eine gejagte Antilope! Und wie dürr du bist! Bist du krank? Oder hast du Liebeskummer?“
Blöde Frage. Cool bleiben. „Ach wo, mir geht es prima, alles bestens. Ich habe diesen Sommer so viele Triathlons abgespult wie noch nie. Bei mir läuft’s wie geschmiert.“ Ich dehne meinen Athletenbody und strecke die Arme der Waggondecke entgegen. „Und du hast dich nicht die Spur verändert. Du schaust immer gleich aus.“
War das als Kompliment gemeint – oder nicht? Ich habe meine Schwester, ungelogen!, genauso in meinem Bildgedächtnis gespeichert, wie sie höchstpersönlich vor mir sitzt: Ihre Haare sind straff aus der Stirn gekämmt und zum Oma-Dutt im Nacken festgeklammert, die hagere Figur versteckt sich vom Hals bis zur Wade in flattrigen Gewändern und das Schuhwerk ist rein funktional – um es neutral zu formulieren. Offen gesagt finde ich diese flachen Gesundheitstreter grottenhässlich. Wären Lenas Lippen nicht knallig rot geschminkt und die langen Fingernägel ebenso rot lackiert, hätte ich den Look meiner Schwester in die Rubrik verdorrte Gouvernante eingeordnet. Altjungfer Fräulein Rottenmeier lässt grüßen.
Sie lacht hell auf. „Ich hab mich nicht verändert? Warte nur ab, bis du meine Runzeln und Warzen im gnadenlosen Licht der Wahrheit zu Gesicht bekommst. Immerhin sind wir beide bereits Großtanten und vom irdischen Dasein gezeichnet.“
Was redet sie für wirres Zeug? Und was sage ich darauf? Mir fällt nichts Gescheites ein. Stattdessen erinnere ich mich, dass Lena seit jeher nervöse Anwandlungen hatte und diese mit schrulligen Bemerkungen zu überspielen versucht. Sie hat diese irritierende Manier, Gesprächsthemen zick-zack zu wechseln wie ein Feldhase auf der Flucht, wobei ihre Stimme jedoch unheimlich relaxed daherschmeichelt und seltsam süßlich klingt. Mir ist das zu verschroben.
„Apropos“, schlägt sie einen Haken, noch bevor ich etwas Kluges zum Thema Gezeichnetes Irdisches Dasein hätte äußern können, „hast du eine Ahnung, wie’s Zuhause geht und steht? Was ist morgen überhaupt im Detail geboten?“
Mit „Zuhause“ meint sie unser Elternhaus, also den Planckenhof mit seinen Bewohnern. Meine Besuche dort sind über die Jahre und Jahrzehnte zunehmend rarer geworden und wenn ich mal aufkreuze, dann ist die Stippvisite nach längstens einem halben Tag erledigt. Ansonsten bin ich über die Vorgänge auf dem Hof nur soweit informiert, wie sie in gelegentlichen Telefongesprächen mit einzelnen Familienmitgliedern eher zufällig und beiläufig angeschnitten werden. Zwischen Lena und den Blutsverwandten ist die kommunikative Lage ähnlich zundertrocken, schätze ich und sage:
„Zuhause? Wird schon alles passen. Ich habe keine Neuigkeiten gehört und denke mir, no news is good news. Zum morgigen Programm weiß ich nichts, außer dass Mammi und Dette ein lockeres Beisammensein am Bauernhof quasi angeordnet haben. Das Geburtstagskind will sich anscheinend nicht üppig hochleben lassen und hat keine Lust, in ein Gasthaus Essen zu gehen oder sonst wie auswärts auf die Pauke zu hauen. Du kennst ihn ja, unseren Oldie. Außerdem sieht er kaum mehr was, und hören tut er auch schlecht. Die Moral von der Geschicht’: Besser feiern wir Zuhaus.“
„Gut, dann lassen wir uns überraschen. Die Sonne lacht, da können die Kinder im Freien toben und es wird nicht zu eng in der Küche. Ah, wie ist das Wetter warm und schön!“, beginnt sie zu schwelgen. „Himmlisch! Köstlich! Magnifik!“
Will sie mich veräppeln? Wenn sie nicht bald dieses seichte Gesülze bleiben lässt, eise ich mich ehestens los für eine Laufeinheit über Stock und Stein im Wald und auf der Weide – Yes, Ma’am!
„Klaudia holt uns ab“, wechselt sie das Thema. „Wir sind da.“
Ich fange an, in meinem Rucksack zu kramen – wo ist meine Funktionsjacke? –, während Lenas Stimme zuckrig in meine Ohren rieselt: „Ich wollte heute vor meinem Abflug Mammi anrufen, um von der Front etwas Relevantes zu erfahren. Leider sie hat nicht abgehoben. Bei Klaudia hatte ich Glück, aber sie war gerade schwer beschäftigt und ich habe das Telefonat abgebrochen, weil ich sie nicht von der Arbeit abhalten wollte. Ob sie’s wohl zum Bahnhof schafft? Sonst stehen wir auf dem Trottoir gottverlassen in finsterer Nacht.“
„Das ist doch nicht tragisch. Wenn sie nicht da ist, gehen wir die paar Kilometerchen zu Fuß.“
„Süperbe Idee, die Beine vertreten nach der steifen Sitzerei.“ Lena schnappt sich den Griff ihres Kabinentrolleys, als wär’s ein Rettungsring, richtet sich entenlahmig auf, und ächzt und stöhnt wie ein ausgewrung’ner Jammerlappen. Sie ist deutlich größer als ich und hat dabei nicht einmal Schuhe mit Absätzen an den Fersen. Sie war immer größer als Bernadette und ich. Wie können die Gene bloß so unfair verteilt sein.