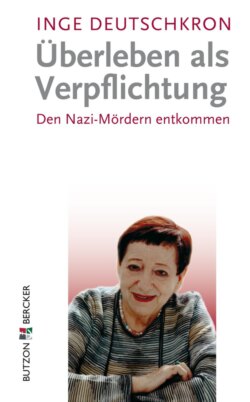Читать книгу Überleben als Verpflichtung - Inge Deutchkron - Страница 6
Kurzbiographie – Ein Todesurteil und vier Leben
ОглавлениеSie sagte es schnell und sehr bestimmt: „Frau Deutschkron. Sie und Inge dürfen sich nicht deportieren lassen!“ Dabei hielt Emma Gumz die Hände meiner Mutter fest umklammert, so als wollte sie ihrer Forderung mehr Nachdruck verleihen. Meine Mutter sah sie verstört an, fragte schließlich erregt, wie dies denn zu verstehen sei. Da antwortete die kleine Frau, die jahrelang unsere Wäsche gewaschen hatte: „Der Fritz, unser Nachbarsjunge, ist als Soldat in Polen gewesen. Er hat gesehen, was sie dort mit den Juden machen.“ Und rasch fügte sie hinzu, daß ihr Mann und sie uns davor bewahren wollten. Das war im November 1942 gewesen. Ich war gerade 20 Jahre alt, als diese Frau die Vollstreckung des mir zugedachten Todesurteils auf ihre Weise zu verhindern suchte.
Dabei hatte alles so normal angefangen. Ich war 1922 in der kleinen Stadt Finsterwalde geboren worden. Als mein Vater meiner Mutter seine Versetzung an das dortige Gymnasium mitteilte, suchte sie den Ort vergebens auf ihrem Schulatlas. Finsterwalde würde nur eine Station in seiner Beamtenlaufbahn sein, beruhigte sie mein Vater, die mit einer Pension am Ende seiner Karriere so viel Sicherheit versprach. Auch für das Kind Inge schien der Weg vorgezeichnet zu sein – höhere Schulbildung, Universität, möglicherweise Doktortitel. Als ich vier oder fünf Jahre alt war, wurde mein Vater nach Berlin versetzt, wo er als Studienrat in einem Gymnasium im Wedding lehrte.
Ich mußte mich nun an die Großstadt gewöhnen. Mit der Kleinstadtidylle war es vorbei. Ich durfte nicht mehr auf der Straße mit anderen Kindern spielen. In den Straßen der Großstadt lauerten zu viele Gefahren für ein kleines Mädchen, meinten meine Eltern. Sie erlaubten mir auch nicht, Rad fahren zu lernen. Der Großstadtverkehr sei dafür zu rasant. Doch Berlin hatte für mich manches andere zu bieten. Da gab es den nahen Friedrichshain mit dem Märchenbrunnen und den jedem Kind vertrauten Figuren. Dann war da der Tennisplatz, wo ich meine ersten Lorbeeren als Balljunge verdiente, wenn meine Eltern ihre Matches spielten – im Tennis-Rot natürlich, einer Abteilung des Arbeitersportbundes, wie es ihrer politischen Einstellung entsprach. Und da war die von Maschinen betriebene Eisbahn, auf der ich sogar noch in lauen Sommermonaten meine Pirouetten drehen konnte. Meine Mutter blähte sich vor Stolz, wenn Zuschauer am kleinen Mädchen im roten Mäntelchen Talent entdeckten und ihm eine große Zukunft auf dem Eis voraussagten. Das aber enthüllte sie mir erst viel später, als mir der Besuch von Sportstätten als Jüdin untersagt war. Noch störte nichts diese Idylle.
Doch dann klirrte Glas. Und das geschah immer öfter. Es war meist das Fenster meines zur Hufelandstraße gelegenen Zimmers, auf das die Nazis Steine warfen. Natürlich hatte ich Angst. Aber meine Mutter verstand es, mich zu beruhigen. Die Leuchttransparente und Fahnen auf unserem Balkon, mit denen meine Eltern während der Wahlkämpfe jener Jahre um Wählerstimmen für die Sozialdemokratische Partei warben, reizten die Nazis zu solch kriminellen Handlungen. Mein Vater stellte seine ganze Freizeit in den Dienst dieser Partei. Er sprach in öffentlichen Versammlungen gegen die Nazis, warnte die Berliner vor Hitler, dieser werde nur Krieg und Verderben bringen, ließe man ihn an die Macht. Ein Mitbewohner unseres Hauses wurde eines Nachts in unserem Hausflur angeschossen. Die Kugel sollte eigentlich meinen Vater treffen. Aber auch das hielt ihn nicht von seinen politischen Aktivitäten ab. Viele Jahre später, als mein Vater bereits im Ausland war, gestand ich meiner Mutter, daß ich vor dem Einschlafen immer auf Geräusche im Treppenhaus gehorcht hatte. Hallende Tritte von Stiefeln, wie sie die Hitler-Schergen zu tragen pflegten, verband ich mit Gefahr für meinen Vater.
Die politische Überzeugung meiner Eltern teilte sich mir natürlich mit. Meine Eltern legten Wert darauf, daß ich wußte, was sie taten, und warum sie es taten. Ich bin ganz sicher, daß ich 1933 als Zehnjährige besser wußte, wer Hitler war und welche Ziele die Nazis verfolgten, als manche erwachsene Bürger dieses Landes. Zu meinen schönsten Kindheitserinnerungen gehört nicht irgendeine Ferienreise oder ein kindliches Vergnügen, sondern die Tatsache, daß ich gemeinsam mit den politischen Freunden meiner Eltern in einem verräucherten Hinterzimmer einer Kneipe sitzen und helfen durfte, Flugblätter gegen die Nazis zu falten. An der Hand meiner Mutter ging ich auch in Demonstrationen mit. Im Berliner Lustgarten fühlte ich mich ebenso zu Hause wie auf dem Spielplatz im Friedrichshain.
„Wir sind Juden, Inge“, sagte meine Mutter eines Tages im April 1933 zu mir. Ich hatte keine Ahnung, was sie mir da sagte. Ich war mit Weihnachtsbaum und Ostereiern aufgewachsen und wußte nichts über Judentum oder jüdische Religion. Es gab in unserem Haus weder Kultgegenstände, noch hingen meine Eltern an Traditionen jüdischen Ursprungs. Ich wußte noch nicht einmal, was eine Religion ist, denn ich hatte eine weltliche Schule besucht, in der dieses Fach nicht gelehrt wurde. Doch an jenem Tag wollte ich meinen Eltern keine weiteren Fragen stellen, denn ich spürte, daß sie andere Sorgen hatten. Ein Satz indes, den meine Mutter dieser für mich so überraschenden Eröffnung hinzufügte, blieb in meinem Gedächtnis haften. Ja, er wurde zum Leitmotiv meines Lebens: „Auch wenn du jetzt zu einer Minderheit gehörst, laß’ dir nichts gefallen. Wehr dich, wenn du angegriffen wirst.“ Schließlich sei ich auch als Jüdin anderen Kindern ebenbürtig.
„Wir sind Deutsche“, betonte mein Vater immer wieder, auch wenn die Nazis Juden nicht als solche anerkennen wollten. „Deutsch ist unsere Sprache, deutsch unsere Kultur!“ Und er wies weiter darauf hin, daß unsere Familie nachweislich seit vielen Generationen in Deutschland ansässig sei und er und seine zwei Brüder im Ersten Weltkrieg als Freiwillige in der deutschen Armee gekämpft hätten. Darum gab es für uns auch keinen Grund auszuwandern. Meine Eltern hielten es aber für richtiger, Manuskripte meines Vaters, Schriften, ja sogar Bücher mit sozialistischem Inhalt zu verbrennen oder in den Hintergrund des Bücherschranks zu verbannen. Verhaftungen von Gesinnungsgenossen verstörten sie natürlich. Sie beschlossen dann auch, den 1. April 1933, den Tag des Boykotts jüdischer Geschäfte, nicht zu Hause zu verbringen. Mit den Worten, dies sei nur so eine Vorsichtsmaßnahme, spielten meine Eltern den Besuch bei Tante und Onkel Hannes in Spandau mir gegenüber herunter. Ich glaubte ihnen aufs Wort. Sie hatten mich noch nie belogen.
Kurz darauf wurde mein Vater seiner politischen Tätigkeit wegen aus dem Staatsdienst entlassen. Das traf ihn ins Mark. Aber dennoch blieb er zuversichtlich. Und er war nicht der einzige. Höchstens drei Monate würde dieser Hitler an der Macht bleiben. So schwadronierten die Männer, die wie mein Vater wegen ihrer führenden Rollen in demokratischen Parteien oder Gewerkschaften arbeitslos geworden waren. Es sei doch nicht denkbar, daß das deutsche Volk diesen Verbrecher auf Dauer dulden würde. Mit dieser Prognose endeten die meisten ihrer Diskussionen zur Lage. Sie saßen in jenen Frühlingstagen des Jahres 1933 in Schrebergärten untätig herum. Sie hatten längst resigniert. Demokratische Einrichtungen waren geschlossen, führende Funktionäre ihrer Organisationen verhaftet und in Konzentrationslager eingewiesen worden. Berichte über deren grausame Behandlung ließen Wagemut nicht zu.
Ein Einschnitt in meinem Leben war der Übergang in die höhere Schule, der gerade am 1. April 1933 fällig war. Außer mir besuchten noch einige jüdische Mädchen die gleiche Klasse. Das wußte ich nur vom gemeinsamen Religionsunterricht, der nun Pflicht geworden war. Gelegentlich fühlte ich mich verpflichtet, für sie einzutreten. Zwei von ihnen waren kleiner und schwächer als die anderen und waren häufig Ziel von Spott und Demütigungen. Da in der weltlichen Schule – revolutionär für diese Zeit – Jungen und Mädchen gemeinsam unterrichtet worden waren, hatte ich gelernt, wie man sich wirkungsvoll zur Wehr setzt. Die Angreifer ließen schnell von mir ab, wenn ich mit meinen Fäusten drohte. Der Rat meiner Mutter, mir nichts gefallen zu lassen, bewährte sich.
Die Nürnberger Rassegesetze von 1935, die es u. a. Juden und Nichtjuden verboten zu heiraten, führten die Schulbehörde dazu, jüdischen Schülern die Teilnahme an Ausflügen, am Schwimmunterricht, am Besuch von Landschulheimen zu untersagen. Umkleidekabinen wurden getrennt – für jüdische und nichtjüdische Schüler. Mein Vater fand diese Art der Diskriminierung nicht gut für ein Kind und meldete mich in der Jüdischen Schule in der Großen Hamburger Straße an. Ich weiß noch, wie mich diese Schule verwirrte. Tausende jüdischer Schüler strömten nun in die wenigen jüdischen Schulen der Stadt. Und so war es nicht zu verwundern, daß wir oft mehr als 50 Schülerinnen in einer Klasse waren. Ein geordneter Lehrbetrieb war unter diesen Bedingungen kaum möglich. Unter Lehrern und Schülern herrschte ein ständiges Kommen und Gehen. Einige wanderten aus. Lehrer verschwanden, waren verhaftet worden. Manchen Vater traf ein ähnliches Schicksal. Schüler und Lehrer waren nervös. Sollte man auswandern, sollte man bleiben? War ein menschenwürdiges Dasein in Deutschland überhaupt noch möglich? Die Schule tat alles, um uns auf eine mögliche Auswanderung vorzubereiten. Sie bot vermehrten Unterricht in Fremdsprachen an, lehrte uns Stenographie und Schreibmaschine schreiben, Kochen und Nähen. Das ging natürlich auf Kosten traditioneller Fächer. Chemie, Physik, Mathematik blieben mir fremde Wissenschaften. Ohne diese Kenntnisse habe ich bis heute problemlos gelebt. In Geschichte und Literatur bedauere ich meine Lücken. Große Freude bereiteten uns Sportfeste, die jüdische Schulen auf einem eigens dafür gemieteten Sportplatz im Grunewald veranstalteten. Das waren Ereignisse, denen wir entgegenfieberten. Die Erinnerung an diese Stunden auf dem Sportplatz ist die einzige wirklich angenehme Erinnerung an meine Schulzeit. Dort schüttelten wir alles uns Bedrückende ab. Wenn wir jedoch zur Rückkehr in die S-Bahn einstiegen, war diese gelöste Atmosphäre schnell wieder dahin. Wir achteten sorgsam und nicht ohne Ängstlichkeit darauf, kein Aufsehen, geschweige denn Anstoß zu erregen. Wenn eine von uns zu laut lachte, dann wurde sie von den anderen zurechtgewiesen. Auch wenn wir nicht darüber sprachen, ahnten wir doch, daß wir von den Mitreisenden als jüdische Kinder erkannt und angepöbelt werden konnten.
Meine Eltern versuchten, alles Demütigende zu ignorieren oder es mit Lachen abzutun. Dabei halfen ihnen die alten Freunde, die jeden Witz über die Nazis wie eine Offenbarung über deren Unfähigkeit aufnahmen. Herr Gumz, der die Schmutzwäsche zu holen und die saubere Wäsche zu liefern pflegte, hatte immer neue Witze parat, die er bei seinen Kunden zu hören bekam. Dazu gehört eine Begebenheit, die als Wahrheit in Berlin verbreitet wurde. Im Rahmen einer Naziveranstaltung sei ein Teilnehmer aus dem Publikum aufs Podium gebeten worden, um am Beispiel seines Ohres die rein arische Abstammung zu verdeutlichen. Der Versammlungsleiter ahnte nicht, daß der, den er aufs Podium gebeten hatte, Jude war.
Als mich tatsächlich ein Fotograf entsprechend der Nazitheorie aufforderte, mein linkes Ohr freizumachen, damit der Unterschied zwischen einem semitischen und einem arischen Ohr auf dem Foto deutlich sichtbar wurde, war ich den Tränen nahe. Ich war damals 16 Jahre alt und wie jedes junge Mädchen eitel. Dieses Foto war für eine Kennkarte bestimmt, auf der auch unsere Fingerabdrücke abgedruckt wurden, um so das Kriminelle als Wesensmerkmal des Juden sogleich kenntlich zu machen. Diese Kennkarte enthielt auch zum ersten Mal die für uns vorgeschriebenen Zusatznamen, Sara für Frauen, Israel für Männer, die zwischen Vor- und Zunamen eingefügt werden mußten. Und wieder versuchte mein Vater, diese Verordnung ins Lächerliche zu ziehen, indem er feststellte, er habe nun zwei „Zores“ in Abwandlung des Namens Sara. Zores oder Zaroth bedeutet auf Hebräisch „Sorgen“. Immer wieder führten meine Eltern mir vor, wie sie mit dem gegen sie gerichteten Unrecht fertig zu werden verstanden. Als die Nazis anordneten, daß Juden ihr Gold und Silber abzuliefern hätten, suchten meine Eltern alle kaputten, verbeulten und verbogenen Gegenstände für die Abgabe zusammen. Von unseren nichtjüdischen Freunden, den Riecks, den Garns, den Ostrowskis, erbaten wir ähnliches, um die Menge der abzuliefernden Gegenstände zu vergrößern und glaubhafter zu machen. Unser Familiensilber nahmen unsere „Aufbewahrier“ zu sich, wie wir diese Freunde nannten. Das alles ging unter großem Gelächter vor sich. In dieser Atmosphäre wuchs ich auf.
Der Wendepunkt kam am 9. November 1938, als die Nazis das erste staatlich organisierte Pogrom inszenierten. Sie nahmen dafür den Mord eines jungen Juden an einem deutschen Diplomaten zum Vorwand. Jetzt begannen die deutschen Juden, die Wirklichkeit zu begreifen. Selbst mein Vater verstand nun, daß ein Jude nicht mehr in Frieden in Deutschland würde leben können. Aber das Auswandern war schwerer geworden. Das Ausland sträubte sich gegen die Aufnahme mittellos gewordener Menschen, obwohl ihnen die Verfolgung der Juden in Deutschland nicht verborgen geblieben sein konnte. England und Schweden nahmen Kinder ohne Eltern auf. Ich lehnte ein solches Ansinnen ab. Ich war viel zu sehr mit meinen Eltern verbunden.
Mein Vater hatte großes Glück. Eine englische Kusine überwies der Britischen Bank eine hohe Summe Geldes als Garantie dafür, daß mein Vater bei einer Einwanderung nicht dem englischen Staat zur Last fallen würde. Sie konnte dies nur für einen von uns tun. Mein Vater verließ Berlin am 19. April 1939. Wenig später ließ er uns wissen, daß er für meine Mutter und mich Arbeitsstellen in einem englischen Haushalt gefunden habe. Wir bemühten uns um unsere Ausreise. Aber es war schon zu spät. Am 1. September 1939 brach der Zweite Weltkrieg aus. Mein Vater war in England und meine Mutter und ich in Berlin. Und das blieb so sieben Jahre lang.
Ich war 17 Jahre alt, als unsere Schule geschlossen wurde. Die Nazis hatten für uns Mädchen das Jüdische Kindergärtnerinnenseminar im Grunewald als einzige Ausbildungsstätte bestehen lassen. Ich begann dort mit einem Kurs als Kinderpflegerin. Kurz nach Kriegsbeginn sperrten die Nazis die Pension meines Vaters mit der Begründung, er lebe nun im feindlichen Ausland. Das war das Ende meiner Ausbildung. Ich mußte Geld verdienen. Als Jüdin hatte ich die Wahl zwischen Arbeit in einer Fabrik und in einem jüdischen Haushalt. Ich zog letzteres vor. Aber auch das wurde nach einem Jahr verboten. So blieb mir nur die Arbeit in einer Fabrik.
In einem speziell für Juden eingerichteten Arbeitsamt wurde Juden Arbeitsstellen zugewiesen in Munitionsfabriken, auf Rieselfeldern, in der Straßenreinigung, im Straßenbau. Das Unglück wollte es, daß ich zu IG-Farben vermittelt wurde, und zwar in deren Seidenspinnerei für Fallschirme ACETA in Lichtenberg. Diese Fabrik war für ihre schlechte Behandlung von Juden berüchtigt. Im Büro drückte man mir einen Judenstern in die Hand, der am Arbeitskittel zu befestigen war, mit den Worten: „Wehe, wenn du den vergißt!“ Amtlich war diese Kennzeichnung noch nicht verordnet worden. Wir jüdischen Frauen waren weitgehend isoliert. Jeder Kontakt zu nichtjüdischen Arbeitern wurde verhindert. Eine arische Vorarbeiterin, die uns in die Arbeit einzuführen hatte, wahrte immer einen Meter Abstand, wenn sie mit einer von uns sprach. Zehn Stunden mußten wir aufpassen, daß sich der Faden auf den rotierenden Spulen nicht verhedderte, abriß oder die Spindeln nicht leerliefen. Wir hatten einen eigenen Frühstücksraum, in dem zwar ein Tisch stand, Sitzgelegenheiten aber fehlten. Während der Pause gab es unter den Frauen nur ein Gesprächsthema: Wie kommen wir hier wieder raus? Frauen, die schon länger dort arbeiteten, berichteten, daß es einigen Frauen gelungen wäre, entlassen zu werden. Unterleibskrankheiten wären ein Grund, der akzeptiert würde. Sie machten stundenlanges Stehen an der Maschine unmöglich. Auch ich wäre dieser Fabrik gern entronnen. Doch ich wußte nicht, wie. Ich war 19 Jahre alt und kerngesund. Eines Tages kam mir die rettende Idee. Ich trug zur Arbeit Schuhe mit den höchsten Absätzen, die ich je besessen hatte. Zehn Stunden an der Maschine stehen, drei in der Straßenbahn vom und zum Arbeitsplatz – Juden war das Sitzen in öffentlichen Verkehrsmitteln untersagt –, da wurden die hohen Absätze zur Tortur. Nach drei Tagen konnte ich mein rechtes Knie nicht mehr bewegen. Ein nichtjüdischer Arzt hatte den Mut, mir zu attestieren, daß ich für stehende Arbeit untauglich sei. Ich wurde krankgeschrieben. Dann folgte eine Aufforderung zum Betriebsarzt: „Ziehen Sie die Schlüpfer aus!“, befahl er und wies auf einen Untersuchungsstuhl. Ich sagte, daß es sich um mein Knie handelte. Er gab mir mit einer Handbewegung zu verstehen, daß ihn das nicht interessiere. Nach einer peinlichen und nicht gerade schmerzfreien Untersuchung empfahl er meine Entlassung. Die IG-Farben-Krankenkasse sei nicht gewillt, weiter für mich Krankengeld zu zahlen.
Trotz der Demütigung war ich selig. Und ich hatte allen Grund dazu. Ein glücklicher Zufall wollte es, daß ich Otto Weidt kennenlernte, der in der Rosenthaler Straße 39 eine Werkstatt zur Produktion von Besen und Bürsten betrieb. Weidt, der praktisch blind war, beschäftigte fast ausschließlich blinde und taubstumme Juden. Für mich und zwei weitere sehende Juden fand er Aufgaben in seinem Büro, was streng verboten war. Otto Weidt haßte die Nazis. Er tat alles, was in seinen Kräften stand, um seinen Arbeitern zu helfen – mit Lebensmitteln, die Juden nur in sehr begrenztem Umfang zugeteilt wurden, mit Tabak und Gebrauchsartikeln, die er gegen die in seiner Werkstatt produzierten Besen und Bürsten eintauschte. Und schließlich benutzte er die auf diese Weise erstandenen Waren, um sich der Gunst der Gestapo zu versichern, die alle Betriebe, in denen Juden beschäftigt wurden, unter Kontrolle hielt. Daraus wurde eine Beziehung, die für uns wie für ihn von größter Bedeutung werden sollte. Ein den Eingang überwachendes Lehrmädchen machte uns durch eine Klingel auf nicht angekündigte Besuche von Gestapobeamten aufmerksam, wie etwa vom stellvertretenden Leiter des Judenreferats Prüfer. Wir flohen dann aus dem Büro in ein Versteck im Treppenhaus, während zwei nichtjüdische Angestellte unsere Plätze einnahmen. Das war alles viele Male geübt worden. Von unseren Verstecken aus hörten wir, wie Weidt den Prüfer liebenswürdig begrüßte, ihn durch den Betrieb führte, in dem er die „Saujuden“, wie er uns bei solchen Gelegenheiten nannte, zu arbeiten gelehrt hatte. Für uns endete so ein Besuch mit einem Glas Wein und viel Gelächter. An die Blinden verteilte Weidt Zigaretten zum Trost für die ausgestandene Angst.
Ich ging gern in die Blindenwerkstatt. Wie alle, die dort arbeiteten, verehrte ich Otto Weidt, der uns nicht nur praktische Hilfe leistete. In der Art, wie er uns zur Seite stand, gab er uns ein Stück Selbstachtung zurück. Ja, er tat etwas für jene Zeit Unglaubliches: Er behandelte uns wie Menschen, kam uns mit Respekt entgegen, half uns, uns aufzurichten, sann mit uns über Auswege aus schwierigen Situationen nach, wußte immer wieder Rat.
Vom Beginn des Krieges an dachten sich die Nazis fast täglich neue Gesetze und Verordnungen aus, mit denen sie uns das Leben erschwerten. Wir durften keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr benutzen, mußten nach acht Uhr abends zu Hause sein, bekamen keine Seife zugeteilt, durften nicht zum Friseur gehen, mußten zwischen vier und fünf Uhr nachmittags unsere Einkäufe tätigen, durften unsere Wäsche nicht waschen lassen und vieles mehr. Daß die Gumzens das Verbot, die Wäsche von Juden zu waschen, mißachteten, brauche ich wohl kaum hervorzuheben. Zu den Verordnungen gehörte auch, daß wir in sogenannte Judenhäuser eingewiesen wurden, in denen sich jeweils zwei Personen ein Zimmer teilen mußten. In diesen Wohnungen lebten Menschen zusammen, die von Not und Angst getrieben wurden, was wohl am nächsten Tag auf sie zukommen würde und ob sie die Kraft haben würden, damit fertig zu werden. Gerüchte machten die Runde.
Hinzu kam die Sorge um Angehörige im Ausland – Kinder, Ehemänner, Eltern –, von denen sie durch den Krieg abgeschnitten waren. Die Atmosphäre in dieser Wohnung war schier unerträglich.
Ich erklärte eines Tages meiner entsetzten Mutter, daß ich dieser Atmosphäre hin und wieder zu entfliehen und das Verbot zu brechen gedachte, das Juden den Besuch von Theatern, Konzerten und Kinos untersagte. Ich brauchte diese zwei, drei Stunden Ablenkung, um neue Kraft zu schöpfen und weiteren Quälereien mit relativem Gleichmut begegnen zu können. Dazu mußte ich den im September 1941 verordneten Judenstern abnehmen, den jeder Jude vom 6. Lebensjahr an an seinem äußeren Kleidungsstück zu befestigen hatte. Eine dieser perfiden Anordnungen, die uns vogelfrei machte. Auf der Straße sah uns jeder an, einige mit Haß, wenige freundlich, die Mehrzahl sah durch uns durch, aber sie sahen uns an. So verließ ich am Abend unser Haus mit dem Judenstern an der Jacke. In einem dunklen Hausflur tauschte ich diese mit einer ohne Stern, die ich in einer Tasche mit mir trug. Auf dem Heimweg mußte ich die Jacken noch einmal wechseln, denn ohne den Stern konnte ich unser Haus nicht wieder betreten. Als großen Triumph empfand ich es, daß ich meine Mutter zu einem uns verbotenen Spaziergang in den Grunewald überreden konnte.
Im Oktober 1941 begannen die Deportationen jüdischer Menschen aus Berlin „in den Osten“, wie wir in Unkenntnis des wahren Ziels zu sagen pflegten. Noch ahnten wir nicht, daß wir alle zum Tode verurteilt waren und daß die Transporte der Vollstreckung dieser Todesurteile entgegenfuhren. Einer von Weidts Blinden war für einen der ersten Transporte vorgesehen. Weidt eilte zur Gestapo und forderte die Rücknahme dieser Maßnahme. „Wie soll ich denn meine Wehrmachtsaufträge ausführen, wenn man mir meine Arbeiter wegnimmt?“, trumpfte er auf. Ein Argument, das er mit einem passenden Geschenk für den Gestapobeamten unterstützte. Und es wirkte. Der alte Levy wurde wieder frei, wie verschiedene andere nach ihm. Ja, es gelang Weidt noch im Herbst 1942, alle seine Blinden persönlich wieder aus dem Sammellager abzuholen, die am Morgen unerwartet aus der Werkstatt abgeführt worden waren. Doch er warnte damals: „Das war das letzte Mal!“ Es schien ihm kein Zweifel mehr darüber zu bestehen, daß die Nazis entschlossen waren, alle Juden aus Berlin „in den Osten“ zu deportieren. Otto Weidt konzentrierte sich nun darauf, Verstecke zum Untertauchen zu finden. In der damaligen Neanderstraße mietete er einen Laden, den er als Nebenlager seiner Werkstatt deklarierte. Hinter aufgeschichteten Besen versteckte er die Familie Licht. Für Chaim Horn und seine dreiköpfige Familie trennte er den letzten Raum der wie ein Schlauch angelegten Werkstatt ab, indem er einen Kleiderschrank vor die Tür schieben ließ. Darin hingen Kleider und Mäntel, schob man sie beiseite, wurde offenbar, daß er keine Rückwand hatte. So konnte das Versteck von Familie Horn betreten werden. Ein Versteck übrigens, das im Originalzustand in der Ausstellung „Blindes Vertrauen“ in der Rosenthaler Straße 39 zu besichtigen ist. Auch die blinde Marianne Bernstein und ihre Zwillingsschwester brachte Weidt unter. Das waren nur einige von denen, die Weidt zu beschützen übernahm und von denen ich wußte. Nicht alle überlebten.
Als meine Mutter und ich uns mit dem Gedanken vertraut machten, ebenfalls unterzutauchen, versprach Otto Weidt mir, daß ich bei ihm weiterarbeiten könnte. Er würde versuchen, dies zu legalisieren. Und tatsächlich händigte er mir eines Tages ein Arbeitsbuch aus, das auf den Namen Gertrud Dereszewski ausgestellt war. Jene Frau Dereszewski verkaufte ihr Arbeitsbuch, weil sie keine Lust hatte, in einer Fabrik zu arbeiten, wie es für Frauen bis zum 55. Lebensjahr vorgeschrieben worden war. Sie zog es vor, weiter im von den Nazis untersagten „ältesten Gewerbe“ tätig zu sein. Gertrud Dereszewski, deren Namen ich nun annehmen mußte, wurde beim Arbeitsamt und bei der Krankenkasse als Arbeiterin der Blindenwerkstatt Otto Weidt angemeldet. Ich erhielt einen entsprechenden Ausweis. Leider war meine Legalität nicht von langer Dauer. Gertrud Dereszweski fiel der Polizei in die Hände (Prostitution war untersagt). Weidt mußte sie offiziell entlassen. Trotzdem erlaubte er mir, bei ihm weiterzuarbeiten.
Um ein Versteck für meine Mutter und mich brauchte Weidt sich nicht zu kümmern. Der Initiative von Emma Gumz, uns verstecken zu wollen, folgten andere nichtjüdische Freunde. Sie alle hatten den Kontakt zu uns nie abgebrochen, obwohl dies für sie nicht ungefährlich war. Selbst, als wir gezwungen wurden, einen Judenstern an unserer Wohnungstür anzubringen, kamen sie, brachten Lebensmittel und versicherten uns, daß wir auf sie rechnen könnten.
„Ich bin ja so stolz, daß ich Sie dazu überreden konnte.“ Mit diesen Worten empfing uns Frau Gumz, als meine Mutter und ich am 15. Januar 1943 in ihrer Wäscherei in der Knesebeckstraße 17 untertauchten. Sie teilte uns ein Kabuff, wie sie es nannte, hinter ihrem Laden zu. In ihrem Laden gingen so viele Menschen ein und aus, daß wir gar nicht auffallen würden, meinte sie. Doch nach einiger Zeit erkundigte sich eine Nachbarin neugierig, wer denn der Besuch sei, der nun schon mehrere Wochen bei Gumzens wohne. Es schien uns geraten, schleunigst aus diesem ersten Versteck zu verschwinden. Die Gefahr, daß die Nachbarin Verdacht geschöpft hatte und ihn auch der Polizei melden würde, war zu groß. Frau Gumz weinte, als wir sie verließen, machte sich laut klagend Vorwürfe, daß sie entgegen ihren Absichten doch nicht die Kraft aufgebracht hatte, zu unserer Rettung entscheidend beizutragen.
Wir waren gerade sechs Wochen im Versteck, als die Nazis alle noch in Berlin befindlichen Juden abholten. Sie zerrten sie aus ihren Wohnungen, sie griffen sie auf der Straße auf, sie fanden sie auf ihren Arbeitsstellen in den Fabriken. Diese letzte große Razzia am 27. Februar 1943 ist darum auch als „Fabrikaktion“ in die Geschichte der Judenverfolgung Berlins eingegangen. Ich wurde Zeugin dieser Aktion. Verzweifelt über meine Ohnmacht sah ich hinter einer Gardine zu, wie man diese Menschen auf den letzten Weg brachte, einen Weg, dem ich nur durch den Mut und die Risikobereitschaft einiger Berliner entronnen bin.
Es ergab sich des öfteren, daß uns ähnliche Vorfälle wie bei den Gumzens zwangen, in großer Eile aus einem Versteck zu fliehen. Meine Mutter fand sich schwer in diese Situation des ständigen Fliehen-Müssens ein. Aber immer wieder redeten ihr die Freunde gut zu, beschworen sie durchzuhalten, wiesen auf die sich verschlechternde Kriegslage Nazi-Deutschlands hin und fanden neue Unterkünfte. Oft war das neue Versteck nur ein Provisorium, bis ein besseres gefunden werden konnte. Mal schliefen wir auf den Lehnen umgekehrter Sessel in einem Wohnzimmer, mal auf einem Matratzenlager hinter einem Ladentisch. An Wochenenden kampierten wir in einem Bootshaus in Schildhorn oder in einer Laube in Drewitz. Es fand sich auch mal ein Versteck, in dem wir uns längere Zeit sicher fühlen konnten. Es wurde durch Bomben zerstört. Als ausgebombte Berliner fielen wir im bis kurz vor Kriegsende unzerstörten Potsdam nicht auf. Ein ehemaliger Ziegenstall, von den Behörden als unbewohnbar eingestuft, diente uns längere Zeit als perfektes Versteck. Dabei ständig betreut von unseren Freunden, die auch für unsere Ernährung sorgen mußten. Da auch dies im Verlauf des Krieges immer schwieriger wurde, übte ich mich im Stehlen – Kohlköpfe von den Feldern im Umland von Berlin oder Wurst und Käse in einem Milchgeschäft, in dem ich ohne Angaben über meine Person tageweise aushalf. Ich betätigte mich im Schwarzhandel, ich tauschte rares Briefpapier aus dem Papiergeschäft, in dem ich arbeitete, gegen Naturalien. Schließlich zwang uns die Lage zu einem neuen Wagnis. Wir fuhren in die Nähe der Front, die sich bereits auf deutschem Boden befand, mischten uns unter verschreckte Menschen, die vor den sowjetischen Truppen geflohen waren, und kehrten als Flüchtlinge aus Guben nach Berlin zurück. Als Ella Paula und Inge Elisabeth Marie Richter meldeten wir uns in Berlin an und wurden von der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt großzügig betreut. Das Kriegsende erlebten wir als legale Bürger in unserem Ziegenstall in Potsdam.
Mein begeisterter Empfang des ersten sowjetischen Soldaten, den ich zu Gesicht bekam, hätte beinahe fatale Folgen gehabt. Frauen waren in den Augen sowjetischer Soldaten Freiwild. Ich mußte mich noch einmal verstecken. Nur einmal durfte ich einem russischen Soldaten jüdischer Herkunft meine wahre Identität offenbaren. Der aber, wohl angetan von dem jungen Mädchen, wollte gleich Chasane (Hochzeit) mit mir machen. Als ich vorgab, sein Jiddisch nicht zu verstehen, zog er seine Pistole und brüllte, es sei alles gelogen. Ich sei gar keine Jüdin. Mit viel List entkam ich diesem unsympathischen Zwischenspiel. So endete mein erstes Leben.
Es dauerte einige Zeit, bis ich begriff, daß ich frei war, frei – der Vollstreckung des Todesurteils entkommen. Und das verdanke ich einzig und allein der mutigen, aufopfernden Hilfe unserer Freunde, die es möglich machten, daß meine Mutter und ich zwei Jahre und vier Monate in Verstecken überleben konnten: Lisa Holländer, Otto Ostrowski, Grete Sommer, Walter Rieck, Klara Grüger, Theodor Görner, Käthe Schwarz, Paul Garn und die bereits genannten Emma Gumz und Otto Weidt.
Das sind die Namen der wichtigsten unserer Helfer. Ich bezeichne sie als Helden. Es waren Menschen, die es nicht ertrugen, untätig zuzusehen, wie eine von den Nazis als Verbrecher eingestufte Minderheit ihren Mördern ausgeliefert wurde. Sie handelten, wie ihr Gewissen es ihnen eingab, und dachten dabei nicht an die Gefahren, in die sie sich begaben. Sie taten Großes, ohne sich dessen bewußt zu sein. Menschlichkeit war ihnen oberstes Gebot. Ich bin dankbar dafür, daß der Staat Israel sie als „Gerechte der Völker“ anerkannt und ausgezeichnet hat. Die Staatsorgane dieses Landes haben sie bis heute weder beachtet noch geachtet.
Mein zweites Leben begann fast so spektakulär, wie das erste geendet hatte. Es dauerte nach Kriegsende noch drei Monate, bis es uns gelang, Kontakt zu meinem Vater in England aufzunehmen. Post und Telefon blieben noch lange Zeit unterbrochen. Ein englischer Soldat half uns mit einem Brief an meinen Vater über seine Feldpost. Und dann mußten wir noch ein weiteres Jahr warten, bis uns ein britisches Konsulat die Einreisevisen nach England erteilte. Dieses Jahr überbrückte ich als Sekretärin in der „Zentralverwaltung für Volksbildung für die sowjetisch besetzte Zone“. Diese Tätigkeit begann so hoffnungsvoll. Ein jeder, der dort arbeitete – Menschen, die aus dem Exil zurückgekommen waren oder ein KZ überlebt hatten –, kannte nur ein Ziel: mitzuhelfen, ein anderes, ein neues Deutschland aufzubauen. Das ging solange gut, bis die Politik sie einholte. Die Kommunisten, die davon überzeugt gewesen waren, daß dieses von den Nazis befreite Deutschland ihnen wie eine reife Frucht in den Schoß fallen würde, sahen sich getäuscht. Da versuchten sie, die Sozialdemokraten, die in Berlin und im Osten Deutschlands in der Gunst der Wähler vorne lagen, für sich zu gewinnen. Sie griffen den alten Traum von der Einheit der Arbeiterklasse auf und nahmen ihn als Vorwand, um die Sozialdemokraten in ihre Reihen zu zwingen und mit Hilfe ihrer Wählerstimmen an die Macht zu gelangen. Diese tödliche Umarmung der Sozialdemokraten konnten sie in der sowjetisch besetzten Zone mit den Bajonetten der sowjetischen Armee verwirklichen.
Ich war, für meine Herkunft verständlich, in die neu gegründete Sozialdemokratische Partei eingetreten und avancierte zur Vorsitzenden der kleinen Betriebsgruppe SPD in dieser Verwaltung. Ohne Scheu und Zögern wandte ich mich gegen die Strategie der Kommunisten. Ich erklärte, ich hätte wahrlich nichts gegen die Einheit der Arbeiterbewegung, wohl aber etwas dagegen, wenn sie auf undemokratische Weise von oben diktiert durchgeführt werden sollte. Die Vorstellung, daß jemand erneut die kaum errungene Freiheit und die neue demokratische Ordnung untergraben könnte, erschien mir nach den Erfahrungen der schrecklichen Jahre unter der Nazidiktatur unerträglich. Und so bekämpfte ich offen jede Regung, die in diese Richtung zu deuten schien. Ich tat dies mit der ganzen Naivität meiner Jugend und meiner politischen Unerfahrenheit.
Das brachte mir ein Gespräch mit dem in der Verwaltung ansässigen Vertreter der sowjetischen Militäradministration ein. Liebenswürdig empfing er mich, bedauerte mein Schicksal, wurde streng, als ich es ablehnte, seiner Aufforderung, Mitglied der SED zu werden, nachzukommen. Schließlich fragte er hintergründig: „Wenn Sie die Möglichkeit hätten, in die Sowjetunion oder in die USA zu reisen, wohin würden Sie fahren?“ Ich antwortete ihm, daß ich als Sozialistin natürlich großes Interesse daran hätte, das Mutterland des Sozialismus kennenzulernen. Mir schiene aber auch ein Besuch in den USA wichtig. Denn wollte man die Übel des Kapitalismus bekämpfen, müßte man sie kennen. Aber nach England würde ich bald reisen. Nun entließ er mich schnellstens. Wenige Tage danach wurde ich gewarnt. Die sowjetische Militäradministration hatte meine Papiere angefordert. Mir drohte Verhaftung. Ich entkam dieser neuen Gefahr.
Ich glaubte, meinem unvollkommenen Englisch nicht zu trauen, als mir der Beamte der Einwanderungsbehörde am 2. August 1946 im Hafen von Folkestone eröffnete, ich hätte mich als feindliche Ausländerin einmal die Woche bei der Polizei zu melden. Der entsprechende Ausweis verpflichtete mich außerdem, mich nach 24 Uhr im Hause aufzuhalten und nicht über fünf Meilen hinaus ohne polizeiliche Genehmigung zu reisen. Meine Aufenthaltsdauer sei auf sechs Monate beschränkt. Eine Arbeitsbewilligung sei ebenfalls nicht zu erwarten. Wohl gemerkt, ich war mit einem Visum nach England gekommen, das nur Opfern des Faschismus oder sogenannten displaced persons zustand. England versagte zur damaligen Zeit jedem anderen Deutschen die Einreise. Mein Entschluß, diesem unfreundlichen Land so bald wie möglich den Rücken zu kehren, stand schon an diesem 2. August 1946, dem Tage meiner Ankunft, fest.
Ein englischer Politiker griff später die Absurdität der mir zuteil gewordenen Behandlung auf und bewirkte, daß ich von einem feindlichen zu einem normalen Ausländer avancierte, der zwar mehr Rechte hatte, aber ebensowenig in die englische Gesellschaft aufgenommen wurde.
Ich blieb acht Jahre in England, studierte zunächst und arbeitete dann im Büro der Sozialistischen Internationale in London. Dort lernte ich führende Sozialisten aus aller Welt kennen. Die Sozialisten Indiens luden mich zu einem Besuch in ihr Land ein. Dies schien mir im Jahre 1954, als es noch keine Reisegesellschaften und nur wenige Fluglinien gab, doch recht abenteuerlich. Aber vielleicht war gerade das der Grund, daß ich die Reise unternahm. Ein ganzes Jahr durchstreifte ich Indien, Burma und Nepal, überall von Sozialisten betreut und geführt. Die Erlebnisse und Erfahrungen in einer für mich fremden Welt überwältigten mich. Ich saugte sie auf, lernte bei jedem Schritt Neues über das Leben anderer Völker. Ich erkannte politische Zusammenhänge. Ich schrieb auf, was ich gesehen hatte. Und ich fand später Leser dafür unter den Deutschen, denen in zwölf Jahren Nazidiktatur die Welt fremd geworden war. So führte mich diese Reise zu meinem Beruf – dem Journalismus, der mir mehr wurde als nur ein Broterwerb.
Ich überlegte nicht lange, wo ich in Zukunft leben und arbeiten wollte. Die acht Jahre in England hatten mich nicht zum Bleiben veranlaßt. Zu Palästina, dem späteren Israel, hatte ich keinerlei Bindungen. Also kam nur Deutschland in Frage. Dort, so glaubte ich, würden nun Menschen an der Macht sein, die dem Typ jener glichen, die mir zum Überleben verholfen hatten. Und sie würden ein demokratisches Deutschland aufbauen und danach streben, nach der schrecklichen Vergangenheit ein geachtetes Mitglied der Völkerfamilie zu werden. Ich wollte daran mitarbeiten. So in etwa meine etwas naive Entscheidung.
Als ich Mitte der fünfziger Jahre nach Bonn kam, fand ich vor, was ich nicht erwartet hatte. Alte Nazis und solche, die für den Aufstieg Hitlers Mitverantwortung trugen, saßen nun in einigen der wichtigsten Regierungsämtern. Ich verstand das nicht. Die Hitlerzeit war für meine Begriffe nicht nur eine unselige Phase in der Geschichte Deutschlands gewesen. Hitler hatte die ganze Welt in einen fürchterlichen Krieg gestürzt. Unter seiner Herrschaft mußten viele Millionen Menschen gewaltsam sterben. Vergessen konnte ich aber auch nicht, was Hitler dem deutschen Volk angetan hat. Er zerstörte die erste Demokratie in diesem Land und setzte eine grausame Diktatur an ihre Stelle. Er machte die Deutschen zu Sklaven, die, wenn sie seine Gesetze nicht befolgten, die furchtbaren Instrumente des Terrors und der Folter zu spüren bekamen. Denunziantentum wurde gepflegt und gefördert, dem Blockwart jede Vollmacht erteilt. Mit Hilfe einer nie schweigenden Propaganda hämmerten die Nazis den Deutschen ihre These von den Menschen ein, die ein Recht auf Leben hatten, und jenen, die vernichtet werden müßten. Und das betraf nicht nur Juden, Sinti und Roma, Polen und Russen, sondern auch Deutsche, die dem nazistischen Idealbild nicht entsprachen. Und ich fragte mich nun und tue das heute immer wieder: „Wie konnten die Deutschen Männern, die für diese schrecklichen Verbrechen mitverantwortlich wurden, noch einmal Vertrauen schenken?“ Ich spürte bald, daß viele Deutsche mich und meine Einstellung nicht verstanden. Für manche mag ich eine lebendige Anklage, unangenehm und unbequem gewesen sein. Andere waren ausschließlich damit beschäftigt, die Gegenwart und die Zukunft zu bewältigen, so daß sie keine Gedanken an die Vergangenheit verschwenden wollten. Sprach ich mein Entsetzen darüber aus, erhielt ich Ratschläge, doch nicht die Vergangenheit zur Richtschnur meines Denkens und Handelns zu machen und das auch nicht von anderen zu verlangen. Ich fühlte mich bald sehr fremd in Deutschland, unsicher und allein.
Die israelische Zeitung MAARIV bot mir 1958 an, für sie in Bonn als ihre Deutschland-Korrespondentin zu arbeiten. Ich sagte zu. Zunächst sah ich darin eigentlich nur einen Broterwerb. Die Redaktion erwartete von mir, daß ich ihren Lesern ein Bild vom neuen Deutschland vermittelte. Die Mehrzahl ihrer Leser stand Deutschland skeptisch gegenüber und glaubte nicht an eine so schnelle Abkehr vom Nationalsozialismus hin zur Demokratie. So ergab es sich, daß Anzeichen für eine positive Entwicklung in den fünfziger und sechziger Jahren in Deutschland eine schlechte Plazierung in der Zeitung fanden, Berichte über ehemalige, auch belastete Nazis und ihre Karrieren im neuen Deutschland hingegen auf der ersten Seite zu lesen waren. Dafür bot die Bonner Regierung auch ausreichend Material an. Ich leugne nicht, daß es auch in meinem Sinn war, der israelischen Öffentlichkeit bekannt zu machen,
daß alte Nazis auch im neuen Deutschland zu Ministern und Staatssekretären aufsteigen konnten,
daß ehemalige Nazis im Bundestag, in allen Parteien, in allen Verwaltungen, vielfach in hohen Positionen mitarbeiteten,
daß Richter, die in den 12 Jahren und besonders im Zweiten Weltkrieg insgesamt 32.000 Todesurteile verhängt hatten, nicht in einem einzigen Verfahren zur Rechenschaft gezogen worden waren,
daß die Justiz voll war von Richtern und Staatsanwälten, die schon im Dritten Reich „Recht“ gesprochen hatten,
daß Naziverbrecher, wenn sie trotz vieler Verschleppungstaktiken von Polizei und Staatsanwälten vor Gericht gestellt wurden, nur selten Strafen erhielten, wie sie bei normalen Kapitalverbrechen üblich sind,
daß alte Nazis lange vor den Opfern des Nationalsozialismus ihre Wiedergutmachung bzw. Pensionen erhielten,
daß Wiedergutmachungszahlungen an die Opfer von Beamten mit brauner Vergangenheit festgesetzt wurden.
Das sind nur einige Beispiele dafür, daß man in Bonn eine drastische Trennung von der Vergangenheit unterließ.
Ich selbst hatte ab und zu Zusammenstöße mit Beamten, die ihre Nazivergangenheit nicht leugneten und selbstgerechter nicht hätten auftreten können. Ein Staatssekretär an der Seite von Bundeskanzler Erhard erklärte mir, daß man beim Aufbau des neuen Staates auf die alten Nazis hätte zurückgreifen müssen und damit nichts weiter getan hätte, als ihr Wissen auszubeuten, wie er es formulierte. „Ihnen verdanken wir unseren wirtschaftlichen Aufschwung und daß dadurch die Gefahr des Kommunismus im neuen Deutschland gebannt werden konnte.“ Süffisant lächelnd fügte er hinzu, daß ohne diesen wirtschaftlichen Aufschwung keine Wiedergutmachungszahlungen an die Opfer des Nationalsozialismus hätten gezahlt werden können. Nach solchen und ähnlichen Begebenheiten fragte ich mich manchmal, weshalb ich das alles ertrug. Es wäre ungerecht, würde ich in diesem Zusammenhang nicht darauf verweisen, daß ich in Bonn auch Freunde hatte, die unter den restaurativen Erscheinungen ebenso litten wie ich. Aber meist waren sie nach den Jahren der Hitler-Diktatur müde geworden, hatten politische Verfolgung hinter sich, hatten resigniert. Andere erkannten, daß alte Nazis auch Wähler waren, und ließen es an klaren Aussagen zur Vergangenheit fehlen. Daß ich in Bonn nicht beliebt war, ist sogar verständlich. Ich störte.
Als in den sechziger Jahren der Aufruhr der Studenten einsetzte, war ich begeistert. Junge Deutsche, die gegen diese Zustände in ihrem Land revoltierten, schienen mir ein hoffnungsvolles Zeichen für eine demokratische Entwicklung ihres Staates. Dabei war es fast logisch, daß sie ihre Elterngeneration, die in der Nazizeit so kläglich versagt hatte, zu fragen begannen, wie es zu diesem verbrecherischen Regime hatte kommen können, und wie sie sich damals verhalten hatten. Nur selten bekamen sie eine befriedigende Antwort. Diesen Jungen kommt das Verdienst zu, als erste in diesem Land eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit angestoßen zu haben. Aber dann suchten sie, ihrer Bewegung eine ideologische Grundlage zu geben. Die Lehren von Mao Tse-tung, Che Guevara, Ho Chi-Minh und Karl Marx boten ihnen Ansätze dafür. Sie teilten die Welt ein in Gut und Böse, in Unterdrücker und Unterdrückte, in Imperialisten und Antiimperialisten. Und dabei kamen sie zu der Feststellung, daß Israel ein Ableger Amerikas sei, ergo ein Vorposten des Kapitalismus im Nahen Osten, dem keine Gnade gewährt werden dürfe. Israel müsse mit allen Mitteln bekämpft werden. Ich glaubte, meinen Ohren nicht zu trauen. Israel, das vielen Verfolgten des Naziregimes zur einzigen Zufluchtsstätte, das Unzähligen zur Heimat geworden war, ein Staat, der damals noch sozialistischer war als alle jene Länder zusammen, die diesen jungen Leuten als Vorbilder dienten, sollte nun nichts weiter sein als ein Unterdrücker, Ausbeuter oder Rassist? Man brauchte wahrlich nicht Zionist zu sein, um sich nun mit Israel verbunden zu fühlen. Spruchbänder, die diese Jungen auf ihren Demonstrationen mit sich führten und auf denen sie den Zionismus mit dem Faschismus gleichsetzten, empörten mich.
Als sie sogar zu Tätlichkeiten gegen den israelischen Botschafter übergingen, hatte ich genug. Die alten Nazis in Bonn und nun auch noch die jungen verantwortungslosen Linken machten mir die Entscheidung leicht. Ich beschloß, meine Brücken in Bonn abzubrechen und nach Israel auszuwandern – und ein drittes Leben zu beginnen.
Durch die Arbeit für die israelische Zeitung hatte ich Kontakt zu Israel bekommen. Bei Reisen dorthin hatte ich den Sinn und die Notwendigkeit für die Existenz dieses Staates begriffen und hatte die Aufbauleistung vor Ort bewundert. Israel stellte sich mir als Land der Verfolgten dar, in dem auch für mich ein Platz sein müßte. Verfolgte, ganz gleich, woher sie kommen und welche ihre Muttersprache ist, verstehen einander, haben den gleichen starken Überlebenswillen, haben vergleichbare Reaktionen. Meiner Redaktion, die zunächst von meinen Plänen nicht sonderlich begeistert war – ich sprach kein Wort Hebräisch –, kündigte ich meine Ankunft für den 2. Februar 1972 an. Dennoch nahm man mich herzlich auf, half mir, die vielen bürokratischen Klippen einer Einwanderung zu überwinden, und fand einen Platz für mich in der Redaktion. Ich fühlte mich sehr schnell zugehörig. Ja, es mag Ihnen merkwürdig klingen, wenn ich sage, daß ich das erste Mal in meinem Leben in diesem von außen bedrohten Land ein Gefühl der Sicherheit und der Geborgenheit empfand. Lange Zeit schrieb ich meine Artikel noch in Englisch, während ich eifrig Hebräisch lernte. Mir bot sich eine Fülle von Aufgaben: Besuche von Staatsmännern aus aller Welt, Schicksale von Verfolgten aus vielen Nationen, die Entwicklung in Deutschland, um nur einiges zu nennen. Dabei lernte ich das Land und seine Menschen kennen. Und das faszinierte mich. Menschen aus 70 Nationen, die ihre Traditionen und Gewohnheiten in unser Leben einbrachten, sowie politische und kulturelle Eigenheiten, die zu verstehen mir manchmal nicht leicht fiel. Das traf besonders auf Religion und Religiosität zu. Und schließlich mußte ich lernen, mit heißem Krieg und kaltem Frieden zu leben.
Es war der 6. Oktober 1972. Der schrille Ton einer Sirene weckte mich aus tiefem Schlaf. Ich glaubte mich in Berlin im Zweiten Weltkrieg. Die Nachbarin riß mich aus meiner Verwirrung. Die Ägypter hätten den Suezkanal überschritten. Es sei Krieg. Ihr Mann stand bereits in Uniform vor mir. Er ergriff sein Gewehr, küßte seine Frau zum Abschied, so als ob er auf irgendeine Reise ginge. In der Redaktion übernahmen wir Frauen Aufgaben von unseren Kollegen, die bereits an der Front waren. Redakteure, das Gewehr über der Schulter, kamen auf dem Weg zum Krieg noch kurz vorbei, um letzte Anweisungen zu geben. Natürlich wurden Fragen gestellt, wie Israel vom Krieg überrascht werden konnte. Doch das war zunächst nebensächlich. Es gab keinen Streit, keinen Aufschrei, keine Empörung, solange der Krieg dauerte. Man fügte sich in die Situation, die zunächst für Israel keineswegs rosig schien. Die Zeitung erschien oft mit weißen Flecken. Die Zensur hatte noch in letzter Minute Streichungen vorgenommen. Mütter saßen stundenlang neben dem Telefon und warteten auf ein Gespräch mit ihrem Sohn oder ihrem Mann irgendwo an der Front. Freiwillige, meist Frauen und alte Männer, halfen aus, um die Wirtschaft des Landes in Gang zu halten. Nach 19 Tagen stimmte Israel dem vom Sicherheitsrat der UNO ausgehandelten Waffenstillstand zu. Erleichterung war spürbar. Israel hatte 2700 Tote zu beklagen. Man ahnte, daß es nicht die letzten sein würden.
Aber dann, im November 1977, als der ägyptische Präsident Sadat sich entschloß, nach Jerusalem zu kommen, schien der Frieden näher als jemals zuvor. Er käme, so sagte er, „mit der ehrlichen Absicht, neues Leben zu gestalten und Frieden herzustellen“. Noch heute sehne ich mich nach dem Bild zurück, als Anwar Sadat die Gangway seines Flugzeuges herunterschritt und mit ausgestreckten Händen auf die ihn erwartenden israelischen Staatsmänner zuging. Die Mehrheit der Israelis glaubte diesem Mann. Ja, es würde Frieden geben. Sie wiederholten es immer wieder, so als wollten sie es sich selbst suggerieren. Menschen tanzten in den Straßen von Jerusalem. Andere drückten ihre Nasen an den Glaswänden des Theaters von Jerusalem platt, um etwas zu sehen, etwas zu spüren von dieser revolutionären Entwicklung, die sich da drinnen abspielte. Ich probierte die provisorisch für diesen Tag gelegte Telefonleitung nach Kairo aus. Ich wollte der Ehefrau des ägyptischen Präsidenten ein paar Worte der Freude über diese Entwicklung entlocken. Es machte mir nichts aus, daß die Verbindung nicht zustande kam. Mir genügte das Gespräch der beiden Telefonistinnen, dessen Zeugin ich wurde. „Ist heute nicht ein herrlicher Tag? Wir haben Frieden!“, rief die eine aus Jerusalem ihrer Kollegin in Kairo zu. „Kein Krieg mehr, keine Toten, wie wunderbar!“, pflichtete ihr die Kollegin aus Kairo bei. Zu dem globalen Frieden, den Präsident Sadat damals anstrebte, kam es nicht. Zwar hörte das Morden zwischen Ägyptern und Israelis auf. Ein kalter Frieden blieb zurück. Anwar Sadat wurde 1981 von moslemischen Fundamentalisten ermordet.
Im Juni 1973 wurde der erste Besuch eines deutschen Bundeskanzlers in Israel erwartet. Schon Tage zuvor herrschte eine gespannte Atmosphäre im Land. Der Anblick der deutschen neben den israelischen Fahnen, die in den Straßen von Jerusalem und um den Flughafen Lod aufgezogen waren, waren die Ursache dafür. Zwar bestanden seit 1965 diplomatische Beziehungen zwischen Israel und der Bundesrepublik. Doch die spielten sich auf diplomatischem Parkett ab, entfernt von Zuschauern, den Überlebenden, den Zweiflern, den Gegnern auch dieses neuen Deutschlands. Gewiß, hier kam Willy Brandt, ein Mann, dem man eigentlich Vertrauen entgegenbringen konnte. Er hatte gegen die Nazis gekämpft und später in der Emigration gelebt. Im Dezember 1970 hatte er in Warschau am Mahnmal vor dem ehemaligen Getto einen Kranz niedergelegt und in Demut vor den jüdischen Opfern niedergekniet. Das war mehr, als man von einem deutschen Kanzler erwarten konnte. Dieser Mann kam nach Israel und sprach im Namen Deutschlands, eines neuen Deutschlands, wie so oft vorgegeben wurde, und das dennoch seine Vergangenheit nicht abstreifen konnte.
Vom ersten Moment an ließ Brandt keine Zweifel darüber aufkommen, welche Art der Beziehungen er für beide Länder voraussah. Er sagte: „Sie haben den Kanzler deutscher Staatlichkeit eingeladen. Das heißt, Sie stellen der Macht der Vergangenheit den Anspruch der Gegenwart gegenüber. Ich glaube, die Menschen wären in der Tat verloren, wenn es nicht diesen Mut zum neuen Anfang gäbe.“ In ihrer Antwort gab die israelische Regierungschefin Golda Meir zu verstehen, daß auch sie den Besuch Brandts als die Einleitung zu einem neuen Anfang der Beziehungen beider Länder ansehe: „Sie haben als einer der ersten gesagt, daß Geschehenes nicht ungeschehen gemacht werden kann, aber daß man auch nicht vergessen kann. Dieses Wort hat Wunder gewirkt und es uns und Ihnen ermöglicht, uns zu erinnern. Wir können nur im Bewußtsein der vergangenen Ereignisse aus der Gegenwart in eine hoffnungsvolle und bessere Zukunft blicken.“
In der nationalen Gedenkstätte Israels, Yad Vashem, in der das ewige Feuer brennt und Urnen mit Asche von Opfern aus verschiedenen Konzentrationslagern in den Fußboden eingelassen sind, war zum ersten Mal die deutsche Sprache zu hören. Hunderte von Journalisten aus aller Welt wurden Zeugen dieses historischen Ereignisses, als der deutsche Kanzler Verse aus einem Psalm vorlas. Zwar sprach der Kanzler mit fester Stimme, doch die Erregung war ihm anzumerken. Eine Erregung, die sich auch auf mich übertrug. Ja, ich glaubte an die Ehrlichkeit dieses Mannes. Und dennoch hatte ich Mühe, mich in meiner Berichterstattung nicht von meinen Erfahrungen im Nachkriegs-Deutschland leiten zu lassen. Nahe der Erinnerungsstätte, in der die Zeremonie ablief, wußte ich die Bäume, die einige meiner Retter als Dank für ihr Opfer im „Hain der Gerechten“ hatten pflanzen dürfen. Das half mir.
Es war Volker Ludwig, der Leiter des Berliner „Grips Theaters“, der mit seinem Entschluß, aus meinem Buch „Ich trug den gelben Stern“ ein Theaterstück zu machen, mein viertes Leben einläutete. Im Februar 1989 hatte „Ab heute heißt du Sara“ Premiere. Inzwischen ist es von 37 deutschen Bühnen gespielt worden, im „Grips Theater“ selbst steht jetzt die 300. Vorstellung auf dem Programm. In mehr als dreißig Schulen der Bundesrepublik führten Schüler bisher das Stück oder Szenen daraus auf, eine Zahl, die ständig steigt. Ich erinnere mich an die ersten Proben, an denen ich teilnahm. Als ich meine Mutter auf der Bühne sagen hörte: „Wir sind Juden, Inge. Für die Nazis sind wir ihre Feinde“, da glaubte ich, es nicht mehr aushalten zu können. Ich mußte wieder einmal begreifen, wie tief die Erfahrungen der Verfolgung, der Flucht, der Verlust lieber und liebster Menschen sitzen, wie wenig sie zu verarbeiten sind. Auch wenn man annimmt, nach über 50 Jahren davon frei zu sein. Im stillen haderte ich mit mir, schalt mich einen Feigling, der nicht begriffen hatte, daß Volker Ludwig mit seinem Stück das Gleiche bewirken wollte wie ich, nämlich der Jugend zu zeigen, was damals geschah und was Menschen anderen Menschen angetan haben, nur weil sie angeblich anders waren als die Deutschen, und daß diese Denkweise zu den bestialischsten aller Morde führte. Langsam wich mein anfänglicher Schock und machte einem Gefühl des Vertrauens Platz, das durch den Kontakt zu den meist jungen Schauspielern entstand und wuchs. „Ab heute heißt du Sara“ ist in Berlin immer noch ständig ausverkauft. 80 % des Publikums sind junge Leute. Ich gehe öfter ins Theater, um die Reaktion dieses Publikums zu beobachten. Es fasziniert mich noch heute, mitzuerleben, wie sie mit Spannung der Handlung auf der Bühne folgen, wie sie mitgehen, wie sie mitleiden und wie sie am Schluß begeistert applaudieren – Ausdruck ihres Verständnisses für das, was das Stück ihnen sagen will.
Das blieb nicht ohne Folgen für mich. Schulen wandten sich an mich, baten, daß ich ihren Schülern über mein Leben als Verfolgte in der Nazizeit berichte, ihre Fragen beantworte, die sich hauptsächlich darum drehen, wie es zu dem Schrecklichen kommen konnte. Meist finde ich junge Menschen vor, die – anders als ihre Eltern und Großeltern – geradezu begierig sind, etwas darüber zu erfahren, die ohne Scheu ihre Fragen stellen. Es handelt sich um eine Generation, deren Eltern den Nationalsozialismus nicht mehr erlebten und in einer Zeit aufwuchsen, in der in den Schulen der alten Bundesrepublik die schlimme Vergangenheit nur selten zum Lehrstoff gehörte. Sie haben ihren Kindern nur wenig oder gar nichts über jene schreckliche Zeit zu sagen.
[…]
Das Theaterstück hat mich wieder nach Berlin gebracht. Dabei habe ich feststellen müssen, wie viel mich mit dieser Stadt verbindet, wie sehr ihre Atmosphäre meinem Wesen entspricht und daß das Berlinern die einzige Sprache ist, die ich wirklich beherrsche. Ich gebe aber zu, daß es in dieser Stadt Gegenden gibt, mit denen ich schlimme Erinnerungen verbinde und die ich meide. Bedeutender aber ist für mich die Bekanntschaft dieser jungen Generation, die sich so frei und offen gibt und die mir und meinem Anliegen so viel Sympathie entgegenbringt. Und dennoch: Nichts, gar nichts schien sich geändert zu haben, als Ende 1991 Rechtsradikale gegen Ausländer vorzugehen begannen. Es waren schlimme Bilder, die schon damals über den Bildschirm liefen und die mich unweigerlich zurückversetzten in jene Zeit, in der in Deutschland Mensch nicht gleich Mensch war. Wieder schlossen Deutsche ihre Fenster wie bei den Judenverfolgungen in den dreißiger Jahren, um nicht vom Brandgeruch oder den Schreien der Menschen belästigt zu werden, denen der Zufall eine dunkle Hautfarbe oder geschlitzte Augen beschert hat. Als in der Öffentlichkeit bekannt wurde, daß auch ich durch Schmähschriften belästigt und am Telefon durch antisemitische Hetzparolen beleidigt wurde, erhielt ich Hunderte von Briefen anderer Art, in denen Berliner ihr Entsetzen und ihre Scham darüber ausdrückten. Unter diesen Briefen waren auch Zuschriften von Kindern, die mich wissen ließen, daß sie zu mir stehen. „Wenn Sie mal Rat brauchen, dann kommen Sie zu uns“, schrieben Dreizehnjährige. „Wir helfen Ihnen, wenn Ihnen jemand etwas antun will.“ Diese Briefe und die Blumen, die Unbekannte vor meine Wohnungstür legten, ermutigten mich, gaben mir die Kraft, die ich brauche, um weiterhin vor jungen Menschen Zeugnis abzulegen über meine Vergangenheit und die ihres Landes, die für mich immer gegenwärtig bleibt.
Aber vor allem möchte ich der jungen Generation am Beispiel derjenigen, die ihren Kopf für uns riskierten, beweisen, daß es selbst im Nazi-Deutschland nicht nur schlechte Menschen gegeben hat. Nein, es gab jene, wenn auch viel zu wenige, die ganz sicher waren, daß jeder Mensch auf dieser Erde ein Recht auf Leben hat, gleich welcher Herkunft, gleich welcher Hautfarbe, gleich welcher Religion, und die trotz aller Gefahren für sie selbst entsprechend handelten.
Diese Menschen möchte ich der Öffentlichkeit nahebringen und sagen: Erkennen Sie diese Menschen als Helden an, ehren Sie sie, stellen Sie sie der Jugend als Vorbilder hin! Denn sie sind wahrhaftig ein Beispiel für Zivilcourage, eine Haltung, die die Lebensführung eines jeden von uns bestimmen sollte.