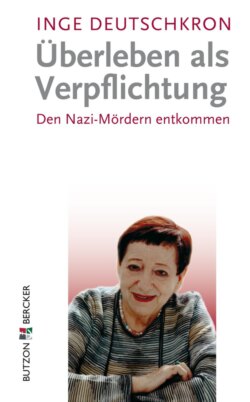Читать книгу Überleben als Verpflichtung - Inge Deutchkron - Страница 8
Erinnerungen an zwei Finsterwalder Jungen
Оглавление1943 waren sie acht und fünf Jahre alt. Zwei Jungen, Brüder, der ältere hieß Dieter, der jüngere Peter. Ständig hatten sie Hunger, bettelten um ein Stück Brot oder eine Kartoffel. Sie waren im Jüdischen Krankenhaus in Berlin inhaftiert. Ihr Vater war kurz nach der Geburt Peters ins KZ Buchenwald eingeliefert worden. Ihre Mutter galt als verstorben.
Beide waren in Finsterwalde geboren worden. Dort war ihr Vater aufgewachsen. Dessen Mutter, eine Schwester meines Vaters, war geschieden und konnte ihre drei Kinder nicht allein ernähren. Willy, so hieß der Vater der beiden Jungen, kam zu uns nach Finsterwalde und wuchs mit mir zusammen auf. Als er die Volksschule beendet hatte, nahm ihn Emil Galliner als Lehrling in sein Kaufhaus. Wir verließen Berlin 1926 oder 1927. Willy aber, knapp 17jährig, blieb in der Stadt, in der er sich heimisch fühlte. Er wurde aktiver Sportler und später ein Autonarr, eine Tatsache, die ihm in der Nazizeit zum Verhängnis werden sollte. Die Nazis nahmen eine simple Autostrafe zum Vorwand, ihn als sogenanntes „asoziales Element“ schon 1938 ins KZ zu sperren. In Wirklichkeit suchten sie damals kräftige junge Männer, die ihnen das KZ Buchenwald aufbauten. Seine Kinder blieben zunächst bei der nichtjüdischen Mutter, die Willy noch vor den 1935 erlassenen Nürnberger Rassegesetzen, die eine eheliche Verbindung zwischen Juden und Nichtjuden verboten, geheiratet hatte.
Seine beiden Jungen kamen Anfang der vierziger Jahre ins Jüdische Krankenhaus in Berlin, wo die Gestapo eine Dienststelle hatte, ein Gefängnis und ein Arbeitslager unterhielt. Diese waren im Jüdischen Krankenhaus in der Iranischen Straße eingerichtet worden zu einer Zeit, als Berlin als „judenrein“ galt. Am 27. Februar 1943 waren alle noch in Berlin verbliebenen Juden in der sogenannten „Fabrikaktion“[1] abgeholt und wenig später zu Tausenden „in den Osten“ deportiert worden. Im Jüdischen Krankenhaus blieben Kranke zurück, die auch dort behandelt wurden, bis man sie nach ihrer Gesundung, als transportfähig erklärt, deportieren konnte. Im Gefängnis waren hauptsächlich „Untergetauchte“ untergebracht, die sich der Deportation hatten entziehen wollen, aufgespürt worden waren und bis zur Abfahrt eines Deportationszuges dort blieben. Juden aus „Mischehen“, die durch Heirat mit einem Nichtjuden vor Deportationen geschützt waren, wurden sofort nach dem Tode des nichtjüdischen Partners ins Gefängnis des Krankenhauses gebracht, um ebenfalls bei nächster Gelegenheit „in den Osten“ deportiert zu werden. Noch in den letzten Kriegstagen des Monats März 1945 gingen von dort Züge ab. Nun allerdings nur noch in die KZs innerhalb Deutschlands. Die Vernichtungslager in Polen waren für die Deutschen nicht mehr erreichbar.
[1] Fabrikaktion, so genannt, weil die Gestapo die letzten Juden Berlins auch von ihren Arbeitsstätten in den Fabriken, in denen sie Zwangsarbeit leisten mußten, abholten.
Die beiden Jungen waren mutterseelenallein in diesem Gefängnis, aus dem es keinen Weg nach draußen gab. Jeder, der dort Dienst tun mußte – Ärzte oder Schwestern oder anderes Hilfspersonal der Gestapo mit irgendeinem „arischen“ Vorteil –, kannte die Kinder. Sie hatten selber wenig zu essen. Aber das Mitleid für die beiden Jungen war groß, und man opferte ihnen schon mal eine Kartoffel oder ein Stück Brot. Sie hatten niemanden mehr auf dieser Welt – das war bekannt – außer ihrem Vater, der sich im KZ natürlich nicht um seine Kinder kümmern konnte. Aus Gründen, die nicht mehr geklärt werden können, hatte die Mutter die beiden Jungen Anfang der vierziger Jahre, als die Verfolgung der Juden immer stärkere Formen annahm, in die Obhut ihrer Eltern gegeben.
Berichten zufolge, die die jüdische Großmutter, also meine Tante, in Berlin erreichten, sei die Mutter eines Tages an einer Lungenentzündung gestorben. Und schließlich starben auch die Großeltern, bei denen die Jungen eine Bleibe gefunden hatten. Die Jungen galten als „Mischlinge ersten Grades“ und waren nach den Nazigesetzen nicht zur Deportation bestimmt. Das spätere Vorhaben, Mischlinge oder Juden aus Mischehen dennoch zu deportieren, mußte aufgegeben werden. Im Zuge der sogenannten „Fabrikaktion“ Ende Februar/März 1943 waren auch sie bereits verhaftet worden. Aber mehr als 200 „arische“ Ehefrauen und Angehörige demonstrierten über eine Woche lang vor dem Sammellager in der Rosenstraße und erwirkten die Freilassung ihrer jüdischen Angehörigen. Ein Aufbegehren gegen das Naziregime, das in Deutschland einmalig blieb.
Nach der Befreiung am 8. Mai 1945 suchte meine Mutter die beiden Jungen und fand ihre Spuren in dem ehemaligen jüdischen Waisenhaus in Berlin-Niederschönhausen. Ihr Vater, von dessen Überleben wir auf diese Weise erfuhren, hatte sie einen Tag zuvor von dort abgeholt. Willy hatte sieben Jahre im KZ Buchenwald zubringen müssen, wo er neben schwerster Arbeit auch noch medizinischen Experimenten ausgesetzt war. Dennoch ließ er sich in Weimar, nur wenige Kilometer von seiner Folterstätte entfernt, nieder. Seine Jungen, die nie ein Familienleben kennengelernt hatten, schickte er nach kurzer Zeit nach Palästina mit der Begründung, sie würden in Deutschland keine Zukunft haben. Dort wuchsen sie in einem Heim auf. Die Sehnsucht nach einer Familie ließ vor allem den Jüngsten nie los. Er war einer der ersten, mit einem israelischen Paß, der eine Einreiseerlaubnis in die DDR erhielt, um den Vater wiederzusehen. Er suchte aber auch nach seiner Mutter, an deren Tod er nicht glauben wollte. Und tatsächlich, so sein Bericht, fand er sie in Westdeutschland. Sie aber wollte ihn nicht wiedersehen, wohl auch nicht an ihn erinnert werden. Sie empfing ihn nicht. Es ist heute nicht mehr feststellbar, ob die Mutter damals ihren Tod vorgetäuscht hatte, um sich aus Angst der Kinder mit dem jüdischen Makel zu entledigen, oder ob die Information über ihren Tod nur der jüdischen Großmutter galt, um alle Kontakte abzubrechen, oder ob der Sohn einer Halluzination erlag.
Trotzdem dieser Sohn in Israel eine eigene Familie gegründet und auch schon Enkelkinder hat – ähnlich wie sein älterer Bruder –, hat er nie wieder seine Ruhe gefunden. Mal wollte er wieder in Deutschland zu Hause sein. Dann wieder zog es ihn nach Israel zurück. Vor einigen Jahren starb er in Israel.