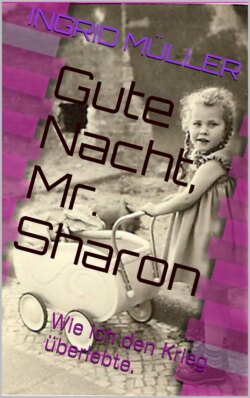Читать книгу Gute Nacht, Mr. Sharon - Ingrid Müller - Страница 6
ОглавлениеDie Bombe
Es war im Januar, morgens um 7 Uhr; es war ein sonniger und frostig-kalter Tag, als ich mich entschloss, diese Erde für eine Weile mit meiner Anwesenheit zu beglücken. Und es war Sonntag. Das erzählten mir meine Eltern immer wieder, und meine Mutter fügte regelmäßig hinzu:
„ Ja, Du bist ein Sonntagskind. Und Sonntagskinder haben Glück im Leben.“ Ich dachte, irgendwann würde die Tür aufgehen und das Glück käme hereinspaziert. Zunächst aber war mein kleines Leben in Gefahr. Als ich zweieinhalb Jahre alt war, brach der II. Weltkrieg aus. Am Anfang merkten wir nichts davon, bis zu der Bombe
*****
Im ersten Weltkrieg wurden die Schulen in den Städten geschlossen, alle schulpflichtigen Kinder evakuiert und in ländliche Regionen verfrachtet. Mein Vater kam auf einen Bauernhof im Jeverland, und aus dieser Zeit stammte sein Kontakt zu der Bauersfamilie, der jahrzehntelang anhielt. Die Familie hatte drei Töchter, und besonders zu Annie hatte er bis zu ihrem Tod regelmäßigen Kontakt, nachdem deren Eltern gestorben waren. Für meinen Vater war diese Zeit auf dem Bauernhof wohl die beste Zeit seiner Jugend. Seitdem liebte er die Landschaft, die Nordsee, das Watt, die Marschen, und als sich meine Eltern nach dem Krieg endlich wieder einen Urlaub leisten konnten, kam nur die Nordsee in Frage. Der Schwarzwald oder die Ostsee gefielen ihm nicht. Nur an der Nordsee wollte er seine Urlaube verbringen.
Nun, da der Krieg an Intensität zunahm und die Versorgungslage immer kritischer wurde, luden uns die Jeverländer ein, bei ihnen Urlaub zu machen, damit wir uns mal wieder richtig satt essen könnten. Meine Mutter wollte das Haus nicht verlassen, und so fuhr ich mit meinem Vater allein los. Es war eine anstrengende Reise mit dem Zug. Häufiges Umsteigen, langes Warten auf den Anschlusszug und schließlich noch ein Marsch von dem Bahnhof des kleinen Ortes hinaus aufs Land. Ich war etwa fünf Jahre alt und völlig erschöpft, als wir dort ankamen. Ich erinnere mich daran, dass wir einfach in das Haus gingen, dessen Tür nicht abgeschlossen war, und in eine Bauernstube traten, wo um einen großen Tisch herum viele Leute saßen, die alle aufsprangen mit Ausrufen der Freude und Überraschung. Mich ignorierte man zuerst, bis auf ein riesiges Hundevieh, das auf dem Boden gelegen hatte und sich träge erhob, um mich zu beschnüffeln. Er war fast so groß wie ich, und ich hatte Angst. Dann sagten sie, was alle Hundebesitzer sagen:
„Der tut nix“.
Der tat wirklich nichts, er war sozusagen eine Seele von Mensch. Er spielte mit Begeisterung Verstecken, was wir in den nächsten Tagen ausprobieren konnten. Wir gingen mit ihm in die Scheune, stellten ihn in eine Ecke und sagten ihm, er dürfe nicht gucken. Dann versteckten wir uns hinter riesigen Strohballen, mein Vater pfiff und im nächsten Augenblick war das Tier schwanzwedelnd zur Stelle. Ich konnte es nicht glauben.
„Der hat geguckt. Noch mal.“
Wir stellten ihn wieder in die Ecke, und ich guckte über die Schulter zurück, aber der Hund rührte sich nicht. Mein Vater pfiff, und der Hund war da.
„Jetzt suchen wir uns mal ein richtig schweres Versteck,“ sagte mein Vater.
Wir türmten Strohballen auf und verschanzten uns dahinter. Nach dem Pfiff war er sofort da, grub uns aus und freute sich. Ich war begeistert vom Landleben.
An einem Tag durfte ich mit dem Bauern auf dem Pferdewagen fahren. Er hatte zwei Ackergäule vorgespannt, und ich saß mit ihm auf dem Kutschsitz. Ich war völlig fasziniert, wie die Pferde den Weg fanden, ob geradeaus, rechts herum oder links herum, immer wussten sie, wohin wir wollten. Das waren intelligente Tiere! Ob ich auch mal lenken wolle. Ich wollte. Der Bauer erklärte mir, dass man den Tieren mit einem Zug am Zaumzeug die Richtung angeben müsse, in die sie gehen sollten. Ich glaubte das nicht. Meine Hochachtung war so groß, dass ich meinte, die Tiere wüssten das von allein. Um ein Haar landeten wir im Graben, wenn der Bauer nicht völlig panisch am Zaumzeug gerissen hätte. Das wurde dann auf Jeverländer Platt, von dem ich nichts verstand, zum Besten gegeben. Alle lachten und erklärten mir, dass das ganz dumme Viecher seien, denen man alles sagen müsse.
Leider war die schöne Zeit abrupt, früher als geplant, zu Ende. Wir schliefen auf dem Speicher, von dem ein Teil abgetrennt und zu einem Gästezimmer umgebaut war. Eines Morgens wurde ich wach, und das Bett meines Vaters war leer. Ich wartete, und als er nicht wiederkam, kriegte ich Angst, stand auf und lief heulend den Gang entlang zur Treppe. Doch da erschien er, fasste mich bei der Schulter und führte mich ins Zimmer zurück.
„Wir müssen sofort nach Hause“, sagte er traurig.
„Die Mutti hat angerufen. Unser Haus ist von einer Bombe getroffen worden.“
Es war eine Brandbombe, die durch das Dach geschlagen, aber auf dem Dachboden liegen geblieben war. Sie hatte ein großes Loch in die Decke gebrannt, das bis zum Ende des Krieges nicht repariert wurde und immer wieder besichtigt werden konnte. Das Dach wurde ausgebessert, der Schaden hielt sich in Grenzen. Anders beim Nachbarn. Dort war eine Bombe durch das Dach und zwei Zimmerdecken bis in das Erdgeschoss gefallen und hatte das Haus in Brand gesetzt. Es wurde eine Menschenkette gebildet, die Wassereimer weiterreichte, und während meine Mutter Wasser schleppte, hatte sich unsere Bombe durch die Zimmerdecke gefressen. Die anschließenden Löscharbeiten setzten das Haus unter Wasser, und meine Mutter hatte die ganze Nacht gewischt und war ziemlich erschöpft, als wir von unserer Reise zurückkamen.
Ab jetzt war der Krieg ganz nah. Um die Bevölkerung bei Luftangriffen zu warnen, hatten die Behörden Sirenen installiert, die durch unterschiedliche Tonlängen den Grad der Gefahr heulend verkündeten: Voralarm, Vollalarm, akute Luftgefahr. Spätestens bei der letzten Stufe sollten alle Bewohner im Luftschutzkeller sein, was bei uns bedeutete, wir gingen in die Waschküche. Bei Dunkelheit musste das Licht ausgemacht werden. Die Kellerfenster wurden zugemauert, damit ja kein Lichtschein nach außen dringe. Die feindlichen Flieger sollten nicht erkennen können, wo dort unten Häuser standen. Was war dieser Hitler doch für ein Filou! Den Alliierten haben wir es so richtig gezeigt.
Es half uns aber nicht. Die feindlichen Flugzeuge ließen Bombenteppiche auf uns herabfallen. Es waren die berüchtigten schaurig schönen „Christbäume“, die das Ruhrgebiet in Schutt und Asche legten. Am Ende des Krieges bestand unsere Stadt aus Ruinen. Es sah so aus, wie Schiller es in seiner „Glocke“ nach dem Feuersturm beschrieben hat:
„In den öden Fensterhöhlen wohnt das Grauen,
und des Himmels Wolken schauen
hoch hinein.