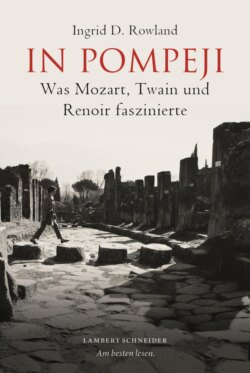Читать книгу In Pompeji - Ingrid Rowland - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
Vor Pompeji:
Kircher und Holste
ОглавлениеPompeji mag 79 n. Chr. untergegangen sein, ganz vergessen war es aber nie. Ein Großteil der überlebenden Bevölkerung zog auf die andere Seite des Vulkans, in die Gegend um Nola, ohne zu ahnen, dass ein Ausbruch in der Bronzezeit einst auch Nola verschüttet hatte, als der Wind nordöstlich statt südlich wehte und eine dichte Wolke aus Asche und vulkanischen Lapilli vor sich her trug. 1 Nola war jedoch eine Stadt im Binnenland, und unvermeidlich zog es manche der Flüchtlinge beziehungsweise ihre Nachkommen zurück an die Küste. Pompeji selbst ist auf einer Italienkarte von 1264 noch namentlich verzeichnet, ebenso wie auf der Landkarte eines Antiquars aus dem 16. Jahrhundert.2 Auch die lokale Erinnerung war beständig; 1504 verewigte der neapolitanische Dichter Jacopo Sannazaro die letzten Tage von Pompeji in seiner Romanze Arcadia, einem Bestseller des 16. Jahrhunderts. An einer Stelle der langen, windungsreichen Geschichte führt eine Nymphe den Helden Sincero (Sannazaros Alter Ego) durch die Unterwelt und eröffnet ihm deren Wunder:
„Und dann unter dem großen Vesuv werde ich dich das furchterregende Brüllen des Giganten Alkyoneus hören lassen; ich denke indes, du wirst ihn hören, wenn wir uns Sebeto nähern. Es gab eine Zeit, da ihn zu ihrem Unglück alle Anrainer hörten, als er die benachbarten Städte mit Flammensturm und Asche überzog, wie die verbrannten und geschmolzenen Steine für jeden, der sie erblickt, bezeugen, und wer möchte glauben, dass unter ihnen Völker, Villen und vornehme Städte begraben liegen? Da liegen sie tatsächlich, bedeckt von Verfall und Tod, wie die eine, die wir hier vor uns sehen, eine zweifelsohne einst in deinen Ländern berühmte Stadt, Pompeji genannt, gespeist von den Wassern des kühlen Sarno. Sie wurde in einem plötzlichen Erdbeben von der Erde verschlungen, als, wie ich glaube, der Grund, auf dem sie stand, unter ihren Füßen einbrach. Sicherlich ist dies eine befremdliche, schreckliche Art zu sterben, lebendige Menschen in Sekunden den Reihen der Lebenden entrissen zu sehen.“ (…) Und mit diesen Worten waren wir fast an der Stadt, die sie beschrieben, angelangt, und ihre Türme, Häuser, Theater und Tempel waren beinahe unversehrt auszumachen.3
Die wichtigsten Siedlungen in der Gegend waren im 16. Jahrhundert jedoch Torre Annunziata im Norden und Scafati im Südosten. Der Name Pompeji war von der Landkarte verschwunden. Die Bezeichnung „Civita“ für eine Siedlung lieferte schließlich einen Hinweis auf die frühere Existenz einer Stadt (lateinisch civitas) an dem einst als Pompeji bekannten Ort.
1592 kamen Hinweise auf die Lage der antiken Stadt zutage, als der berühmte Architekt und Ingenieur Domenico Fontana von Rom nach Neapel zog. Fontana, ein Meister seines Faches, der den vatikanischen Obelisken für Papst Sixtus V. versetzt hatte (und während dessen fünfjähriger Herrschaft drei weitere Obelisken in Rom errichtete), wurde von Sixtus’ Nachfolger Clemens VIII., der lieber Ketzer verbrennen als Obelisken aufstellen ließ, stante pede gefeuert. Der Vizekönig von Neapel bot Fontana umgehend eine Stelle als königlicher Architekt an, und der ließ bald darauf im Auftrag von Muzio Tuttavilla, eines örtlichen Gutsherrn und Grafen von Sarno, einen Kanal graben, um den Fluss Sarno mit einer Munitionsfabrik in Torre Annunziata zu verbinden. Als Fontanas Arbeiter die Felder um die kleine Siedlung Civita erreichten, stießen sie unter den Schichten vulkanischer Erde auf erhaltene Gebäude. Der königliche Architekt erkannte aufgrund seiner langen Erfahrung in Rom sofort, dass es sich um antike Ruinen handeln musste. Er ließ zwei Inschriften mit dem Wortlaut DECURIO POMPEI bergen und dem Grafen übergeben. Aber Fontanas Auftrag war, einen Kanal zu bauen und nicht archäologische Ausgrabungen zu unternehmen, und so baute er weiter – und zwar mit solchem Geschick, dass seine Wasserstraße bis ins frühe 20. Jahrhundert in Betrieb blieb. Der Graf von Sarno wiederum war ebenso wie der Vizekönig weitaus mehr an seiner modernen Fabrik interessiert als an der Antike. Er bewahrte die Inschriften auf, weil er dachte, sie beträfen den berühmten General Pompey – ein viel glanzvolleres Thema als ein zweitrangiger römischer Hafen, selbst wenn dieser Hafen zufällig bei einem spektakulären Vulkanausbruch untergegangen und von Plinius d. J. und dem großen „Sincerus“ Sannazaro erwähnt worden war. Aus seiner Zeit bei Papst Sixtus V. hatte Fontana einige Erfahrung mit verschütteten Städten und der Begierde von Päpsten und Vizekönigen, sie zu modernen Metropolen auszubauen. Sixtus hatte ihn beauftragt, spektakuläre und berühmte antike Monumente wie das Septizodium von Septimus Severus, ein Brunnenhaus aus aufgesetzten Kolonnaden aus dem 3. Jahrhundert an der Via Sacra zwischen Circus Maximus und Colosseum, niederzureißen, ebenso wie den Lateranpalast, die Residenz der Päpste seit den frühesten Anfängen des offiziellen Christentums. Im späten 16. Jahrhundert und vor allem in den expandierenden Städten Rom und Neapel genoss die moderne Ingenieurskunst so gut wie immer Vorrang vor der Erforschung und Erhaltung von Überresten aus der Antike.4
Das Studium des Altertums entwickelte sich jedoch ebenfalls, in Neapel wie anderswo, wie der erste echte Reiseführer für die Stadt zeigt, Giulio Cesare Capaccios Il forastiero (Der Auswärtige) von 1634. Capaccio liefert seine Informationen in einem zehntägigen, tausendseitigen Dialog zwischen F, dem Auswärtigen (Forastiero) und C, einem hilfsbereiten Bürger (Cittadino) von Neapel, der das, was Besucher aus Büchern über die Region erfahren haben mögen, mit einem großen Schuss Lokalkolorit untermalt. F ist ziemlich belesen, vor allem was griechische und lateinische Klassiker angeht. Am zehnten Tag ihres ausufernden Gespräches richten sie ihre Aufmerksamkeit von Neapel weg auf die kleineren Städte in der Bucht und auf den unausweichlichen Berg. „Liebend gerne möchte ich etwas über diesen Vesuv erfahren“, sagt Forastiero:
da ich bei Philostratus gelesen habe, die Neapolitaner prahlten, sie besäßen die Knochen des Giganten Alkyoneus und der anderen Titanen, die vom Blitz erschlagen und mit ihm unter diesem Berg eingeschlossen worden seien. Bei Dio Cassius habe ich zudem gelesen, vor langer Zeit habe es ein gewaltiges Feuer gegeben, dem eine große Dürre gefolgt sei und schreckliche Erdbeben, und die Ebene sei in Flammen gestanden und gewaltiges Stöhnen ertönt, die See sei in Aufruhr gewesen und der Himmel habe widergehallt und Felsen seien hervorgekommen und Dunkelheit herniedergefallen, und unter der Asche seien Fische und Vögel verendet, und die Römer seien überzeugt, die Welt sei auf den Kopf gestellt worden. Hier soll es einen Berg geben, der zu den Wundern der Welt zählt, aber ich tue mich schwer mit dem Namen: Lautet er Vesuv oder Besbio?
Und der freundliche Neapolitaner antwortet:
Dieser Berg heißt Somma, Besbio, Vesevo, Vesuvio und Vesuio, und man findet Dichter, die von den „vesuvischen Feuern“ sprechen. Was Dio Cassius berichtet, ist absolut wahre Geschichte, und die Feuer haben sich viele Male verflüchtigt. Zu Zeiten des Kaisers Titus trugen sich nicht nur die Dinge zu, die Dio nennt, vielmehr gingen zwei Städte in der Asche unter, Herculaneum und Pompeji, deren Überreste man Torre del Greco und Torre Annunziata nennt. (…) Ich will dir Herculaneum zeigen, wo viele Monumente aus alter Zeit zu finden sind: Statuen, Inschriften, unterirdische Plätze und so viele Herkulesbüsten, dass die Stadt sicherlich diesem Gott geweiht gewesen sein muss; und sie sollte mit Pompeji verbunden sein, der Heimatstadt von Senecas Freund Lucilius. Und beide Städte wurden von dem großen Feuer des Vesuvius verschüttet, als Regulus oder Memmius und Virginius Konsuln waren.5
Nach dieser Einführung möchte der Auswärtige etwas über den Ausbruch von 1631 erfahren, und der Neapolitaner ist als Augenzeuge hocherfreut, seinem Wunsch in allen Einzelheiten nachzukommen. Am Ende seines Führers widmet Capaccio weitere 86 Seiten zusätzlichen Dialog dem „Großen Feuer des Vesuvs“.
Für einen Neapolitaner war jeder nicht in Neapel Geborene ein „Forastiero“, und dass Capaccio seinen Führer in der italienischen Landessprache verfasste, deutet darauf hin, dass viele oder die meisten Leser wohl Besucher aus den Provinzen, aus Rom und Hafenstädten wie Palermo, Genua und Venedig waren. Forastieri kamen aber auch aus ferneren Gegenden. 1618 besuchte der deutsche Professor Philipp Klüwer von der Universität Leiden die Bucht von Neapel; er hatte vor, die gesamte italienische Halbinsel zu vermessen. Mit seinem ehemaligen Leidener Studenten Lukas Holste, auf den der Funke der Begeisterung übergesprungen war, bereiste der Mann, der heute als Begründer der modernen historischen Geografie gilt, die Halbinsel zu Fuß und verglich das, was er vorfand, mit den Schriften früherer Geografen. In Italien wie in universitären Kreisen kannte man die beiden unter den lateinischen Versionen ihrer Namen, Philippus Cluverius und Lucas Holstenius, und weil sie auf Latein publizierten, gilt das bis heute. Während ihrer Suche nach Pompeji vermutete Klüwer, die antike Stadt sei identisch mit Scafati am Ufer des Sarno. Holste war sich da nicht so sicher.
Es dauerte jedoch noch einmal 19 Jahre, bis Lukas Holste eine zweite Chance bekam, nach Pompeji zu suchen – Jahre, die ihn zurück nach Hamburg führten, dann nach Paris und schließlich nach Rom, wo er zum Katholizismus konvertierte und 1636 eine Stellung als Bibliothekar bei Kardinal Francesco Barberini antrat, dem mächtigen Neffen des regierenden Papstes Urban VIII. Barberinis Bibliothek war eines der Wunder Roms im 17. Jahrhundert, voll gepackt mit Kunstwerken und wissenschaftlichen Instrumenten, darunter zwei Armillarsphären, die das kopernikanische Sonnensystem darstellten, und eine ganze Reihe von Büchern, die die Inquisition verboten hatte. Da Kardinal Francesco Mitglied der Inquisition war, durfte er lesen, was immer er wollte.6
1637 indes trennte sich Kardinal Francesco vorübergehend von seinem Bibliothekar und schickte ihn nach Neapel, gemeinsam mit einem weiteren deutschen Intellektuellen, den er nach Rom berufen hatte: dem Jesuiten Athanasius Kircher, der seit 1633 am Collegium Romanum des Ordens Mathematik lehrte und Ägyptologie, Magnetismus und viele weitere Fachgebiete studierte. Neben ihren Stärken als Gelehrte zeigten Kircher und Holste auch großes Talent im Bekehren von Protestanten zum Katholizismus, vor allem von deutschen Protestanten, und 1636 gelang es Holste, der selbst Konvertit war, einen reichen deutschen Herzog zu bekehren. Es handelte sich um Friedrich, Landgraf von Hessen-Darmstadt (1616–1682), einen Drittgeborenen mit starkem Hang zum Geldverprassen und einer Leidenschaft für die draufgängerischen Malteser. Der junge Mann lebte seit 1635 in Rom, häufte Schulden an und träumte von militärischem Ruhm. Nach seiner Bekehrung konnte er endlich dem Ritter- und Hospitalorden vom Heiligen Johannes von Jerusalem, von Rhodos und von Malta beitreten, nachdem Kardinal Barberini und einige weitere Prälaten beim Großmeister des Ordens interveniert hatten. Als der Landgraf eine Genueser Galeere von Rom nach Malta bestieg, gingen Holste als Lehrer und Kircher als sein Beichtvater mit an Bord, wofür vermutlich Kardinal Barberini gesorgt hatte. Bei jedem Zwischenstopp, auch dem zehntägigen Aufenthalt in Neapel, schrieb Holste detaillierte Berichte an Barberini, die bis heute in der Bibliothek des Vatikans aufbewahrt werden.7
Im Mai 1637 legte die Galeere in Miseno an; so lautete im 17. Jahrhundert der Name von Misenum, dem antiken Hafen der kaiserlich-römischen Flotte am Nordende der Bucht von Neapel. Aus Misenum war Plinius d. Ä. 79 n. Chr. aufgebrochen, um Opfer des Vulkanausbruchs zu retten, und in Misenium hatte Plinius d. J. sein Leben gerettet, indem er zu Hause geblieben war, um sich seinen Studien zu widmen. Im Mai 1637 konnte man sich diese lange zurückliegende Katastrophe nur zu deutlich vorstellen, weil die Katastrophe von 1631 erst fünfeinhalb Jahre zurücklag und der Vulkan immer noch tätig war (und bis 1944 blieb). Die Eruptionen von 79 und 1631 erfolgten nach vielen Jahren der Ruhe, beide Male explodierte ein Steinpfropf, dessen Fragmente in die Luft flogen, worauf tödliche pyroklastische Ströme folgten, und beide Male spuckte der Vulkan keine Lava, sondern Asche und Lapilli (der Ausbruch von 1631 wird heute als „sub-plinianisch“ klassifiziert, als weniger drastische Variante des größeren „plinianischen“ Ausbruchs von 79). Weil wir nicht über visuelle Aufzeichnungen des „plinianischen“ Ausbruchs verfügen (es gibt ein „Vorher“-Bild des Hauses der Jahrhundertfeier, aber keines von danach), wissen wir nicht, wie die Eruption von 79 das Bild der Bucht von Neapel veränderte. Der Ausbruch von 1631 öffnete ein neues Loch im Berg, sprengte dann seine Spitze weg, woraufhin der Vesuv mit einem zerklüfteten, zweizackigen Profil über den glitzernden Hängen schwarzer vulkanischer Asche erkaltete.
Die Genueser Galeere, die im Schatten dieses neuen gezackten Vesuvs anlegte, wurde von Segeln und fast 200 Ruderern angetrieben und war eines der schnellsten Schiffe der Welt. Es hieß, eine solche Galeere kündige sich schon lange vor ihrer Einfahrt in einen Hafen durch ihren Gestank an. Die Besatzung bestand überwiegend aus Sklaven und verurteilten Kriminellen, deren körperliche Hygiene außer sie selbst niemanden kümmerte.
Diese Galeere hatte allerdings neben ihren raubeinigen Ruderern eine kostbare Fracht an Bord: den Landgrafen und sein Gefolge, unterwegs nach Malta. Die Betreuer des Landgrafen hatten bereits mitbekommen, dass es nicht leicht sein würde, sich vom römischen Luxus an die Unbilden der maltesischen Ritterschaft umzugewöhnen. Neben anderen Vorteilen (etwa der Geschwindigkeit) brachte das Andocken in Miseno etwas Distanz zwischen den jungen Landgrafen und den Versuchungen von Neapel. Als die Galeere, deren Fahrt kaum richtig begonnen hatte, schließlich anlegte, hegte Holste zudem ernsthafte Zweifel an Kirchers Eignung als Beichtvater.8 Zumindest aber konnten sich die beiden Gelehrten in dieser Region, die so reich an Wundern der Natur und Geschichte war, in gebildeten Gesprächen ergehen. Als dynamische Männer in ihren 30ern waren sie begierig, die stinkende Galeere zu verlassen, sobald sie den Hafen erreicht hatte, um den legendären Anblick der Phlegräischen Felder und Neapels zu genießen und ihre eigenen Eindrücke mit Holstes Erinnerungen an seine Reise durch die Gegend zwei Jahrzehnte zuvor zu vergleichen, die in den vier Bänden von Philipp Klüwers Italia antiqua, 1624 postum erschienen, verewigt sind.9
Viel mehr als für die mögliche Lage Pompejis interessierte sich Pater Kircher für den Vulkan, der es verschüttet hatte. Er war im Oktober 1633 nach Rom gekommen, ein Flüchtling der Schlächterei des Dreißigjährigen Krieges. Offiziell übernahm er einen Lehrstuhl für Mathematik am jesuitischen Collegium Romanum, seine inoffiziellen Pflichten interessierten die hohen Herren der Kirche indes weitaus mehr. Kircher behauptete, als einziger seiner Zeitgenossen ägyptische Hieroglyphen lesen zu können, und das war der wahre Grund für seinen Ruf nach Rom im Auftrag von Kardinal Barberini, dessen eigene wissenschaftliche Interessen fast ebenso weitläufig waren wie Kirchers. Dieser erwies sich bald aus einem anderen, weniger auffälligen Grund als wertvoll: Wie der Landgraf war er in der hessischen Region zwischen dem katholischen und dem protestantischen Teil Deutschlands (dem späteren Grenzgebiet zwischen BRD und DDR) aufgewachsen. In Rom machte ihn diese Kriegserfahrung zur wichtigsten Anlaufstelle für Deutsche, die zum Katholizismus konvertiert waren; er erwies sich als einfühlsamer Vertrauter für Menschen, die nicht selten von den schrecklichen Dingen, die sie erlebt hatten, traumatisiert waren.
Beim Landgrafen waren all diese Fähigkeiten nutzlos, ebenso wie Holstes Unterweisungen in Geschichte und Literatur. In der unbehaglichen Dreiergesellschaft blieb Holste und Kircher wenig Zeit, die Bucht von Neapel zu erkunden. Stattdessen brachten sie ihren enttäuschenden Aufenthalt größtenteils damit zu, von einem Empfang zum nächsten zu eilen, gemeinsam mit dem spanischen päpstlichen Gesandten Kardinal Spinola und ihrem schmollenden Mündel. Aber der Stress und die Enttäuschungen der Reise stählten ihren ohnehin eisernen Willen noch mehr; ein unmittelbarer Erfolg ihres zehntägigen Besuches in der Bucht von Neapel war, dass Holste als erster moderner Gelehrter die Lage Pompejis korrekt identifizierte und Kircher eine fantasievolle barocke Theorie über irdische Kreisläufe formulierte, die von tiefen Bewegungen im Inneren des Planeten erzeugt werden – nicht ganz die moderne Plattentektonik, aber ein erster Schritt in diese Richtung.
Holste konnte sich dem Landgrafen als Erster entziehen; am 7. September 1637 war er wieder in Neapel, um Bücher für Barberinis Bibliothek aufzuspüren, und kehrte dann nach Rom zurück, wo er Kardinal Francesco über Kircher berichtete:
Als ich abreiste, gestand mir der Vater, ihm gefalle seine Aufgabe nicht sehr und sie plage sein Gewissen, weil er denke, er könne nicht tun, was er für seine eigentliche Pflicht halte, und er bat mich, bei meiner Rückkehr nach Rom Eure Eminenz und seine Vorgesetzten dringend zu bitten, ihm wieder seine Studien zuzuweisen oder eine Mission in Ägypten oder dem Heiligen Land, damit er diese Länder sehen und seine Beherrschung der östlichen Sprachen vervollkommnen könne, weil dieser Hafen (Malta) jede Art sicherer Passage in diese Gegenden ermögliche.10
Einen Monat später schrieb Holste aus Benevento an den Kardinal über seine Reise durch die Contrada Arpaia genannte Region, wo der Regen eine „schöne und kuriose“ Inschrift freigewaschen hatte.11 Auch die 40 Jahre zuvor von Domenico Fontana freigelegten Inschriften nahm er erneut in Augenschein, sowie einige 1616 entdeckte, und zog aus all dem den Schluss, dass Scafati nicht der Standort des antiken Pompeji sein konnte. Vielmehr musste Pompeji dort gestanden haben, wo Fontana bei seinen Kanalarbeiten Ruinen gefunden hatte: bei der kleinen Siedlung La Civita nahe Torre Annunziata mit ihren gewaltigen Ruinen – weshalb sonst sollte ein winziges Dorf mit Weinbergen „die Stadt“ genannt werden? 1658 fasste Holste seine Schlussfolgerungen in einem langen Kommentar zu Klüwers Italia antiqua zusammen, Ergebnis jahrelangen Nachdenkens, Studierens und buchstäblich gelehrter Beinarbeit: „Es ist so sicher wie nur möglich, dass Pompeji dort gewesen sein muss, wo die größten Ruinen zu sehen sind, an dem Ort, den die Leute Civita nennen, den Ambrosius von Nola für Stabiae hielt. Steine, die unlängst ausgegraben und nach Castellammare di Stabia gebracht wurden, zeigen indes, dass es sicherlich Pompeji gewesen sein muss. Zudem bestätigt dies der Name Civita, wie Cluverius mehr als einmal an anderer Stelle festgestellt hat. Im Übrigen habe ich bereits gezeigt, dass die Entfernung zwischen Nuceria und Pompeji zwölf Meilen jenseits von Scafati gewesen sein muss.“12
Was Pater Kircher anbelangt, kam die Genueser Galeere, die den Landgrafen Friedrich und sein Gefolge 1637 nach Valetta brachte, an einer ganzen Reihe von Vulkanen vorbei: erst am Vesuv, dann an den Inseln Stromboli und Vulcano und schließlich am Ätna. Letztere drei waren dauernd aktiv und spuckten fröhlich vor sich hin, während die Galeere sie passierte. Den von Natur aus ungewöhnlich neugierigen Kircher packte eine neue Begeisterung für Vulkane und Gesteine, die noch mehr entflammte, als er das Kalksteinplateau von Malta erreichte. Deutlicher als in der üppigen Vegetation von Deutschland und Italien konnte er hier in den öden Klippen freiliegende Gesteinsschichten erkennen und den Prozess der Erosion an Küsten und in Flussbetten nachvollziehen. Der goldene maltesische Kalkstein war reich an Fossilien und Höhlen, in denen manchmal noch Menschen wohnten. In dieser eigentümlichen, entlegenen Umgebung hatte der Beichtvater zudem ungewöhnlich viel freie Zeit, um die seltsamen Phänomene der Natur zu beobachten und das Gesehene zu überdenken. Er fand einen lebenslangen Freund in Fabio Chigi, Inquisitor und apostolischer Gesandter in Malta. Dennoch, so berichtete Lukas Holste Kardinal Barberini pflichtbewusst, war Kircher sein Auftrag zuwider. Holste konnte sich nicht verkneifen, mit dem bissigem Esprit akademischer Klatschgeschichten hinzuzufügen, Kirchers Schüchternheit und Zaghaftigkeit mache ihn in Gesellschaft der Reichen und Mächtigen so gut wie nutzlos (und das während Kircher Freundschaft mit einem der beiden mächtigsten Männer Maltas schloss; der zweite war der Großmeister).13 1638 wurde Pater Kircher schließlich nach Rom zurückbeordert, wo er den Rest seines langen Lebens verbrachte (und 1680 starb). Er machte das Bestmögliche aus der Rückreise, die ihm, wie er wusste, eine einmalige Gelegenheit bot, Vulkane zu studieren. Er unterbrach seine Fahrt, um Ätna, Stromboli und Vesuv persönlich zu untersuchen. Ätna und Stromboli belohnten seine Neugier mit reger Tätigkeit, wie beide Berge das häufig tun. Für den heimkehrenden Kircher indes brachte die Erde eine ganz besondere Schau zur Aufführung. Offenbar war er einer jener Menschen, die merkwürdige Ereignisse anziehen, wohin sie auch gehen: Seine Autobiografie behauptet, er sei in eine Stampede geraten, in einem Mühlrad einen Wasserfall hinabgestürzt (zweimal), von protestantischen Söldnern gefangen genommen worden, dank einer prophetischen Vision einer Belagerung entkommen, habe auf einer fahrenden Eisscholle in einem deutschen Fluss festgesessen, Schiffbruch erlitten, und all das bevor er mit 31 Jahren nach Rom kam. 14 Nun, mit 36, erlebte Kircher zwischen Stromboli und Neapel ein Seebeben, bei dem sein Schiff von einem Tsunami durchgerüttelt wurde. Der Vesuv war sein letzter Zwischenaufenthalt vor Rom, und diesmal, ohne Landgraf und knappen Zeitplan, unterzog er ihn einer eingehenden Untersuchung. Wie 79 und 472 hatte der Ausbruch von 1631 einen Steinpfropfen, der sich im Schlot des Vulkans gebildet und ihn schließlich zur Gänze verschlossen hatte, weggesprengt. Wie Kircher sehen konnte, war der Krater nun weit geöffnet. Sein Bericht über den Ausflug, fast 30 Jahre später erschienen, bringt die Bekundung seines Schreckens (und Andeutungen über seine Tapferkeit) zur Freude des Lesers angemessen zur Geltung:
Ich langte in Portici an, einer am Fuß des Berges gelegenen Stadt; von hier aus bestieg ich in Begleitung eines getreuen Bauern, der mit den Wegen vertraut war, nachts den Berg über beschwerliche, mit Schotter übersäte und steile Pfade. Als ich den Krater erreichte – schrecklich, es auszusprechen –, sah ich, dass alles in Flammen stand mit einem unerträglichen Gestank von Pech und Schwefel. Entsetzt über diesen ungewohnten Anblick, begann ich zu glauben, ich blickte direkt in das Haus der Hölle – nichts fehlte außer den Teufeln. Man hörte die schrecklichen Seufzer, das Knurren des Bergs, dunkle Wolken von Rauch mischten sich unter Feuerbälle, die aus elf separaten Öffnungen an der Seite und am Grund des Kraters hervorbrachen, und auch ich brach aus: „O Tiefe des Reichtums von Gottes Weisheit und Wissen! Wie unergründlich sind deine Wege!“15
Als frommer Jesuit hätte Kircher ebenso wie sein maltesischer Freund, der Inquisitor Fabio Chigi, nie gewagt, ein religiöses Wunder wie das von San Gennaro in Zweifel zu ziehen. (Chigi besaß übrigens einen Gallenstein des heiligen Franz von Sales, der ihm während seiner eigenen Behandlung wegen Nierensteinen 1642 als Talisman diente; heute ruht dieser Stein mit einem Etikett in Chigis Handschrift in einem durchsichtigen Glasobelisken, den die Familie Chigi im 20. Jahrhundert anfertigen ließ.) Aber insbesondere Kircher war bestrebt, den Katholizismus vom Aberglauben zu befreien. Er glaubte an Gebete, aber auch an die Vernunft, gerade wenn Katastrophen eintraten.
Die Ersteigung des Vesuvs 1638 änderte Kirchers Ansichten zur Geologie grundlegend, und diese Ansichten hatten nichts zu tun mit Heiligen, Reliquien und göttlichem Zorn. Die Entfernungen zwischen dem Berg, seinem Gipfel und den darunterliegenden Städten abzuschreiten, verschaffte ihm ein direktes, physisches Gefühl für die Größe des Berges, die Unermesslichkeit der unter dem schwarzen Kegel wallenden Kräfte und im weiteren Sinne die viel größere Unermesslichkeit des Universums. Fünf Jahre vor seiner Reise von Malta nach Rom, im Juni 1633, war Galileo Galilei von der römischen Inquisition der Häresie für schuldig befunden und sein Dialog über die zwei wichtigsten Weltsysteme auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt worden. Kircher wusste, dass die Gefahren des Aufstieges auf den Vesuv kaum größer waren als jene, die ihm drohten, wenn er seinen Gedanken über das Universum allzu freien Lauf ließ. Aber sein Hirn war nicht zu zügeln, es litt wie stets an „mentis aestus“ („Glut des Verstands“).16
Über die folgenden 30 Jahre erarbeitete Kircher sorgfältig seine Theorie, Gott habe die Naturgesetze in der Macht der Vernunft verwurzelt und diese Gesetze dem gesamten Universum auferlegt. Als der Vesuv ausbrach, tat er dies demzufolge aufgrund gigantischer Zyklen in der Erde selbst und nicht wegen Gottes Groll auf einzelne Sünder. Kirchers Universum bewegte sich wie unser eigenes simultan in vielen abgestuften Größenordnungen, von Vorgängen in der Welt der Mikroben bis hin zu kosmischen Kreisläufen. Anders als moderne Wissenschaftler musste er jedoch aus Angst vor der Inquisition sehr genau aufpassen, wie er sich ausdrückte.17
1656, in der Mitte seiner Karriere, wusste Athanasius Kircher, dass er am Kraterrand der katholischen Orthodoxie stand. Sein jüngstes Buch Itinerarium Exstaticum (1656) behauptete rundheraus, das gesamte Universum bestehe aus der gleichen Grundmaterie, sei in seiner Ausdehnung außer in Gottes Bewusstsein unendlich, und jeder einzelne der unzähligen Himmelskörper unterliege demselben ständigen Wandel wie die Erde.18 Auf Sonne und Mond gebe es Ozeane und Vulkane, auf den Sternen ebenso. Diese Vulkane brächen aus den gleichen Gründen aus wie die auf der Erde: Auf diese Weise zirkuliere die Materie überall im Kosmos. Noch kontroverser: Weil all diese Himmelskörper feurige Zentren hätten, gebe es keinen Grund zu der Annahme, der glühende Kern der Erde sei ein Ort namens Hölle. Der Zorn Gottes habe mit keinem dieser Phänomene etwas zu tun: Sie seien natürliche Bewegungen, die sich kontinuierlich in gewaltigen Größenordnungen abspielten, und welche Auswirkungen auch immer sie auf einzelne Menschenleben hätten, beruhten sie doch auf Gottes gütiger Vorsehung.19
Als sich 1656 die Beulenpest in Rom verbreitete, führte Kircher die Seuche auf Mikroben zurück und überzeugte den Papst, Quarantänen einzuführen. Zum Glück war dieser Papst, Alexander VII., kein anderer als sein alter maltesischer Freund Fabio Chigi.20 Der Erfolg der Maßnahmen untermauerte Kirchers Theorie, die Epidemie habe natürliche, keine moralischen Gründe; zudem konnte er sich als kühler Kopf in Zeiten der Krise zeigen. Als der Vesuv im Sommer 1660 erneut Rauch ausstieß, war Kircher daher einer der ersten Experten, von denen sich die Menschen eine Erklärung erhofften. Inzwischen, im Alter von 59 Jahren, hatte er Dutzende Bücher veröffentlicht, viele davon reichlich illustriert, zu Themen wie Magnetismus, Ägyptologie, Musik, Optik, Kosmologie und Pest. Es war bekannt, dass er ein Meisterwerk zur Geologie plante, weil er es als unermüdlicher Werber in eigener Sache bereits seit fast 20 Jahren in seinen anderen Büchern ankündigte. 21
Der neuerliche Vulkanausbruch erforderte indes ein rascheres Handeln als eine groß angelegte geologische Abhandlung, weil sich in der Bucht von Neapel und anderswo in Süditalien seltsame Dinge taten. Kircher beschrieb die Vorgänge in seiner gewohnt vehementen Rhetorik:
Im Jahr 1660, am dritten Julitag, in der frühen Morgendämmerung, gab Rauch auf dem Berg Vesuv, gemischt mit Feuer, eine erste Ahnung von den kommenden Stürmen und Verhängnissen. Der Rauch schmälerte sich zur Gestalt einer Schirmkiefer und nahm so sehr zu, dass, wie Zeugen berichten, er zu einer Höhe von 300 Meilen aufschoss. Die Erde schien sich mit dem Himmel mischen zu wollen. Dem folgte unvermittelt ein gewaltiger Ausbruch feuriger Kugeln und dann ein unterirdisches Getöse und Krachen wie von schrecklichem Blitz und Donner, dann ergossen sich große Mengen von aschfarbenem, schwärzlichem Sand, die zuerst wie eine feuchte Masse aussahen, dann jedoch bald, von der Sonne getrocknet, eine Baumwollflocken nicht unähnliche weiße Färbung annahmen, ein klarer Hinweis auf eine Mischung aus Salpeter, Salz, Schwefel und Erdpech.22 Diese Auswürfe setzten sich an den folgenden Tagen fort, bis zum 10. Juli, und der Berg hörte Tag und Nacht nicht auf zu toben, mit solcher Vehemenz, so unglaublich viel Rauch und Gestein, dass man mit Recht sagen könnte, der Berg habe einen weiteren Berg ausgespien, und der stetig zunehmende und sich ausbreitende Ausfluss ließ ihn wie von Schnee bedeckt erscheinen. Und diese Art Vorzeichen hörten nicht auf; als die Sonne in den Löwen eintrat (am 21. Juli), wurden zur höchsten Verwunderung aller auf den Leinengewändern der Menschen Kreuze sichtbar, von einer gespenstischen Macht aufgedruckt, sodass sie nicht durch natürliche Kräfte, sondern durch den Pinsel einer gewissen verborgenen Hand skizziert erschienen.23
Die seltsamen Kreuze erschienen auch auf Altardecken in Kirchen, auf zum Trocknen hinausgehängten Laken und in Truhen, in denen Familien ihre Wäsche aufbewahrten. Im September 1660 sandte der in Neapel lebende jesuitische Mathematiker Giovanni Battista Zupo Kircher Zeichnungen und einen detaillierten Bericht über das Phänomen.
Kircher folgerte haarscharf, die Kreuze seien nichts weiter als Asche vom Vesuv, in Tropfen von Wasserdampf zu Boden gefallen; auf Leinen gelandet, verliefen sie mit dem Gewebe des Stoffs. Die Kreuze, verkündete er umgehend, trügen also keine göttlichen Botschaften über Bekehrung in Andacht oder den bevorstehenden Weltuntergang in sich.
Bestätigung fand seine tröstliche Erklärung in der Waschküche des Jesuitenkollegiums, wo die Katzen des Hauses auf den Leinenstapeln zu schlafen pflegten. Der diensthabende Bruder der Wäschekammer zeigte Kircher ein Tuch, auf das eine Katze uriniert hatte: Die Tropfen breiteten sich in der gleichen kreuzförmigen Weise aus wie die „wunderbaren Kreuze“ von Neapel, färbten den Stoff aber nicht aschgrau, sondern gelb. Das Gleiche, versicherte er, sei kürzlich im Spital passiert, als ein alter Jesuit von 80 Jahren unabsichtlich in sein Bett genässt hatte. Auch Öltropfen aus Lampen und Kleckse auf Tischdecken beschmutzten Webstoffe im gleichen Kreuzmuster. Wann immer eine Flüssigkeit in verwobene Fasern drang, entstanden Kreuze; der Wäschekorb der Jesuiten lieferte dafür den unverhofften, eindeutigen Beweis.24
Da seine Theorie somit durch nachvollziehbare Ergebnisse untermauert war, verfasste Kircher umgehend das Pamphlet Diatribe de prodigiosis crucibus (Streitschrift über die wunderbaren Kreuze) und schickte es an die jesuitischen Zensoren, die alle Manuskripte des Ordens prüften, bevor sie veröffentlicht werden durften. Wie so oft in seiner Laufbahn stieß er hier auf Widerstand. Die Prüfer entschieden am 7. Oktober; Kircher hatte seine Studie nur einen Monat nach den ersten Vorfällen fertiggestellt, in der Hoffnung, die brisante Lage in Neapel zu beruhigen. Die Zensoren in Rom indes waren skeptisch, obwohl ihr eigenes Waschhaus Kircher seinen Beweis geliefert hatte: „Wir finden, dass der Druck verzögert und etwas hinausgeschoben werden sollte, weil just in diesen Tagen neue Erscheinungen berichtet wurden, in der gleichen Kreuzform, nicht nur auf Leinen und Seide, sondern auch auf Fleisch und Obst, und wenn die Sonne aus dem Löwen heraustritt und wieder hoch steht, wird der Septemberregen die Ausdünstungen des Vesuvs eindämmen, und dann wird sich zeigen, ob der Autor diese und all die anderen Phänomene vollständig und getreu dargestellt hat.“25
Als De prodigiosis crucibus schließlich im März 1661 (fünf Monate später) in Druck ging, hatte Kircher eine Diskussion ähnlicher kreuzförmiger Erscheinungen auf Obst und Fleisch angefügt. Zwar seien diese organischen Substanzen nicht gewoben, stellte er fest, sie hätten aber dennoch faserige Strukturen, wie sich bei einer Betrachtung unter dem Smicroscopium (Mikroskop) zeige.
Bei seinem Bemühen, Panik zu vermeiden, musste Kircher indes eine Grenze zwischen seiner rationalen Erklärung eines Phänomens und den beschränkteren Ansichten der religiösen Orthodoxie ziehen. Bestand er darauf, die „wunderbaren Kreuze“ seien gar nicht so wunderbar, musste er seinen Lesern zugleich versichern, dass Gott sehr wohl Wunder wirke. Lediglich in diesem besonderen Fall habe der Allmächtige beschlossen, dies nicht zu tun: „Bevor wir nun die Ursachen dieses Phänomens diskutieren, muss ich allemal beteuern, dass, auch wenn dieses Phänomen ein rein natürlicher Effekt sein mag, dennoch nichts GOTT, den Höchsten und Allmächtigen, der alle Vorgänge der Natur durch seine Vorsehung bestimmt, davon abhält, diese Auswirkungen zu nutzen, um Sterblichen etwas mitzuteilen.“26
Mit anderen Worten: Eine rationale Erklärung für den Ausbruch des Vesuvs und die „wunderlichen Kreuze“ zu finden, hatte keine Bedeutung für den wundersamen Charakter ungewöhnlicher Ereignisse wie der Verflüssigung von San Gennaros Blut. Zudem zeige gerade die Vielfalt und Unregelmäßigkeit der Kreuze, dass sie mangelhafte Kreationen der unregelmäßigen Natur und keine vollendeten Schöpfungen Gottes seien.
Vier Jahre nach diesem besonnenen kleinen Pamphlet legte Kircher die gewaltige Studie vor, auf der die kühnen Behauptungen beruhten. 1665, fast 30 Jahre nach seiner Maltareise und der ersten leidenschaftlichen Begegnung mit der Geologie, erschien Kirchers Meisterwerk Mundus subterraneus (Die unterirdische Welt) im protestantischen Verlag von Johan Jansson in Amsterdam mit einer Widmung an seinen alten Freund aus Malta, Papst Alexander VII. Dessen persönliches Exemplar steht heute noch in der Bibliothek des Vatikans. 27
In dieser gewaltigen Studie, die drei Jahrzehnte geologischer Forschungen zusammenfasst, erscheinen Vulkane als unentbehrliche Rädchen in den großen Zyklen der Natur, und der Vesuv spielt unter ihnen eine herausragende Rolle (Abb. 3.1). Wie die überwiegende Mehrheit seiner Zeitgenossen glaubte Kircher, die Welt bestehe aus den vier traditionellen Elementen Erde, Luft, Feuer und Wasser. Das offizielle jesuitische Curriculum befürwortete zwar die Lehre der Philosophie des Aristoteles, aber Kircher wandte sich offen gegen die aristotelische Theorie, der Mond und andere Himmelskörper bestünden aus einem fünften Element, der Quintessenz. Ihm zufolge wiesen Sonne, Sterne und Planeten die gleiche Zusammensetzung auf wie die Erde, was laut seinem früheren kosmologischen Werk Itinerarium Exstaticum den Vorteil hatte, dass ein Mensch überall im Universum getauft werden könne. 28
3.1. Der Vesuv. Aus Athanasius Kircher, Mundus subterraneus, 1665 und 1678. Foto: Snark/Art Resource, New York.
Natürlicherweise bestehe die Erde in erster Linie aus dem Element Erde, jedoch bilde dieses vorherrschende Element gemischt mit anderen zu unterschiedlichen Anteilen verschiedene Arten der Materie. Wie Kircher aus persönlicher Erfahrung versichern konnte, sammelten sich die anderen Elemente in riesigen unterirdischen Lagern von Feuer, Wasser und Luft. Zusätzlich zu seinen geologischen Untersuchungen auf Sizilien und Malta war Kircher auch ein eifriger Höhlenforscher; der poröse Kalkstein auf der italienischen Halbinsel, Sizilien und Malta bot ihm reichlich Gelegenheit, zu erkunden, was er gerne die „Eingeweide der Erde“ nannte. Unterirdische Speicher von Luft und Wasser hatte er mit eigenen Augen gesehen und vermutet, die Hitze, die er unter dem Vesuv und der Solfatara spürte, müsse von unterirdischen Feuerspeichern herrühren, die jenen ähnlich waren. Für diese Lagerstätten fand er beeindruckende, aus dem Griechischen hergeleitete Bezeichnungen: „pyrophylacium“ für Feuer, „hydrophylacium“ für Wasser, „aerophylacium“ für Luft (wobei „phylacium“ „Speicher“ bedeutet). Sie konnten auch mehr als ein Element enthalten: Wasser und Luft bildeten heiße Quellen, Wasser, Luft und Feuer brodelnd heiße Quellen, wie man sie in Mittel- und Süditalien häufig findet.
Diese Grundelemente blieben nie lange an einem Ort, sie waren ständig in Bewegung, mischten und trennten sich, verbanden sich und brachen auseinander. Vulkane spien Erde aus ihren Schloten und schufen neue Berge. Wasserspeicher tief unter den Gebirgen speisten Flüsse. Regen und Flusswasser erodierten die Berge, trugen Geröll ins Meer, wo Schlamm und Wasser über riesige Wasserwirbel wieder von der Erde eingesaugt wurden. Kircher hatte die Gezeitenwirbel in der Straße von Messina beobachtet und von einem Strudel an der norwegischen Küste gehört, den man Mahlstrom nannte; er hatte auch gesehen, wie die Wasserfälle bei Tivoli nahe Rom tief in Kalksteinhöhlen hinabstürzen.
Er schloss, die Erdoberfläche mache über große Zeitspannen gewaltige Kreisbewegungen durch, in deren Verlauf Kontinente und Ozeane entstanden, untergingen und neu entstanden. Das Schicksal des in den Wellen versunkenen Atlantis blühe eines Tages jedem Stück trockenen Landes, wie auch die Eruption von Vulkanen eine Folge des ewigen Kreislaufes von Erde und Feuer sei.
Weil diese Theorie modernen Vorstellungen von der Bewegung der Erdkruste nicht unähnlich ist, verehren manche zeitgenössische Geologen, etwa Haraldur Sigurdsson, Kircher als den wahren Vater der Plattentektonik und Mundus subterraneus als erste detaillierte Darstellung dieser Materie. Dem Jesuiten Kircher bereitete es jedoch einige Schwierigkeiten, sich diese gewaltigen geologischen Bewegungen in einem Zeitraum von nur 6000 Jahren vorzustellen, da die katholische Kirche nun mal darauf bestand, die Erde sei im Jahr 4004 v. Chr. erschaffen worden. Da er um die 20 Sprachen lesen konnte (nach seiner eigenen Rechnung 23, wozu auch ägyptische Hieroglyphen zählten), wusste Kircher, dass die Griechen und die alten Ägypter in weitaus größeren Zeiträumen dachten als katholische Christen. Platon hatte die Zerstörung von Atlantis um 9500 v. Chr. angesetzt, Jahrtausende vor der angeblichen Schöpfung, und die ägyptische Liste bekannter und verzeichneter Könige reichte bis 5000 v. Chr. zurück. Es war schwer vorstellbar, dass Berge und Kontinente in dem Tempo entstanden und untergingen, das eine lediglich 6000 Jahre alte Welt erwarten ließe, und Kircher selbst konnte sich eine Welt, die sich so schnell veränderte und so jung war, nicht ausmalen.
Daher suchte er nach Wegen, die orthodoxe Doktrin mit seinen Beobachtungen in Einklang zu bringen, und fand ein paar dienliche Schlupflöcher. Für gewöhnlich jedoch umging er kontroverse Themen, indem er einfach den anerkannten Standpunkt und seinen eigenen nebeneinanderstellte, als widersprächen sie einander nicht. Diese Vorgehensweise musste einigen der jesuitischen Gutachter, die seine Texte prüften, sauer aufstoßen.
Im Falle der langfristigen geologischen Phänomene ging Kircher davon aus, das Universum sei Äonen lang eine „chaotische Masse“ („massa chaotica“) gewesen, bevor Gott es durch die Schöpfung zur Ordnung rief. Dieser unbegrenzte Zeitraum gab den Elementen reichlich Zeit, sich zu mischen, zu gerinnen und erneut zu zerfallen, ohne der Heiligen Schrift zu widersprechen. 29
Brisanter war, dass Kircher meinte, Vulkane und vulkanische Aktivität beschränkten sich nicht auf die Erde. Der Mond und die Sonne seien den gleichen großen Kreisläufen unterworfen, weil sie ebenfalls ungleichmäßige, elementare Körper seien, die ständig turbulente Veränderungen durchmachten. Die Annahme von Unregelmäßigkeiten in Himmelskörpern lief Aristoteles zuwider, aber jesuitische Astronomen hatten bereits seit Gründung des (1540 privilegierten) Ordens die Forschung vorangetrieben, vor allem an ihrem Kollegium in Rom, wo aus irgendeinem Grund lange vor Kircher deutsche Astronomen diese Disziplin dominierten. Darunter waren Christophorus Clavius, der Erfinder des Gregorianischen Kalenders (1583), und Christoph Scheiner, ein wichtiger Erforscher von Sonnenflecken. Kircher borgte sich (oder plünderte) Scheiners Studien und seine Stiche für Mundus subterraneus, um geltend zu machen, Sonnenflecke seien Rauchfahnen solarer Eruptionen. Was den Mond betraf, hatte Galileos Teleskop bereits 1609 gezeigt, dass es dort Berge und Meere gab wie auf Erden, wenngleich Kircher argumentierte, diese Elemente seien an der Mondoberfläche leichter als ihre irdischen Gegenstücke.30
Für seine Zeit war Mundus subterraneus also eine wichtige Darstellung zu Vulkanen (obgleich Sean Cocco gezeigt hat, dass in Wirklichkeit die Neapolitaner dank ihrem direkten Umgang mit jeder Laune des Vulkans an vorderster Front der geologischen Forschung standen). Dennoch wurde Kirchers Illustration des Innenlebens des Vesuvs, nach seinen bezaubernd unbeholfenen, grell bunten Zeichnungen (die in Rom aufbewahrt werden) von einem Profi in Amsterdam gestochen, für Jahrhunderte zum gültigen Querschnitt eines Vulkankegels.31
Wichtig für die Nachwelt war, dass Mundus subterraneus den Ausbruch von Vulkanen als reines Naturphänomen darstellte; die Kreisläufe der Erdoberfläche wie die von Sonne, Mond und Sternen unterlagen den Naturgesetzen, die in einer unermesslich höheren Größenordnung verliefen als menschliche Händel. Für Kircher wie schon für Giordano Bruno vor ihm waren diese gewaltigen natürlichen Vorgänge nur ein Teil einer viel komplizierteren Geschichte.
Die Natur wirkte nämlich auch auf einer Ebene, die fast unvorstellbar winzig war. Bruno war ein überzeugter Atomist, der daran glaubte, dass an chemischen Reaktionen für das Auge unsichtbare Partikel beteiligt waren; er formulierte diese Ideen lediglich mithilfe seiner Vorstellungskraft. Kircher andererseits arbeitete mit Teleskop und Mikroskop oder, wie er sie nannte, astronomischen Röhren und dem Smicroscopium.
Auf dieser kleinsten, fast elementaren Ebene argumentierte Kircher, die ursprüngliche chaotische Masse sei mit dem Funken des Lebens erfüllt gewesen, einer Kraft, die er „panspermia rerum“ nannte: die universelle „Saatkraft“ oder „Fruchtbarkeit der Dinge“.32 Dieser Lebensfunke könne durch Sonnenstrahlen entzündet werden; man finde ihn auch im Herzen eines Vulkans. Wie die meisten Besucher auf vulkanischen Hängen hatte er bemerkt (oder von Ortsansässigen erfahren), dass die Erde um Vulkane, wenn die tödliche Hitze der pyroklastischen Ströme und Lavaflüsse erst einmal verflogen ist, außerordentlich fruchtbar ist. Im frühen 20. Jahrhundert übernahm der schwedische Chemiker (und Nobelpreisträger) Svante Arrhenius Kirchers Panspermia-Konzept für seine Theorie, das Leben sei zuerst im Kosmos entstanden und von dort auf die Erde gelangt.33
Was den Landgrafen Friedrich von Hessen-Darmstadt anbelangt, wurde dieser kurz nach seiner Ankunft in Malta zum Koadjutor des Fürst-Großpriors der deutschen „Langue“ (des Deutschen Reiches) des Malteserordens ernannt. 1640 stellte er eine eigene, von seinem Bruder finanzierte Flotte zusammen und führte sie in eine siegreiche Schlacht gegen die Türken vor der tunesischen Küste. Leider genügte die dabei errungene Beute nicht, um seine kleine Seemacht zu unterhalten. 1641 legte er sein Kommando nieder und zog wieder nach Rom, wo ihn Kardinal Barberini als wichtigen Neuzugang im katholischen Lager finanziell unterstützte. Wenige Monate später ging der Landgraf nach Wien, dann nach Madrid und Brüssel, und wurde 1650 Kardinal. Ein Militärkommando kam in dieser Stellung für ihn nicht infrage, inzwischen war Friedrich aber auch reichlich aufgedunsen. So erhielt er offenbar stattdessen den Auftrag, deutsche Interessen bei der Kurie zu vertreten, was er tat, indem er legendär aufwendige Feste gab. 34 Es ist vielleicht kein Zufall, dass sein Lehrer und sein Beichtvater so viel ihrer Zeit auf Malta mit Diskussionen über Themen wie die Lage Pompejis und die Kreisläufe der Erdkruste verbracht hatten, während ihr junger Schützling in seiner Rüstung herumlief und eine Party nach der anderen feierte.
Trotz Holstes überzeugenden Argumenten und der Existenz von Inschriften und Ruinen dauerte die Debatte, wo Pompeji wirklich lag, noch fast ein Jahrhundert an. Schließlich, stellten seine italienischen Zeitgenossen fest, war er Deutscher, und was wussten Deutsche schon von Italien? Die gleiche Kritik äußerten sie über Kircher, obwohl beide Männer den größten Teil ihres Lebens in Rom verbracht hatten.
Ironischerweise gelang es einem weiteren Ausländer, das Problem der Lage Pompejis endgültig zu lösen: Emmanuel-Maurice, Prinz (später Herzog) von Elbeuf (1677–1763). Der jüngste Sohn eines unbekümmerten französischen Kavallerieoffiziers (der 1681 in der Bastille gelandet war, weil er in Versailles einem anderen Tischgast mit einer Hammelhaxe auf den Kopf geschlagen hatte) lebte ebenso unstet wie sein Vater.35 In einem Anfall von Groll hatte er 1706 den Hof von Ludwig XIV. verlassen, um ein Heer für den heilig-römischen Kaiser in Wien zu führen, den eingeschworenen Feind des Sonnenkönigs, weshalb ihn Ludwig folgerichtig in effigie aufhängen ließ. Da er die Seiten gewechselt hatte, gelangte der jüngere d’Elbeuf ohne Mühe 1709 von Wien ins verbündete Neapel. In Italien wurde er Kapitän der kaiserlichen Kavallerie und heiratete eine örtliche Gräfin (was seinen Kommandanten offenbar so ärgerte, dass er fast seine Stellung verloren hätte).36 Der nächste Schritt für d’Elbeuf war wie für so viele seiner Kameraden, sich ein Landhaus in dem neapolitanischen Vorort Portici erbauen zu lassen, wofür er 1713 den brillanten einheimischen Architekten Ferdinando Sanfelice engagierte (Abb. 3.2). Als er hörte, eine Frau im nahe gelegenen Resina habe beim Graben nach einer Quelle farbigen Marmor gefunden, kontaktierte er sie als mögliche Lieferantin für die Innenausstattung seiner Villa. Der Brunnen erwies sich als regelrechte Mine von antikem Marmor; es fanden sich unter anderem drei Frauenstatuen, die d’Elbeuf aus dem Land schaffte, um sie seinem Cousin zu schenken. Bald stieß jeder, der Lust hatte, sich 20 Meter tief durch den harten Boden von Resina zu graben, auf antike Artefakte. Aus antiken Quellen wusste man wie Giulio Ceasare Capaccio schon ein Jahrhundert zuvor, dass diese Funde nicht aus Pompeji, sondern aus Herculaneum stammen mussten; die Entdeckung unterirdischer Bauwerke löste nun aber ganz andere Reaktionen aus. Domenico Fontana grub in den 1590ern einfach weiter an seinem Kanal, auch nachdem dieser eine römische Stadt durchschnitten hatte, aber die Neapolitaner des 18. Jahrhunderts wollten etwas über ihre antike Vergangenheit erfahren. Aus dem Brunnen von Resina entstand etwas, das einer echten archäologischen Ausgrabung sehr ähnelte.
D’Elbeuf hatte nicht lange Freude an seiner Villa. 1719 wurde er von der französischen Krone begnadigt und eilte nach Paris, um die Gelegenheit zu nutzen. 1748 wurde er zum Herzog von Elbeuf ernannt, und im selben Jahr stieß die Schaufel eines Ausgräbers auf eine weitere verschüttete Stadt: Pompeji. Seine schöne Villa war inzwischen an den König von Neapel gefallen.
Im März 2013, 300 Jahre nach dem Bau der Villa d’Elbeuf, erschien in italienischen Zeitungen eine ungewöhnliche Anzeige: Genau dieses Anwesen, oder was davon noch übrig war, stand nun nach unzähligen Umgestaltungen und einem verheerenden Weltkrieg gegen Höchstgebot zum Verkauf (bald nach d’Elbeufs Wegzug hatte sich König Karl III. die Villa geschnappt, nach dem Untergang des Königreiches Neapel diente sie nacheinander als Hotel, Apartmenthaus und Restaurant). In den Auktionsdokumenten und in Zeitungsberichten über ihre Geschichte wurde ihr Name fast durchgehend falsch geschrieben („Elboeuf“) – Elbeuf ist eine französische Stadt, die mit „boeuf“ (frz. Rindfleisch) nichts zu tun hat:
3.2. Ferdinando Sanfelice, Villa d’Elbeuf (später Villa Bruno), Granatello, Portici, 1713. Alte Ansichtskarte.
Lot 778269; Grundstück mit Gebäudekomplex in Portici (Neapel), Via Peschiera 15.
Gebäudekomplex Villa d’Elboeuf, baufällig und zur Gänze leer stehend, bestehend aus a) einem kleinen Haus, einstöckig, ehemalige Portiersloge; b–c) einer Villa und einem „Fischerhaus“ mit 40 Wohneinheiten; d) Garten- und Parkgrundstücken mit darunterliegendem ehemaligem Restaurant, dient jetzt als Lagerraum; e) Komplex aus Steinmauern, derzeit leer stehend und zerstört, teilweise vollständig vom Meer überschwemmt und dem Staatsbesitz zugerechnet, Ministerium der Marine. 3960,6 Quadratmeter.
Es war die vierte Versteigerung seit 2009, als die Villa enteignet und vom Staat zum Verkauf angeboten worden war; bei den ersten drei Auktionen fand sich kein Käufer, und es gab Grund zu der Befürchtung, das einst so schöne Anwesen könnte der Camorra, der mächtigen neapolitanischen Mafia, in die Hände fallen. Die Strandpavillons werden in der Anzeige als „leer stehend und zerstört“ beschrieben (in einer anderen Version der Anzeige in La Repubblica heißt es „verfallen“), und Lokaljournalisten enthüllten in einer Reihe von Artikeln, wie schockierend heruntergekommen das einst so prächtige Anwesen in den vergangenen Jahrzehnten war.37 Der Nennpreis für das Hauptgebäude lag im März 2013 bei 3,5 Millionen Euro, die verfallenen Pavillons sollten nur ein Zehntel kosten. Im April 2013 wurde das gesamte Anwesen für 4 Millionen an ein Konsortium örtlicher Unternehmer verkauft.38 Die Käufer der Villa d’Ebeuf müssen sich mit den modernen Autobahnen und Eisenbahnlinien abfinden, die es 1713 noch nicht gab und die die Esplanade zum Strand durchschneiden – und effektiv zerstören.
Das italienische Kultusministerium betreute die Restaurierung der Villa, zu deren bedauernswertem Verfall es erst in jüngerer Zeit kam. Die Villa d’Elbeuf war noch ein großartiges und gut erhaltenes Anwesen, als sie Mitte des 20. Jahrhunderts für eine Ansichtskarte fotografiert wurde (Abb. 3.2). Manchmal braucht es keinen Vulkanausbruch, um ein Gebäude zu zerstören. Desinteresse und Vernachlässigung sind im Lauf der Zeit genauso wirksam.