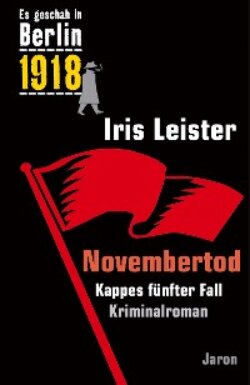Читать книгу Novembertod - Iris Leister - Страница 6
Sonntag, 10. November1918
ОглавлениеDER BAU DES ZIRKUS BUSCH wölbte sich in die herabsinkende Dämmerung. Es sah aus, als würde diese die bunten Farben, in denen das Gebäude gestrichen war, seine Türmchen und Dächlein, die dem Rundbau der Manege vorgelagert waren, wegsaugen und nichts als trübes Grau hinterlassen. Auf dem spitzen Giebel des Hauptportals breitete der Metalladler seine schwarzen Flügel aus und starrte reglos auf die Menschenmassen, die sich unter ihm durch den Eingang schoben. Kappe fühlte sich klein und hilflos. Margarete wurde abgedrängt und stolperte. Sie wäre von den Nachfolgenden niedergetrampelt worden, wenn nicht Trampe und ein Postkartenhändler im abgeschabten Anzug ihr aufgeholfen hätten. Der Mann trug ein Drahtgestell vor dem Bauch, in dem Postkarten mit verschiedenen Motiven steckten.
«Danke, Genossen!» Margarete lächelte.
Der Postkartenhändler lächelte zurück. «Revolutionspostkarte, die Dame?», fragte er. «Glänzendes Souvenir, das. Nur 25 Pfennig.» Margarete kaufte ihm eine Karte ab. Dann wurde der Mann auch schon weitergestoßen und verschwand in der drängenden Masse, einem Meer aus fadenscheinigen Mänteln, zerschlissenen Anzugjacken und geflickten Uniformen. Fast alle trugen eine rote Armbinde.
Margarete zeigte ihre Postkarte: Vor dem Brandenburger Tor stand ein offener Mannschaftswagen, auf dem grinsende Soldaten eine Fahne schwenkten. Zivilisten standen um sie herum und bestaunten sie. Eine krakelige Aufschrift erklärte: Die Freiheitsbewegung in Berlin. Straßenszene am 9. November 1918. «Die bring ich Klara mit», sagte Margarete.
«Dass die heute schon auf dem Markt sind! Das war doch erst gestern.» Trampe staunte.
Kappe, dem der Schreck des vorangegangenen Morgens noch in den Knochen steckte, fragte sich, wie Margarete und Trampe inmitten dieser dicht an dicht drängenden und schiebenden Menschen, deren Geruch nach billigen Buchenlaubzigaretten, Hunger, Schweiß und Aufregung ihm plötzlich so intensiv vorkam, dass er sofort an Klaras geschärften Geruchssinn denken musste, so entspannt sein konnten. Das Alte war zerstört, und es war unsicher, was jetzt kommen sollte. Kappe, der nun sogar das brackige Wasser der nur wenige Meter entfernt fließenden Spree zu riechen glaubte, machte sich Sorgen um die Zukunft. Vor allem aber machte er sich Sorgen um Klara.
Am Morgen war er mit Margarete ins Krankenhaus gegangen. Schwester Hedwig hatte ihnen beiden mit müdem Blick die Diagnose verkündet. Klara hatte eine Schwangerschaftsvergiftung. Sie würde im Krankenhaus bleiben und dort auch entbinden müssen. Die Schwester hatte die beiden in das Krankenzimmer geführt, in dem noch elf andere Frauen lagen. Klara war ein Häufchen Elend. Sie wollte nicht im Krankenhaus bleiben. Aber sie war zu schwach, um sich durchzusetzen. Blass und klein hatte sie in ihrem Krankenhausbett gelegen. Kappe war sie vorgekommen wie eine rätselhaft aufgeschwollene Puppe. Während er vor Sorge und Nervosität ganz stumm gewesen war, hatte Margarete geplappert wie ein Wasserfall. Es war ihr tatsächlich gelungen, ein kleines Lächeln auf Klaras Gesicht zu zaubern. Kappe war ihr in diesem Moment unglaublich dankbar gewesen. Dann war Klara eingeschlafen, und Schwester Hedwig hatte sie aus dem Zimmer geholt. Kappe, der dienstfrei hatte, war nichts anderes übriggeblieben, als nach Hause zu gehen. Ins Büro, wo er wahrscheinlich auf Galgenberg getroffen wäre, hätten ihn keine zehn Pferde gebracht. Margarete hatte noch zu einer Sitzung gemusst und sich verabschiedet.
Kappe hatte schlechtgelaunt in der ungeheizten Wohnung gesessen, an Klara und das Kind gedacht. Er hatte sich Vorwürfe gemacht, sich zu viel um sein eigenes Wohlergehen gesorgt zu haben, wenn er, statt auf den Schleichhandel zu gehen, um Lebensmittel und Kohle zu erstehen, Klara vertröstet hatte. Seine Angst, als Beamter von den Kollegen des Kriegswucheramtes erwischt zu werden, war zu groß gewesen. Sogar wenn Klara selbst losgezogen war, hatte er ihr Vorhaltungen gemacht. Sein schlechtes Gewissen war wie ein übelwollender Verwandter, der ihm alle seine kleinen und großen Verfehlungen ins Ohr zischte. Er war sich lächerlich und kleinlich vorgekommen. Gerade als er sich in Selbstvorwürfen zu verlieren drohte, hatten Margarete und Trampe geklingelt und ihn mit fürsorglicher Gewalt gezwungen, sie zum Zirkus Busch zu begleiten, wo der Rat der Volksbeauftragten gewählt werden sollte. Beide trugen rote Armbinden, auf denen das Wort Arbeiterrat aufgedruckt war.
Die Sonne schien, und Kappe war mit ihnen durch ein brodelndes Kreuzberg bis zum Bahnhof Jannowitzbrücke gelaufen, die Straßen vollgestopft mit Arbeitern, die ebenfalls zum Zirkus Busch wollten. Die drei hatten sich in die S-Bahn gesetzt und waren bis zum Bahnhof Börse gefahren. In der S-Bahn hatte Margarete mit Trampe Streit darüber angefangen, dass die Mehrheitssozialisten die Revolution im Keim ersticken wollten. Kappe hatte fast den Eindruck, dass sie das absichtlich tat, um ihn abzulenken.
«Kein Bruderkampf», hatte sie verächtlich gesagt. «Als ob es darum ginge. Euer Ebert will doch nur das alte Reich mit neuem Etikett. Ich wette, der hätte am liebsten noch den Kaiser zurückgeholt.»
Trampe hatte wütend etwas vom Bolschewismus gezischt.
«Aber davon redet doch niemand. Die meisten Arbeiterräte sind doch von euch!» Margarete wandte sich an Kappe. «Kappe, wie siehst du die Sache?»
Kappe war froh, dass der Zug in diesem Moment in den Bahnhof Börse einfuhr und er um eine Antwort herumkam. Er hatte das Gefühl, zwischen allen Stühlen zu sitzen, und hoffte, nach der Veranstaltung im Zirkus Busch klarer zu sehen. «Ich denke, ich muss mir erst mal anhören, was die da drinnen zu sagen haben.»
«Aber du musst doch eine Meinung haben.» Margarete schaute Kappe herausfordernd an.
«Lass mal gut sein, Margarete. Der Mann hat gerade andere Sorgen.» Trampe legte seinen Arm um Kappes Schulter.
Margarete ließ nicht locker. «Trotzdem ist das wichtig. Er muss doch wissen, in welcher Welt sein Kind aufwachsen soll.»
«Wenn ich’s weiß, sag ich’s dir.»
Margarete lächelte. «Ich werd dich dran erinnern.» Trampe schüttelte den Kopf. «Frauen.»
«Na, du kennst doch Margarete. Es wäre unheimlich, wenn sie mich nicht dran erinnert», sagte Kappe.
Margarete lachte. Er sah ihr in die Augen. Und als ihr bernsteinfarbener Blick ihn traf, hielt er für einen winzigen Moment die Luft an. Im selben Augenblick wurden sie in den Strom von Arbeitern und Soldaten gesogen, der unablässig zum Zirkus Busch floss. Als sie schließlich durch die Eingangstür hindurchgedrückt wurden, kreisten Kappes Gedanken schon wieder um Klara und das Kind. Sie schoben sich am Restaurant und der Konditorei vorbei. Der Mann neben Kappe, ein Soldat in einer Uniform, bei der der linke Ärmel bis zur Schulter leer und mit einer rostigen Sicherheitsnadel im Rücken festgesteckt war, löschte seine Pfeife. Andere zogen das letzte Mal tief an ihren Zigaretten, bevor sie sie ausdrückten. Qualmwolken hingen in der Luft. Der Lagerfeuergeruch der Buchenlaubzigaretten holte Kappe aus seinen Gedanken.
«Großartige Erfindung unserer Obersten Heeresleitung», sagte er zu Trampe.
Trampe nickte. «Die Soldaten haben sie im Feld massakriert, und die Armen mit ihrer Ersatzware. Aber das ist ja jetzt glücklicherweise vorbei.»
«Aber nur, wenn wir jetzt alles richtig machen. Ich trau eben diesem Ebert nicht», sagte Margarete.
Trampe verzog das Gesicht. «Aber ihr mit eurem Liebknecht.»
Kappe befürchtete, zwischen beiden schlichten zu müssen, sah aber, dass Margarete und Trampe plötzlich wie angewurzelt stehen blieben. Das gewaltige Rund der Zirkusarena öffnete sich, die Sitzreihen steil aufragend wie eine Schlucht, Menschen dicht an dicht, die unteren Ränge feldgrau von Soldaten und auf den oberen die Arbeiter. Ein Gewirr aus Tausenden von Stimmen fing sich an der Zirkuskuppel. Die Atmosphäre war elektrisch.
«Dass es so viele sind!» Margarete standen Tränen in den Augen.
«Ganz, ganz groß», sagte Trampe ehrfürchtig.
Auch Kappe war beeindruckt. «Unglaubliche Organisation!»
«Ham sie hier Jepäck zu stehen, oder warum jehtet ni’ weiter?», quengelte eine Frau hinter ihnen.
«Weiter, Genossen! Nicht gleich im Eingang der Revolution stehen bleiben», rief ein Mann. Irgendwer schubste Kappe. Die drei wurden unerbittlich die Treppen zu den oberen Rängen hochgeschoben. Im Gewühl entdeckte Margarete eine Kollegin. Die Frau winkte und begann sofort, ihre Sitznachbarn umzusortieren und zusammenrücken zu lassen, damit Margarete und ihre beiden Begleiter sich neben sie setzen konnten. Kappe und Trampe folgten Margarete, stiegen über Beine, drückten sich an den Sitzenden vorbei und quetschten sich neben die Frau. Sie war klein und rundlich. Kappe fielen ihr sehr roter Mund und ihre gesunde Gesichtsfarbe auf. Er wunderte sich, wie frisch sie im Gegensatz zu ihnen allen aussah.
«Darf ich euch vorstellen: Luise Görtz, Beauftragte von Wertheim. Luise hat übrigens auch mal bei Hertzog gearbeitet. Luise, das sind meine Freunde Hermann Kappe und Theodor Trampe.» Kappe schüttelte Luises Hand.
«Kappe? Sind Sie nicht der, der damals unse’ Klara jeheiratet hat? Wat waren Sie noch mal? Kriminaler?»
Kappe nickte.
«Schöne Freunde hast du. Fehlt nur noch, dass dein Trampe Mehrheitssozialist ist.» Luise griff nach Trampes Hand.
Nach der ersten Schrecksekunde fing Trampe an zu lachen.
«Kein Wunder, dass Margarete und Sie befreundet sind!»
«Sei vorsichtig, was du sagst, Trampe», sagte Margarete.
«Hast recht, Luise. Ist zwar nicht mein Trampe, aber Mehrheitssozialist ist er trotzdem.»
«Und Arbeiterrat bei DeTeWe.» Trampe war hörbar stolz.
«Na, ick sage immer, jeder nach seiner Fasson. Mensch, kiekt ma, da vorne geht’s gleich los!»
Kappe sah in die Manege, wo ein Podium und Tische aufgebaut waren, an denen mehrere Männer in Anzügen saßen. Kappe glaubte, Ebert, Liebknecht und Barth zu erkennen. Einige der Männer waren in Gespräche vertieft, andere wandten sich den Rücken zu. Einer trat ans Podium und schlug eine Glocke an. Und obwohl Kappe den Glockenschlag kaum hören konnte, erstarb wie auf Kommando jegliches Geräusch. Kappe sah sich um. Die Ränge waren schwarz von Menschen. Alle Blicke waren gebannt auf das Podium gerichtet. Luise starrte durch ein Opernglas nach vorne. Nach ein paar scheinbar einleitenden Worten gab der Mann das Podium für einen anderen frei. Luise stieß Kappe in die Seite und drückte ihm das Opernglas in die Hand. Ihr Mund formte das Wort «Ebert». Kappe schaute durch das Glas, und sein Blick verfing sich zunächst in den Reihen der Soldaten, die so diszipliniert dasaßen, als wären sie gefroren. Sein Blick tastete sich weiter zum Podium. Im Opernglas erschien ein dunkelhaariger vierschrötiger Mann, dessen Kopf fast halslos auf dem tonnenförmigen Oberkörper aufsaß. Das Gesicht beherrschte ein dunkler Schnurrbart, ergänzt durch einen Kinnbart in der Form eines Kommas. Ebert sah genauso aus, wie Kappe ihn von den Zeitungsphotos her kannte. Seine Körpersprache war behäbig. Kappe konnte die Worte «Einigung der sozialistischen Parteien» von seinen Lippen lesen. Er setzte das Opernglas ab und sah, dass Trampe sich, das Gesicht vor Konzentration verzogen, die Hände an die Ohren hielt, um besser zu hören. Kappe gab das Opernglas an ihn weiter.
Ebert redete noch eine ganze Weile. Plötzlich brandete in den unteren Rängen Applaus auf. Die Rede war beendet. Der Applaus pflanzte sich fort bis in die letzten Ränge. Ein anderer Mann erklomm das Podium. Kappe erkannte das schmale Gesicht mit dem gewaltigen Schnurrbart. Es war Haase, der Vorsitzende der Unabhängigen. Nun teilten sich Margarete und Luise das Opernglas. Beide waren angespannt, und diejenige, die hindurchsah, erklärte der anderen, was sich in der Manege abspielte. Obwohl die Akustik im Zirkus eigentlich gut war, waren die Stimmen zu schwach, um bis in alle Ränge zu dringen. Kappe konnte wie die meisten anderen weder die Reden verstehen noch genau sehen, was passierte. Seine Blicke wanderten über die gefüllten Ränge bis hin zur Kaiserloge. Die roten Samtvorhänge waren zugezogen. «Für dich ist die Vorstellung ein für alle Mal vorbei», dachte Kappe wütend. «Du gehst einfach nach Holland, und wir müssen sehen, wie wir aus dem Kladderadatsch wieder rauskommen.»
Vor anderthalb Jahren war er mit Klara hier gewesen, als die Pantomime Die versunkene Stadt uraufgeführt worden war. Hungrig und frierend waren sie durch den Schneematsch gestapft, und die fahle Februarsonne war ihnen genau so ausgelaugt vorgekommen wie sie selbst. Im Zirkus war es warm vor Menschen gewesen. Die beiden hatten das erste Mal seit Wochen nicht gefroren. Klara hatte aufgeregt Ausschau nach dem Kaiser gehalten, doch schon damals war die Loge leer gewesen. Aber auch ohne Kaiser war der Besuch ein Erlebnis gewesen. Klara und er hatten die kunstvoll aufgebaute Stadt Vineta, die Artisten und die dressierten Tiere bestaunt, die die Bewohner der Stadt darstellten, und waren überwältigt, als sintflutartige Wassermassen die Stadt samt Mann und Maus versenkten - Kappe las Klara später aus dem Programmheft vor, dass das künstliche Vineta in satten 30 000 Litern Spreewasser untergegangen war. Kappe musste lächeln, als er an Klara dachte. Sie hatte fast vergessen zu atmen. Als die Artisten nach einigen Augenblicken nicht auftauchten, hatte Kappe seine Taschenuhr herausholen müssen, und beide hatten mit ungläubigem Staunen gesehen, wie ganze sechs Minuten vergingen, bis Stadt, Menschen und Tiere wohlbe halten und unter dem Strahlen einer mächtigen Scheinwerfersonne wiederauftauchten - gerettet von der Wassernixe Elna, die dafür ihr Herz in die Flut geworfen hatte. Kappe und Klara hatten noch oft gemeinsam darüber gerätselt, wie Menschen und Tiere sechs Minuten lang unter Wasser bleiben konnten. Und obwohl Kappe das Stück mit seinem zuckrigen Symbolgehalt ziemlich aufdringlich fand, hatte er sich doch glänzend amüsiert.
Kappe schüttelte unbewusst den Kopf. Tatsächlich war er in den letzten Tagen Zeuge einer Art Wiederauferstehung geworden. Aber die hatte nichts mit einer guten Fee zu tun, die ihr Herz geopfert hatte. Im Gegenteil. Diese Wiederauferstehung war das Ergebnis von Kriegstreiberei und nationaler Überschätzung, die im Ruin geendet hatte. Und selbst wenn jetzt alles neu und besser wurde, fühlte sich Kappe doch wie jemand, der niedergeschlagen worden war und dem nichts anderes übrigblieb, als aufzustehen und weiterzulaufen.
Das Scheppern der Glocke riss ihn aus seinen Gedanken. Kappe schreckte hoch. Einer der Politiker hatte sie einem anderen ins Kreuz geschlagen, um ihn am Reden zu hindern. Die Zuschauer schrien durcheinander. «Einigkeit! Einigkeit!», brüllten die Soldaten in Sprechchören. Dann stürmten sie nach vorne, und die Manege verwandelte sich in ein Meer von grauen Uniformen. Schlägereien brachen los. Das Wort «Militärherrschaft» wurde durch die Reihen geraunt. Die Gesichter auf den Rängen waren ratlos, schockiert, hilflos. Kappe sah zu Trampe und Margarete, die heftig mit Luise und den anderen Sitznachbarn diskutierten. Die Glocke erklang noch einmal. Die Kontrahenten in der Manege ließen voneinander ab und zogen sich zu aufgeregten Beratungen zurück.
Dietrich Mazurat beobachtete das Durcheinander in der Manege und stieß verächtlich die Luft durch die Nase. Nichts anderes hatte er von dem Pöbel erwartet. Die fiebrigen, hilflosen Diskussionen um ihn herum - nichts als elende Naivität. Mazurat betrachtete die Diskutierenden. Rohe Gesichter, eingebrannter Schmutz, Elend. Mazurat hasste die Art von Menschen, die er hier sah. Dummes Volk, von gleichmacherischen Theorien aufgehetzt und verblödet. Trotzdem war er froh, dass er hierhergekommen war. Gestern, als ganz Berlin auf den Beinen gewesen war und Revolution gemacht hatte, war er in den Tempelhofer UFA-Studios gewesen, hatte gearbeitet und von alldem nichts mitbekommen. Das hatte ihn geärgert, denn er liebte es, informiert zu sein. Heute war er wie ein hungriges Tier auf der Jagd hierhergekommen. Er hatte drehfrei. Sogar seine Angst vor der Grippe hatte er niedergekämpft.
Mazurat strich sich mit seinen manikürten Händen die Haare glatt. Für ihn war der Zirkus Busch mit seinen tobenden, schreienden und diskutierenden Menschen ein mit menschlichen Forschungsobjekten prall gefülltes Bestiarium. Ganz nebenbei hielt er Ausschau nach bekannten Gesichtern. Man wusste nie, wozu man so eine Information brauchen konnte. Mazurat sah niemanden, den er kannte, beobachtete aber trotzdem alles, gleichzeitig fasziniert und abgestoßen. Er sammelte Gesichter, Kleider, Gesten. Knollennasen, Hängenasen, Spitznasen, wulstige Lippen, Tränensäcke - er saugte die Physiognomien in sich auf: den gedrungenen, blassen Blonden schräg vor ihm mit dem Schnauzbart und den wässrigblauen Augen, der aus jeder Pore Niedergeschlagenheit auszuschwitzen schien. Der Blonde diskutierte mit einer Bernsteinaugenschönheit, die jederzeit Schauspielerin hätte werden können, wenn sie nicht diese Ausstrahlung von kompromissloser Rechtschaffenheit gehabt hätte. Langweilig. Der Blonde sah wie ein Polizist aus. Mazurat fragte sich, was er hier wollte. Er beobachtete die kleine Verblühte neben der Schönen, deren dickliche Kinnpartie bereits zu hängen begann, was auch durch die pfundweise aufgetragene Schminke nicht kaschiert wurde. Wahrscheinlich war sie Verkäuferin. Oder der Mann, der neben ihm saß: ein kahlköpfiger Riese mit stumpfer Haut und schlechten Zähnen, der mit offenem Mund gebannt auf das Geschehen in der Manege starrte. Mazurat fand, dass er aussah wie ein Kind, das sich in einen Erwachsenenkörper verirrt hatte. Um den Ärmel seines kümmerlich geflickten Jacketts trug er die rote Armbinde. Die Ärmel waren notdürftig verlängert.
Der Kindriese drehte sich zu ihm um. «Janz schönet Durcheinanda, wa?» Mazurat nickte kurz und schaute dann demonstrativ in die andere Richtung. Aber der Kindriese ließ sich nicht abschütteln. «Für wen bist du hier, Jenosse?»
Mazurat schien es besser, dem Mann etwas vorzulügen. «Für die Filmkünstler.»
«Solidarität von die Künstler.» Er stand ergriffen auf und nahm Mazurats Hand. «Nie hätt icks jedacht, aba dit janze Volk steht zusammen.» Meyer pumpte Mazurats Hand. Dabei schob sich sein Ärmel weit über das Handgelenk zurück und gab einen schmutzigen Unterarm frei. «Jestatten, Paul Meyer, Borsigwerke.» Mazurat hatte das Gefühl, dass die Schwielen und der Dreck an der Hand des Mannes sich in seine Handflächen einbrannten. Hass flammte in ihm auf. Er atmete tief durch. «Da unten spielt die Musik.» Mit einem Blick auf die Manege bedeutete er Meyer, still zu sein.
Meyer sah ihn schuldbewusst an. «Recht haste. Dafür sind wa ja ooch hier, oder?» Er setzte sich und sah folgsam in Richtung Manege. Mazurat nickte. Die Soldaten hatten sich inzwischen wieder auf die Ränge verzogen. Nur Einzelne von ihnen diskutierten noch in Grüppchen mit den Politikern. Die meisten Politiker saßen bereits wieder an den Tischen. Schließlich kehrten alle wieder an ihre Plätze zurück. Im Saal wurde es ruhig.
Der Mann, der den anderen vorhin mit der Glocke angegriffen hatte, verkündete irgendetwas. Außer den unteren Rängen konnte auch jetzt niemand etwas verstehen. Die Neuigkeiten brauchten eine Zeit, um sich in einer Art Flüsterpropaganda durch die Ränge zu arbeiten. Schließlich raunte ihm Meyer etwas von einem Vollzugsrat der Arbeiter- und Soldatenräte zu und dass die Reichsregierung bestätigt sei und nun «Rat der Volksbeauftragten» heiße. Mazurat war das alles völlig egal. Dieser Blödsinn würde am nächsten Tag sowieso in den Zeitungen stehen. Er würde ihn nicht einmal zu Geld machen können. Er roch Meyers sauren Atem. Es widerte ihn an. Als alle im Saal aufstanden, um die Internationale zu singen, drängte er sich in Richtung Ausgang. Er durchquerte die Eingangshalle, die unter den fast dreitausend Stimmen vibrierte, und ging hinaus. Die Flügeltüren schlugen hinter ihm zu und kappten den Gesang. Das Schwappen von Wasser war zu hören - die Spree. Eine S-Bahn quietschte. Mazurat hielt im Lichtkegel der Eingangsbeleuchtung inne und schaute in das Schwarz, das die Stadt war. Dann betrachtete er im wächsernen Licht der Lampe etwas, das er in seiner Hand hielt. Es war ein Skalpell. Und die Armbinde, die er Meyer unbemerkt vom Arm geschnitten hatte. Er steckte sein Skalpell und das rote Stück Stoff in die Brusttasche seines maßgeschneiderten Anzuges. Dann strich er sein Haar nach hinten, setzte seinen Hut auf und verschwand in der Dunkelheit. Wind kam auf.
Der Wind griff nach der Stadt wie eine große unsichtbare Hand. Er spielte mit den Bäumen und glitt durch die menschenleeren Straßen. Unter den Linden seufzten die roten Fahnen auf und blähten sich. Er trieb im Tiergarten die letzten Herbstblätter vor sich her und ließ sie achtlos vor dem Reichstag fallen. Im geldsatten Tiergartenviertel rüttelte er an den Fensterläden eines Stadtpalais. Ein Laden schlug gegen die Hauswand. Das Licht einer Schreibtischlampe rann in die Dunkelheit. Heinrich von Brettin schreckte aus den Überlegungen für seinen Kommentar hoch. Eine Nachlässigkeit des Dieners. Er überlegte kurz, ihn zu rufen. Dann stand er selbst auf und schloss den Laden. Der Kommentar duldete weder Störung noch Aufschub. Sein Blick fiel auf den Rotwein auf seinem Schreibtisch. «Rot», dachte er mit Abscheu. Er klingelte nun doch nach dem Diener. Nur wenige Augenblicke später stand wohltemperiert ein Weißwein vor ihm.
Heinrich von Brettin nippte kurz und genießerisch. Dann versenkte er sich wieder in seine Arbeit. Spätestens zum Umbruchschluss musste der Text in der Redaktion sein. Die morgige ExtraAusgabe des Reichskurier würde mit einem Kommentar erscheinen, der nicht nur die Umtriebe der letzten Zeit minutiös und elegant decouvrierte , sondern auch den Verrat der Roten am Reich, seinen tapferen Soldaten und dem sicheren Sieg offenlegte. Da konnte der Plebs dreimal das Zeitungsviertel besetzen. Heinrich von Brettin gab nicht auf. Das war er dem Reich und seiner Zeitung schuldig.
Kappe lag fröstelnd im Bett. Der Wind pfiff durch den kalten Kachelofen und rüttelte an den Fenstern. Kappe stand auf und drückte die Fenster fest zu. Dann rückte er die dicken Karl-May-Bände, die seit der Beschlagnahmung der Fenstergriffe durch die Metallsammelstelle dazu herhalten mussten, das Fenster geschlossen zu halten, wieder dicht an den Rahmen. Er schaute in den dunklen Hinterhof und dachte daran, wie oft er die Bücher auf dem Fenstersims schon durch Steine hatte ersetzen wollen. Er war nie dazu gekommen. Kappe überlegte, ob seine Fenstergriffe wohl irgendeinem armen Kerl auf irgendeinem Schlachtfeld das Leben gekostet hatten. Der Gedanke machte ihn traurig. Nach diesem Abend, den vielen Menschen und hitzigen Diskussionen im Zirkus Busch kam er sich noch einsamer vor als sonst. Es fühlte sich an, als hätte er einen Kater. Wenn es nicht so unsinnig gewesen wäre, wäre er aufgestanden und zum Krankenhaus gelaufen.
Noch auf dem Nachhauseweg hatten Margarete, Trampe und er geredet. Trampe war ungewöhnlich gereizt gewesen. «Eine Gegenregierung, das war mit diesem Aktionsausschuss beabsichtigt. Wenn Ebert das nicht bemerkt hätte, wäre das Reich im Chaos versunken. Und ihr Unabhängigen wärt noch begeistert gewesen.»
«Hör doch auf, Trampe! Die SPD hat die Soldaten instrumentalisiert. Die haben keine politische Bildung, wollen weitermachen wie bisher. Wie soll sich denn was ändern, wenn wir dem alten Reich nur einen neuen Kopf aufsetzen?»
«Warum regt ihr euch eigentlich so auf?», hatte Kappe, dem das Ganze allmählich zu verstiegen wurde, gefragt. «Wir haben jetzt eine Demokratie, und wenn da Entscheidungen fallen, muss man sie annehmen, oder nicht?» Margarete und Trampe hatten Kappe angestarrt, als wäre er verrückt geworden. «Mal ehrlich. Was nützt es denn, wenn wir hier alles umkrempeln und nichts läuft mehr?» Kappe war nun nicht mehr zu bremsen. «Überlegt doch mal. Als sie das Polizeipräsidium gestürmt haben - was wäre passiert, wenn sie uns alle rausgeschmissen hätten? Die Banditen hätten gefeiert. So, wie es jetzt ist, können wir arbeiten. Die politischen Häftlinge sind frei, die politische Polizei ist weg, und der Kriminelle kriegt, was er verdient. Man kann eben nicht alles umstürzen.»
«Hör auf den Herrn Kommissar», hatte Trampe zu Margarete gesagt. Die war einige Zeit schweigend neben den beiden her gelaufen. «Ich hoffe, ihr irrt euch nicht», hatte sie schließlich gesagt. Kappe tastete nach den leeren Umrissen von Klaras Kopfkissen. Überall waren Fronten. Zwischen seinen Freunden. Innerhalb der neuen Regierung. Zwischen den Revolutionären. Die Einzigen, die bisher fehlten, waren die Anhänger des Kaiserreichs. Wo waren die? Kappe dachte an sein Büro. Auch hier gab es Fronten. Zwischenmenschliche. Politische. Und er hatte das Gefühl, dass er sich zwischen allen befand.
In Wedding ging Paul Meyer die acht ausgetretenen Stufen zu der Kellerwohnung hinunter, in der er und seine Familie lebten. Begleitet von einer Art Hochgefühl, war er den ganzen Weg vom Zirkus Busch über die Oranienburger und die Chausseestraße bis zum Sparrplatz gelaufen. Während er das hakelnde Schloss der Wohnungstür aufschloss, musste er an den Künstler denken, den er getroffen hatte. Komischer Typ. Aber immerhin - wer hätte gedacht, dass sogar die Künstler einen Bevollmächtigten schicken würden?
Das Schloss ging auf, und der Geruch nach Moder, Rauch und ungewaschenen Menschen schlug ihm entgegen. Er zog den Kopf ein, denn die Decken waren so niedrig, dass er nur gebückt gehen konnte. Dann zündete er die kleine Karbidlampe an. Sein Schatten flackerte über die schrundigen Wände, von denen sich die Tapeten abpellten, um schwarze Placken von Schimmel freizu geben. Es war eiskalt. Er quetschte sich vorbei am Feldbett des schnarchenden Schlafgängers in die Stube, wo das Ehebett stand, in dem sein Bruder Franz schlief. In drei vorsichtigen Schritten war er in der Küche. Das Licht der Lampe strich über die Gesichter seiner beiden schlafenden Söhne, die sich das Sofa teilten. Dann leuchtete er in das Bett neben dem Sofa. Auch seine Frau, seine Tochter und das Baby schliefen. Das Baby hustete. Meyer zog sich zurück in den Raum, in dem das Ehebett stand. Er begann sich auszuziehen. Plötzlich merkte er, dass er seine Armbinde verloren hatte. Meyer schüttelte seinen Mantel. Doch die Armbinde hatte sich nicht in seinem Mantelärmel verfangen. Er leuchtete auf den Boden, doch nur das übliche Sammelsurium von Töpfen, Holzresten, Flaschen und Lumpen leuchtete auf. Das Licht fing sich in den gusseisernen Ranken der Nähmaschine, auf der seine Frau Säcke nähte. Meyer dachte an die Raten, die sie für die Maschine noch zu zahlen hatten.
In einer Ecke glitzerte das Glanzpapier, aus dem seine Frau und die Kinder Knallbonbons gefertigt hatten, bis es im Krieg die Rohstoffe nicht mehr gab. Die Armbinde blieb verschwunden. Sein Magen knurrte, und er war völlig erschöpft. Er beschloss, am Morgen noch einmal zu suchen, zog sich bis auf die Unterwäsche aus und legte sich vorsichtig neben seinen Bruder. Die Bettdecke war klamm. Franz stöhnte und begann einen gehetzten Singsang in einer unverständlichen Sprache. Bevor sich der Singsang zu Schreien steigern konnte, stand Meyer auf und suchte auf der anderen Seite des Bettes nach dem abgegriffenen Katzenfell. Es war das Einzige, was Franz beruhigen konnte. Er fand es und umwickelte die krampfenden Hände seines Bruders damit. Franz wurde ruhig. Meyer schlüpfte wieder unter die Decke, und seine Gedanken kreisten zum tausendsten Mal um die Frage, was Franz im Krieg erlebt haben musste. Meyer erinnerte sich genau an den August im Jahr 1914, in dem der Bruder freudig ins Feld gezogen war.
«Wirst sehn, Paule, Weihnachten sitzen wa alle zusamm’ untam Baum, und ick erzähl euch meine Abenteuer», hatte Franz damals gesagt. Drei Jahre später war er zurückgekommen, blind und ohne sein rechtes Bein. Erzählt hatte er nie etwas. Meyer rieb sich die brennenden Augen. Das Baby hustete wieder. Die rote Armbinde war vergessen.