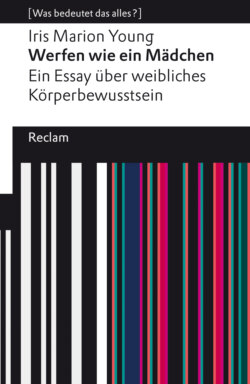Читать книгу Werfen wie ein Mädchen. Ein Essay über weibliches Körperbewusstsein - Iris Marion Young - Страница 5
I.
ОглавлениеDer grundlegende Unterschied, den Straus zwischen der Art, wie Jungen und wie Mädchen werfen, beobachtet, besteht darin, dass Mädchen den Körper nicht in dem gleichen Maße wie Jungen bei der Bewegung einsetzen. Weder strecken sie sich nach hinten, noch drehen sie den Oberkörper, noch nehmen sie Anlauf, noch machen sie Ausfallschritte oder beugen sich vor. Stattdessen bleiben sie relativ unbeweglich; die Arme ausgenommen, doch selbst die Arme werden nicht so weit ausgestreckt, wie sie ausgestreckt werden könnten. Werfen ist nicht die einzige Bewegung, bei der es einen typischen Unterschied in der Art und Weise gibt, in der Männer und Frauen ihren Körper je unterschiedlich zum Einsatz bringen. Betrachtet man die weibliche Haltung bei anderen körperlichen Aktivitäten, so zeigt sich, dass auch diese häufig durch das Ausbleiben des vollen Körpereinsatzes im Raum nach allen Richtungen charakterisiert sind – ganz wie im Fall des Werfens.
Selbst bei den einfachen Körperorientierungen von Männern und Frauen wie etwa Sitzen, Stehen und Gehen lässt sich ein typischer Unterschied im Körperstil und in der Reichweite feststellen. Im Allgemeinen haben Frauen eine weniger offene Körperhaltung als Männer in Gang und Schritt. Meistens ist der Schritt, den Männer machen, im Verhältnis zum männlichen Körper als ganzem länger als der weibliche Schritt im Verhältnis zum weiblichen Körper. Ein Mann lässt seine Arme offener und freier schwingen als eine Frau es tut und hat meistens einen stärker ausgeprägten Rhythmus von Auf und Ab in seinem Gang. Obwohl wir jetzt im Vergleich zu früher mehr Hosen tragen und demzufolge unsere Sitzposition nicht mehr wegen unserer Kleidung einschränken müssen, sitzen wir immer noch oft mit beiden Beinen relativ nahe beieinander und verschränken die Arme vor dem Körper. Beim Stehen oder Anlehnen sind die Füße der Männer weiter voneinander entfernt als die der Frauen. Wir neigen auch eher dazu, unsere Hände und Arme so zu halten, dass sie unseren Körper berühren und schützen. Ein weiterer Unterschied lässt sich schließlich in der Art und Weise beobachten, wie Vertreter der beiden Geschlechter Bücher oder Päckchen tragen; Mädchen und Frauen tragen Bücher in den allermeisten Fällen an die Brust gepresst, während Jungen und Männer sie an der Seite baumeln lassen.
Die Umgangsweise der beiden Geschlechter mit körperlichen Aufgaben, die Stärke, Kraft und Muskelkoordination verlangen, weicht in vielen Fällen voneinander ab. Die Körperkraft unterscheidet sich bei Männern und Frauen ebenso in Hinsicht auf die Art und Weise, wie sie jeweils eingesetzt wird, wie in Hinsicht auf ihre Begrenzung. Viele der beobachteten Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei der Durchführung körperlicher Aufgaben, die physische Kraft erfordern, sind allerdings nicht so sehr abhängig von bloßer Muskelkraft als vielmehr von der Art und Weise, wie die beiden Geschlechter ihren Körper einsetzen, wenn sie solche Aufgaben in Angriff nehmen. Frauen trauen sich oftmals nicht zu, schwere Dinge hochzuheben und zu tragen, mit Kraft zu schieben und zu schubsen, zu ziehen, zu quetschen, anzupacken oder mit Macht zu drehen. Deshalb gelingt es uns nicht, die gesamten Möglichkeiten unserer Muskelkraft, Position, Haltung und unseres Auftretens auszuschöpfen, wenn wir uns an solche Aufgaben wagen. Frauen neigen nicht mit derselben Selbstverständlichkeit und Natürlichkeit wie Männer dazu, ihren ganzen Körper bei einer körperlichen Aufgabe einzusetzen. Beispielsweise versäumen es Frauen bei dem Versuch, etwas zu heben, häufiger als Männer, sich fest hinzustellen und so einen Großteil des Gewichts auf die Schenkel zu übertragen. Stattdessen konzentrieren wir unsere Bemühungen nur auf die Körperteile, die direkt mit der Aufgabe zu tun haben – nämlich Arme und Schultern –, und lassen auf diese Weise die Kraft in den Beinen völlig ungenutzt. Ein weiteres Beispiel ist das Drehen: Unsere Anstrengung konzentriert sich auf die Hand und das Handgelenk und bringt so nicht die Kraft der Schulter zum Einsatz, die für ein gutes Gelingen nötig ist.11
Was oben für das Wurfbeispiel festgestellt wurde, lässt sich auf den Großteil sportlicher Betätigung ausweiten. Nun sind die meisten Männer keinesfalls überlegene Athleten, und ihre Anstrengungen beim Sport beweisen meist mehr Draufgängertum als eigentliche Könnerschaft und Koordinationsfähigkeit. Doch selbst der relativ untrainierte Mann engagiert sich beim Sport im Allgemeinen in freierer Bewegung und mit offenerem Aktionsradius, als sein weibliches Pendant dies tut. Es gibt nicht nur einen typisch weiblichen Wurfstil, sondern auch einen mehr oder weniger typisch weiblichen Laufstil, Kletterstil, Schaukelstil, Schlagstil [»wie ein Mädchen« bedeutet in der Sprache des amerikanischen Sports auch einen abwertenden Kommentar, Anmerkung der Übersetzerin]. Diese Stile zeichnen sich alle erstens dadurch aus, dass nicht der ganze Körper in eine flüssige und zielgerichtete Bewegung versetzt wird und dass, wie auch beim Schaukeln und beim Schlagen, die Bewegung sich auf nur einen Körperteil konzentriert; zweitens weist die Bewegung einer Frau keinen Hang zum Ausstrecken, Ausdehnen, Lehnen, Strecken auf und schwingt nicht mit der Bewegung in der intendierten Richtung durch.
Viele Frauen verhalten sich bei sportlicher Betätigung so, als umgebe sie ein imaginärer Raum, über den sie sich nicht hinausbewegen können: Der Raum, der unserer Bewegung zur Verfügung steht, ist ein begrenzter Raum. So bleiben zum Beispiel beim Softball- oder Volleyballspiel Frauen mehr als Männer auf einem Fleck stehen: Weder springen sie, um den Ball zu fangen, noch rennen sie, um den Ball zu erwischen. Männer bewegen sich öfter auf den Ball zu, wenn er sich noch in der Luft befindet – und reagieren so mit einer eigenen Gegenbewegung auf ihn. Frauen warten lieber darauf, dass der Ball kommt, und reagieren dann auf sein Näherkommen, statt selber hinzulaufen und so an den Ball zu kommen. Oft reagieren wir auf die Bewegung des Balls, der auf uns zufliegt, als wolle er uns treffen, und unser unmittelbarer Reflex besteht darin, davonzulaufen, uns zu ducken oder uns sonst irgendwie vor seinem Flug zu schützen. In jedem Fall geben Frauen beim Sport weniger oft als Männer ihrer Bewegung eine selbstbewusste Richtung oder Position im Raum. Statt auf eine bestimmte Stelle zu zielen, auf die wir den Ball werfen wollen, neigen wir dazu, ihn in eine »allgemeine« Richtung zu schleudern.
Frauen sind im körperlichen Umgang mit Dingen oft ängstlich, unsicher und zögernd. Typischerweise fehlt uns vollständig das Vertrauen in unseren Körper, uns ans Ziel zu bringen. Es handelt sich dabei um ein zweifaches Zögern. Einerseits fehlt uns häufig das Vertrauen, dass es tatsächlich in unserer Macht steht, zu tun, was getan werden muss. Oftmals habe ich eine Wandergruppe aufgehalten, in der die Männer über einen harmlosen Bach setzten, während ich auf der anderen Seite stand, ängstlich die Trittfestigkeit verschiedener Steine prüfte und mich an herabhängende Äste klammerte. Obwohl die anderen mit Leichtigkeit hinübergekommen waren, konnte ich mir nicht vorstellen, dass es für mich leicht sei, auch wenn ich mit einem beherzten Schritt schnell auf der anderen Seite gewesen wäre. Andererseits beruht diese Vorsicht, wie ich meine, auf der Angst, verletzt zu werden, die bei Frauen größer ist als bei Männern. Unsere Aufmerksamkeit teilt sich oft zwischen dem zu erreichenden Ziel der Bewegung einerseits und dem Körper, der diese Bewegung ausführen muss, während er sich andererseits zugleich davor schützen muss, verletzt zu werden. Wir erfahren unseren Körper häufig als zerbrechliche Last und nicht als Mittel zur Durchsetzung unserer Ziele. Wir glauben, unsere Aufmerksamkeit auf den Körper konzentrieren zu sollen, um sicherzustellen, dass er tut, was wir wollen, und wir richten dafür keine Aufmerksamkeit auf das, was wir mittels unseres Körpers erreichen wollen.
Alle genannten Faktoren tragen gemeinsam dazu bei, in vielen Frauen ein mehr oder weniger stark ausgeprägtes Gefühl der Unfähigkeit, der Frustration und der Gehemmtheit hervorzubringen. Stärker als Männer unterschätzen wir unsere körperlichen Fähigkeiten.12 Wir haben bereits – meist fälschlicherweise – im Vorhinein entschieden, dass eine Aufgabe über unsere Kräfte geht, und bringen so nicht unsere gesamte Kraft zum Einsatz. Auf eine so halbherzige Weise können wir den gestellten Aufgaben natürlich nicht gerecht werden, sind frustriert und erfüllen so unsere eigenen Befürchtungen. Wenn wir eine Aufgabe in Angriff nehmen, wollen wir weder unbeholfen noch zu stark erscheinen. Beide Befürchtungen tragen nur dazu bei, unsere Unbeholfenheit und Frustration noch zu vergrößern. Wenn wir uns schließlich aus diesem Zirkel befreien und eine körperliche Aufgabe wirklich mit ganzem Einsatz ausführen, sind wir überrascht, was unser Körper tatsächlich zustande bringt. Untersuchungen zeigen, dass Frauen öfter als Männer das Ausmaß dessen, was sie bereits erreicht haben, unterschätzen.13
Keine der bisherigen Beobachtungen über die typisch weibliche Art, sich zu bewegen und zu halten, trifft zu jeder Zeit auf alle Frauen zu. Selbst wenn Aspekte dieses typischen Verhaltens auf einzelne Frauen zutreffen, geschieht dies nicht in gleicher Weise und in gleichem Ausmaß. Es gibt keine inhärente, geheimnisvolle Verbindung zwischen diesen typischen Haltungen und dem Frausein. Viele dieser Haltungen kommen, wie später entwickelt werden soll, aus einem Mangel an Übung im Benutzen des Körpers und Erfüllen von Aufgaben. Selbst mit diesen Einschränkungen kann man doch immer noch sinnvoll von einem allgemeinen weiblichen Stil der Körperhaltung und Bewegung sprechen. Der nächste Abschnitt soll eine spezifische kategoriale Beschreibung der Modalitäten von Körperhaltung und Bewegung entwickeln.