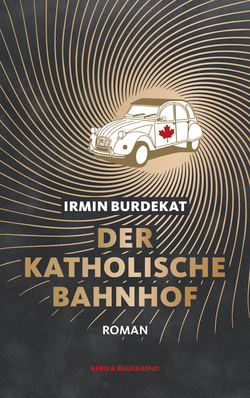Читать книгу Der Katholische Bahnhof - Irmin Burdekat - Страница 4
ОглавлениеKennen Sie den Katholischen Bahnhof? Die Kneipe habe ich vor sieben Jahren von meinem Vater übernommen, als der plötzlich an Lungenkrebs starb. 33 Jahre lang täglich 60 Gitanes. Von sowas kommt sowas. Der Laden hieß bei meinem Vater noch Zum Lindenbaum. Mit dem neuen Namen gelang mir eine glatte Umsatzhalbierung, allerdings bei gleichzeitiger Verdoppelung des Niveaus meiner Gäste. Auf die Tische lege ich regelmäßig eine von mir verfasste Hauszeitung – Die Thekenschlampe –, in der ich alles rauslasse, was sich in mir zusammenbraut. Nicht jeder Gast hat Verständnis dafür, viele begreifen den Inhalt auch gar nicht, manche schütteln nur mit dem Kopf und basteln Schwalben aus den gefalteten DIN-A4-Blättern. Und Humor ist bei mir das, worüber ICH lache! Für manche meiner Gäste ein Problem.
Bevor ich den Betrieb von meinem Vater übernahm, führte mich die Agentur für No-Jobs unter „Arbeitsloser Halb-Akademiker“. Wahrscheinlich noch in einem hölzernen Karteikasten. Ich habe einige Semester Geschichte und Soziologie studiert, bin 41 Jahre alt und seit genau so vielen Jahren bettelarm. Ich stehe links, wähle aus Sentimentalität manchmal linksradikal und handele, den Umständen geschuldet, wirtschaftsliberal. Die Umstände sind Hanna – die mich nach vier gemeinsamen Jahren verlassen hat – und unser zweijähriger Sohn Ché-Daniel.
Meine Kneipe, also den Katholischen Bahnhof, habe ich für ordentliche 538,- Euro im Monat von der Familie Pretorius gepachtet. Denen gehört hier das halbe Viertel. Ich kenne den Junior. Sogar ganz gut. Er steht, ebenfalls aus Sentimentalität, in der Stehkurve bei der Arminia neben mir. Wir holen uns gegenseitig das Bier und haben beim Abstieg engumschlungen geweint. Ansonsten sind wir uns nicht nahe. Wie wenig nah, erkennt man daran, dass er mich beim Eintreten in den Bahnhof mit „Guten Tag, Herr Dr. Stiegmann“ grüßte. Im Stadion bin ich immer: „Ronald, hol’ mal Bier!“ Dennis Pretorius ist ein Idiot. Und damit genügend beschrieben. Fairerweise muss ich erwähnen, dass er mir das förmliche „Sie“ angedroht hat, als ich mal wieder mit der Miete im Rückstand war.
Dennis Pretorius schob sich lässig einen Barhocker vor den Bierhahn, aus dem ich souverän, ohne hinzuschauen, eine Runde Alt für den Stammtisch zapfte. Wenn man Augenkontakt zu den Kandidaten an der Theke behält, wird alles halb so schlimm, dachte ich, denn ich ahnte, was kommen würde. Aber es kam anders. „Hör’ mal, Herr Stiegmann, ich hätte da einen Deal für dich. Du kennst dich doch aus mit Büchern und Schreiben und so. Hast du nicht während deines Studiums bei einer Zeitung gejobbt? Und du hast doch auch mal einen Wälzer über die Historie des Schlosshofs geschrieben. Stimmt doch, oder? Wie wäre es, wenn du die Geschichte unserer Familie nebst Firma einmal zu Papier bringen würdest? Familiensaga oder so. Irgendwas Fettes wie die Buddenbrooks, verstehst du? Aber schön seriös. Soll ein Geschenk werden für die Belegschaft. Nächstes Jahr haben wir Hundertjähriges.“
Spontane Cleverness ist sonst nicht so mein Ding, aber in diesem Fall klappte es. „Never!“, sagte ich, und wenn ich mich recht entsinne sogar ziemlich laut, empört und mit unterdrückter Neugierde. Dennis ließ nicht locker: „Komm schon Alter, du brauchst doch ewig Geld. Wir lassen uns den Spaß dreißigtausend kosten, abzüglich Mietrückstände.“
Ahnt irgendjemand, was dreißigtausend für mich bedeuten? Meine Mutter wartete schon seit Jahren auf, ja Mensch, wie viel war das noch? Ich hatte kein Auto mehr (für den Führerschein hätte ich zur Nachschulung müssen), Ché-Daniel sollte in den Waldorf-Kindergarten, Hannas Vater hatte mir fünftausend geliehen und einige Lieferanten hofften auf Überweisungen.
Ich brüllte nochmal eindrucksvoll „Never!“ und stieß mich dabei vor Entsetzen vom Schanktresen weg nach hinten, um dann ganz langsam wieder in die alte Position zurückzugleiten. Dennis Pretorius hat keine vernünftigen Reaktionsmuster für solche Situationen. Anstatt sofort den Betrag zu erhöhen, grinste er nur wortlos. Folglich blieb es an mir hängen, eine verbale Reaktion in Gang zu bringen. Ich schüttelte langanhaltend den Kopf, bevor ich sagte: „Aber ich schreibe so, wie es mir passt. Keine Gefälligkeitsliteratur, verstehst du?“ Schlagartig beendete Dennis Pretorius darauf sein Grinsen und sagte: „Okay, aber dann sind nur zwanzig drin. Zwanzigtausend Euro, zweitausend Vorkasse, den Rest in Häppchen, je nach Fortschritt. Und alle Informationen kommen von mir! Ich erzähl’ dir die Geschichte, und du schreibst.“
Ich wiederholte mein Empörungsprogramm, und wir landeten endgültig bei fünfundzwanzigtausend. Wir verabredeten Orte und Zeiten, an denen wir uns treffen könnten und zu denen der Stoff zu mir rüberwachsen sollte. Zu mir! Warum ausgerechnet zu mir? Hanna behauptet, ich sei ein Freak mit schwersten Entwicklungsstörungen. Sie will mich erwachsener, aber ich schätze meine ewige Jugend, weshalb ich mich gegen alles wehre, was mir vereinnahmend vorkommt. Doch nun vereinnahmte mich ausgerechnet die Pretorius-Sippe mit ihrer großbürgerlichen Unternehmer- Vita. Nach dem ersten Treffen mit Dennis verfasste ich einen Probetext, der ihm sofort gefiel. Ohne ihm diese Passage zu zeigen, begann mein Originaltext so:
Der Junge Fabrikant fährt wie stets in rasantem Tempo den Hausberg hoch, um dann die letzten Meter zu laufen. Allein in diesem ersten Satz sind bereits drei Ungenauigkeiten zu bemängeln. Zunächst ist der Junge Fabrikant in Wirklichkeit schon ziemlich alt. Seinen Vater, der nun schon über dreißig Jahre tot ist, nannte man den Alten Fabrikanten. So wurde sein Sohn automatisch der Junge Fabrikant und blieb es auf Dauer. Der Sohn Dennis, also der Enkel des Alten Fabrikanten, wird sich diesen Titel nicht mehr verdienen, da er nicht wie Vater und Großvater die Geschäfte der Familie weiter betreiben wird. Dann muss man da- rauf hinweisen, weshalb es bei den Pretorius’ üblich ist, dem Hausberg seinen richtigen Namen zu verweigern. Der Hausberg ist der Ginsterberg. Da aber das Haus der Fabrikanten an oberster Stelle thront, spricht die Familie seit jeher von „ihrem“ Hausberg. Und zuletzt ist es falsch, den Eindruck zu vermitteln, der Junge Fabrikant sei allein deshalb den Hausberg hi- naufgefahren, um die letzten Meter zu laufen. Richtig ist es, darauf hinzuweisen, dass dem Fabrikanten der Wagen mit leerem Tank stehen bleibt und er laufen muss. Wütend! Keinen Blick für den wundervollen Sommertag, der die Luft angenehm erwärmt über die Haut streichen lässt.
Der Junge Fabrikant steht nach drei Stufen vor dem Portal des Hauses. Eine edle, aufwändig verzierte Holztür mit Seitenwangen. Besonders hervorstehende Ornamente sind mit Blattgold beschlagen, der Rest des schweren Eichenholzes ist wohlüberlegt rot gestrichen. Kein aggressives Rot, nicht wie Feuerwehr oder Ferrari, aber dennoch selbstbewusst strahlend und auffällig. Die Tür bekam ihre neue Farbe anlässlich des zehnten Todestages des Alten Fabrikanten. Ein Akt der nachtragenden Aufsässigkeit. Wenn der Schlüssel im Schloss steckt, beginnt normalerweise der Einsatz für Dutschke. Dutschke bellt dann wie Dutschke. Selbst die engsten Familienmit- glieder müssen seine Akustikattacken erdulden, wenngleich kürzer als Fremde. Heute ist Dutschke im Garten. Ein piekfeiner Retriever in sattem Schwarz. Der Junge Fabrikant hetzt die Stufen hoch, so schnell es die schlappe Kondition und das schwache Herz eben zulassen. Er muss in die dritte Etage, in sein Zimmer! Sein Zimmer, seit er denken kann. Früher eine Kinderhöhle, bunt und mit einem Teppich aus unaufgeräumten Lego-Steinen. Später dann eine coole Bude mit Elvis Presley in Petersburger Hängung. Heute ein Festival in Nussbaumholz. Allerfeinste Tischlerarbeit. Jeder Quadratzentimeter sinnvoll ausgefüllt mit Schränken, Regalen und einem üppigen Designer-Schreibtisch. Genau auf diesem Schreibtisch liegen Unterlagen, die der Fabrikant vergessen hat und die für die Besprechung in einer knappen halben Stunde wichtig sind. Er rafft die Papiere zusammen, schiebt sie hastig über- einander. Dann, im Umdrehen, noch ein kurzer Blick aus dem Fenster. In den Garten. Ein das Leben verändernder Blick, der nun länger und länger wird. Hinter einem wohl zwei Meter hohen Rhododendronbusch...
Dennis gefiel meine Schreibe – sagte ich das schon? – und ich erreichte damit, was ich wollte. Er ließ mir freie Hand, und ich verbiss mich in die Geschichte des Jungen Fabrikanten. Ich erkannte eine gewisse Seelenverwandtschaft zu diesem Typen und entwickelte Interesse an seinem Leben. Falsch: an seinem Lebensweg! Außerdem, das sei zugegeben, entfachte er meine Fantasie. Das wurde eine schwere Last im Hinblick auf die erwünschte Firmenchronik, auf die es bei mir eher nicht hinauslief.
Mich interessieren nämlich Menschen. Und der Zickzackkurs durchs Leben, den Dennis’ Vater hingelegt hatte, packte mich.
Der Junge Fabrikant wird 1942 als einziger Sohn der Eheleute Elfriede und Wilhelm Pretorius geboren und auf den damals progressiven Namen Manfred getauft. Er gibt zwanzig Jahre später zum Besten, dass es seine Mutter war, die ihm den Namen Adolf erspart hat. Manfred kommt in den Genuss, Kriegskind genannt zu werden, wenngleich es im Hause Pretorius immer genug zu essen gibt. Hunger im Sinne von Nahrungsmittelknappheit bleibt ihm fremd. Hunger nach Anerkennung, Liebe und Trost hingegen wird zeitlebens sein Wegbegleiter. Soweit es sich beurteilen lässt, ist die Jugend des zukünftigen Jungen Fabrikanten ungestört. (Darum zumindest beneide ich ihn. Während ich mich als Pubertierender gegen die starren Regeln meines Elternhauses auflehnen musste – Sitz gerade! Kämm dir die Haare! Rede nicht ungefragt dazwischen! Tanz nicht aus der Reihe! Was sollen denn die Leute denken! Und so weiter… –, muss Manfred Pretorius nur gegen imaginäre Wände anrennen.)
Keine Zuneigung ist seine Regel, kein Interesse seine Strafe, keine Zuwendung sein täglich’ Brot. Dagegen kann er opponieren. (Das erschien mir wiederum schwerer als mein Schicksal. Stell dir vor, du kommst als Fünfzehnjähriger mit einer Sicherheitsnadel in der Wange nach Hause und hörst bloß: „Essen steht im Kühlschrank.“)
Die Eltern Pretorius schleppen eine Menge Macken mit sich herum, die der kleine und dann größer werdende Manfred ausbaden darf. Aber was soll man schon machen, wenn der Vater sein Kriegstrauma durch innere Emigration und die Ausschaltung jeglicher Gefühle auslebt? Wie begegnet man einer Mutter, die ihre Ehe als Zwangsheirat versteht, in erotischen Gedanken einer Schulfreundin nachträumt und ihr Leben durch immer mehr Alkohol vernebelt? Der zukünftige Junge Fabrikant ist eine arme Sau. Da helfen auch kein Internat, keine zehn Loks auf der Märklin-Eisenbahn, kein Plattenspieler im Kinderzimmer und kein Taschengeld ohne Limit.
Als Siebzehnjähriger dann die große Wende. Marlene Lendruscheit, die fast sechzehnjährige Nachbarstochter, entpuppt sich plötzlich als frauliches Wesen, hat auf einmal einen völlig anderen Blick drauf, und es kommen begehrenswerte Formen in Manfreds Blickfeld. Waren die schon immer da? Er grübelt und wertet seine Entdeckungen als schöne Überraschung, um die man sich mal kümmern sollte. Lendruscheits sind Flüchtlinge, kommen aus Jägertacktau, was angeblich drei Schienen hinter Danzig liegt. Sie leben beengt im Souterrain der Nachbarsvilla. Vater Lendruscheit ist kriegsversehrt, hat ein Bein verloren, aber seinen unerschütterlichen Glauben an den Führer gerettet. Die arme Marlene. Und dann auch noch katholisch. Herr Lendruscheit arbeitet als Pförtner in der Filter- und Lüftungsanlagenbaufirma der Familie Pretorius. Ein Job, der ihn verbittert. Das Bein für Volk und Führer gegeben, und als Dank dafür wird der ehemalige Zimmermann nun in eine enge gläserne Kabine abgeschoben, muss Meldezettel ausfüllen und einen bahnschrankenähnlichen Schlagbaum öffnen und schließen. Dabei wird er vollgepufft mit den stinkenden Dieselabgasen der anfahrenden LKW. Mutter Lendruscheit erträgt still ergeben ihren Mann, kümmert sich um die Wäsche und Fußböden der Familie Pretorius und um ihre einzige, geliebte Tochter, sodass kein Rest des Kümmerns für sie selber übrigbleibt.
Manfred Pretorius feilt an Plänen. Marlene Lendruscheit hat schon einen. Sie öffnet das Vorderradventil, lässt nahezu alle Luft entweichen und schiebt das Rad rüber zu den Pretorius’. Manfred liegt im Garten hinter einem Rhododendronbusch. Neben ihm sein Koffer- radio, aus dem amerikanische Soldaten-DJs sogenannte Negermusik senden. „Hast du vielleicht eine Pumpe?“ Na klar hat Manfred eine. Ha, und was für eine sogar! Und außerdem gibt’s auch eine Luftpumpe. Der Reifen ist schnell wieder prall. Den Weg zur Eisdiele fahren sie nebeneinander. Marlene ist zu diesem Zeitpunkt schon ausgewachsen, etwa einen Meter fünfundfünfzig groß. Also eher klein. Sie hat ein rundes, fröhliches Gesicht, starke Augenbrauen und damit klare Konturen. Ihre Haare sind halblang, dunkelblond und auffällig voluminös. Sie ist eine gute Schülerin und besucht die elfte Klasse des Liebfrauengymnasiums. Alle Klassenkameradinnen mögen sie und lachen sich schlapp, wenn Marlene singt. Singen muss! Sie kann es nicht und im Sport ist sie ebenfalls eher unteres Mittelmaß. Aber sie ist kommunikativ.
Sie hat ein gewinnendes Wesen. Behaupten jedenfalls ihre Lehrer. Und Manfred wird es auch behaupten. Auf dem Rückweg vom Eiscafé fahren sie schon Hand in Hand. Natürlich nur, weil der junge Pretorius ein Gen- tleman ist und der Nachbarstochter bei dem leichten Anstieg zum Hausberg behilflich ist. Tage später. Der erste Kuss? Marlene will, glaubt aber, nicht zu dürfen. Manfred will, ist aber kein Draufgänger. Er will nur, wenn sie es will. Wieder hilft ein Plan von Marlene. „An meinem sechzehnten Geburtstag darfst du mich küssen.“ „Wann hast du denn Geburtstag?“ „Heute!“
Der Rhododendronbusch in Pretorius’ Garten wird zum Dreh- und Angelpunkt einer auflodernden Liebe. Hinter ihm gibt es eine neutrale Zone. Die Stelle kann weder aus dem Souterrain noch aus den ersten beiden Etagen der Villa Pretorius eingesehen werden. Hier treffen sich Marlene und Manfred. Manchmal nur für einen kleinen Kuss. Dann wieder, wenn die Eltern Lendruscheit vor ihrem Grundig-Radio sitzen und Operetten hören, langt Manfred über den Zaun, umfasst die zierliche Marlene, greift unter ihre Schenkel und wuchtet sie herüber. Dann werden die Küsse länger und Hände und Finger gehen auf Wanderschaft. Marlene riecht nach frischer Buttermilch, gemixt mit einem zarten, antörnenden Ton von sauberem Teer: die Reste ihrer Akne-Creme. Manfred – er würde einen Preis beim James-Dean-Doppelgänger-Contest gewinnen – riecht nach der speckigen Wildlederjacke, die ihn sieben Tage die Woche wie eine Panzerung umgibt. Seine James-Dean-Physiognomie hält sich nicht in der Gegenwart von Marlene. Ist sie bei ihm, weichen seine Züge auf und zeigen Freundlichkeit, Großzügigkeit, ein wenig Stolz und ganz viel verliebte Gefühle. Sie schaut zu ihm auf, er auf sie herunter, dennoch sind beide auf Augenhöhe. Das Jugendzimmer in der dritten Etage des Hauses Pretorius profitiert ebenfalls von der neuen Entwicklung in Manfreds Leben. Ehedem herumfliegende Socken, Unterwäsche, Badesachen, Schuhe, Cola-Flaschen, mit angetrockneten Lebensmittelresten verdrecktes Geschirr, alles wird nun fein säuberlich unters Bett geschoben. Ein Ruck an der Tagesdecke, und schon könnten nur noch kleine Schildkröten aus einiger Entfernung das neuangelegte Depot entdecken. Auch die Ordnung auf der Fensterbank – hier liegen alte Schulbücher und seit Jahren ein Berg unbeantworteter Glückwunschkarten zur Konfirmation – erhält ein neues System. Das Erkerfenster wird Beobachtungsposten und Arbeitsplatz. Schularbeiten erledigt Manfred ab sofort nur noch im Stehen. Soll ja auch gesünder sein. Alle sechzig Sekunden geht sein Blick zu dem Rhododendronbusch. Bewegt sich da was? Huscht da eine kleine Gestalt? Geht da plötzlich in den Abendstunden eines der Welthölzer, die Manfred Marlene zugesteckt hat, in Brand? Eine Fackel der Liebe? Eine Fackel der Begierde?
Puh, alles etwas pathetisch. Zu meiner Zeit hätten wir es mit einer Taschenlampe gemacht. Die Kids heutzutage würden ihr Handy traktieren. Bis hierher war die Story der beiden Verliebten doch einfach nur süß. Aber eben auch total normal. Dennoch traten diese Julia und ihr Romeo bald getrennt von der Bühne ab. Zwar nicht tot, aber fast. Und natürlich spielten die Eltern dabei die Schurkenrollen. Widerlicher Standesdünkel, einschüchternde Pfaffenhörigkeit, Dogmen und Vorurteile und sogar eine Prise Fremdenfeindlichkeit kamen ins Spiel. Wenn ich an meiner Theke mit Drama gefüttert werde, weil mir ein Gast angeblich sein Herz ausschüttet, dann sind es letztlich nur seine Unfähigkeiten, die er mit gestelzten Worten anderen in die Schuhe schiebt. Aber das Drama vom Ginsterberg war echt und damit für mich schwer einzutüten.
Zunächst läuft alles unauffällig und zur vollsten Zufriedenheit der Liebenden. Wenn Manfred die Eisdiele betritt, fragt die italienische Kellnerin nur „Una oppure due?“ Meist werden es dann due Eisbecher, weil Marlene von der Schule bis hierher rennt und zwanzig Minuten der Mutter nicht auffallen. Ins Freibad kann man auch, wenn das Wetter schlecht ist. Es könnte ja die Sonne noch herauskommen. Und gefroren wird nicht mehr.
Die Niederung entlang des Talbachs hat einen befestigten Weg zu einer Seite. Und einen verschlungenen Trampelpfad auf der anderen. Da stehen viele Sträucher. Wenn Manfred zu schnell kommt und das Taschentuch nicht rechtzeitig am Platz ist, hilft der Talbach mit seinem klaren Wasser. Das Gebüsch hält dicht und wird ebenso wie der Rhododendron ein Freund der Liebenden. Knapp ein halbes Jahr geht das so. Die Mütter ahnen was, aber die Väter bleiben blind. Frau Lendruscheit findet nicht die richtigen Worte, und Frau Pretorius hat Likör.
„Wirst du mich einmal heiraten?“ Marlene beobachtet die Augen von Manfred mit aller möglichen Konzentration. Natürlich lächelnd. Manfred schlüpft kurz in seine James-Dean-Rolle zurück und sagt cool: „Wen sonst?“ Beide überraschen sich damit, lachen und finden alles richtig so, wie es ist. Vorboten für das aufziehende Drama werden in Manfreds Zimmer sichtbar. Auf einmal ist die Müllhalde unter seinem Bett verschwunden. Das Schreibtischholz bekommt wieder Luft zu atmen, weil Herumfliegendes zu Stapeln verdichtet wird. Manfred schleppt den Siemens-Staubsauger aus dem Keller und lässt ihn nach dem Gebrauch vor der Tür stehen, wo ihn Frau Lendruscheit Tage später findet. Er grübelt, ob er den Goethe-Gedichtband einsortieren oder an oberster Stelle auf den Bücherberg legen soll. Nein, er will punkten. Und er will sich outen. Er ist nun mal Goethe-Fan, kennt einige Dutzend Gedichte des großen Meisters auswendig und erträgt seit Jahren seinen Spitznamen. Sie nennen ihn Werther. Jegliches Aufbegehren dagegen ist zwecklos. Natürlich wäre er lieber Dean gewesen. Doch Manfred Pretorius bleibt Werther. Der Deutschpauker verschlimmert die Situation noch, als er sagt: „Sei doch stolz darauf!“ Auch Marlene hat von Werther Wind bekommen. In ihrer Schule ist der Name ein Begriff, weil sich dahinter ein begehrenswerter, etwas geheimnisvoller Junge verbirgt. Eine stattliche Erscheinung, immer in braunem Wildleder, mit Haartolle über der Stirn und Röhrenjeans mit Kupfernieten. Leider kommt dieser starke Halbstarke nicht mit zum Tanzunterricht. Die Parallelklasse bedauert das ausnahmslos. Dann hört Manfred Pretorius seinen Spitznamen zum ersten Mal gerne: „Na du mein kleiner Werther?!“, sagt Marlene und schmiegt sich an ihn.
Aus allen Ecken des Schulhofes kommen Elvis-Fotos. Marlene steht auf Presley, der in ihrem Elternhaus absolutes Auftrittsverbot hat. Manfred zahlt gute Preise für besonders sauber und knickfrei ausgetrennte Bravo- Starschnitte. Aber auch kleine Bilder des Idols werden noch mit einigen Groschen honoriert. Zuhause wandelt sich das Zimmer im dritten Stock in eine Devotionalien-Sammlung. Die Wände sind am Ende tapetenfrei. Überall Elvis. Ein Fan wird hier auf die Knie gehen und in Freudentränen ausbrechen. Emotion pur. Und genau darauf kommt es an. Manfred Pretorius erwartet nämlich einen VIP-Gast in seinem Zimmer, für den kein Aufwand zu groß ist. Der Zehnplattenwechsler hat alles, was Hitze bringt. Von Heartbreak Hotel bis Hound Dog.
An einem Freitag im Oktober 1959 ist der große Tag. Betriebsfest bei Pretorius Filter- und Anlagenbau. Alle Mitarbeiter mit Begleitung werden sich von Wilhelm Pretorius – dem Alten Fabrikanten – eine ermüdende Rede anhören, um dann Hühnerbrühe mit Einlage, Schnitzel, Kroketten, Mischgemüse und Vanillepudding mit Schlagsahne reinzuschieben. Allergrößte Portionen, dafür ist das Gasthaus am Mühlenteich bekannt. Erst danach gehen die Hände der Männer zum stramm gebundenen Schlips, um den Knoten etwas zu lockern. Die Zunge löst ein Jacobi-Weinbrand, 4 cl, für jeden! Die Damen bleiben beim Zeltinger Himmelreich von der Mittelmosel, die Männer wechseln zu Dortmunder Union Export-Bier, zur besseren Verträglichkeit begleitet von Schlichtes Steinhäger. Gegen 23 Uhr spendiert der Alte Fabrikant eine Runde seiner besten Zigarren und der Saal wird in eine hustenauslösende, blaue Wolke getaucht. Die Fabrikanten-Gattin bleibt beim Weinbrand, den sie mit ein paar Eckes Edelkirsch weich spült. Der Junior Pretorius ist heute leider nicht dabei, ihn plagt eine üble Magenverstimmung – vielleicht kommt er später noch. (Klar, und wie er kommt!) Eine Dreimannkapelle – es ist die beliebte Combo Rudis Schuhriegels – spielt, was das Tanzbein begehrt. Gegen 23.30 Uhr kommt es zu einer denkwürdigen, nur aus der Vogelperspektive bemerkbaren Doppelbegegnung der Familien Lendruscheit und Pretorius. Während in Manfreds Zimmer bereits alle Hüllen gefallen sind und der Körperkontakt kaum enger sein könnte, schlurft der Alte Fabrikant an die Theke, rempelt seinen Pförtner an, klopft ihm jovial auf die Schulter und trötet: „Lendruscheit, woll’n Se’ne Runde Walzer tanzen oder dreht sich dann Ihr Holzbein ab? Ha ha, nichts für ungut, kommen Se, wir heben einen. Und da, die sind fürn Heimweg!“ Er stopft dem armen Mann drei dicke Zigarren in die Brusttasche und bestellt ein Herrengedeck – mit doppeltem Beschleuniger. Lendruscheit ist zuerst verärgert, dann stolz. Er strahlt seinen Chef an und fühlt sich ihm für ein paar Augenblicke ebenbürtig.
Manfred weiß aus Erfahrung genau, wann und in welchem Zustand seine Eltern zurückkommen werden. Hackevoll wird der Alte Fabrikant noch spät in der Nacht seine Frau besteigen, die unter alkoholischer Vollnarkose alles geschehen lässt. Marlene weiß nicht, wann ihre Eltern heimkommen. Sie ist unruhig. Ein paar Minuten nach Mitternacht flieht sie, bis zum Rhododendron begleitet von Manfred. Der hebt sie über den Zaun – ein Blick – nein, Gott sei Dank noch kein Licht im Souterrain und daher noch Zeit für Küsse, Küsse, Küsse. Als Motorengeräusche von der Straße zu hören sind – ein vorbeifahrendes Auto? Ein anhaltendes Taxi? –, läuft Marlene zum Haus, öffnet das angelehnte Fenster, springt in ihr Zimmer und huscht zur Toilette, in der um das Waschbecken herum alle Körperpflege-Utensilien der Familie an Haken hängen. Die Mutter wird wenig später bemerken, dass Marlenes Zahnbürste noch feucht, nein, sogar nass ist, obwohl sie schon fest zu schlafen scheint. Natürlich schläft Marlene nicht. Nicht in dieser Nacht. So hört sie, wie das Holzbein des Vaters zuerst ans Bett gestellt wird und dann umfällt; wie die Mutter kichert und wenig später ein Grunzduett durch die Wand dringt. Dann kommen viele „Aaaahs“, etwas Ruhe und dann zimmermannmäßiges Schnarchen. Marlene weiß seit dieser Nacht, was die „Aaaahs“ bedeuten. Es ist etwas Schönes, auch wenn es noch wehtut.
Der Sonntagmorgen, normalerweise fest vergeben an die Langeweile, entwickelt sich dieses Mal völlig anders. Vater Lendruscheit hätte man sogar das zweite Bein amputieren können – zur Kirche wäre er zur Not gerobbt. Aber nicht mit einem Kater, der den Kopf spaltet und einen Vulkanausbruch nach dem anderen simuliert. Schwankend kommt er von der Toilette und grummelt: „Scheiße, ich kann nicht mal kotzen. Obwohl ich ständig würgen muss.“ Die Gefahr, in die Kirche zu torkeln und sich dort zu übergeben, ist real. Daher der Befehl: „Geh’ mit der Tochter!“ Aber Mutter Lendruscheit will nicht, weil sie nicht kann. Es ist ebenfalls der Kopf. Sie schleppt sich in Marlenes Zimmer und bittet: „Geh’ du, mein Kind. Und pass schön auf, was der Pfarrer sagt.“ Marlene ist nicht nach Beten zumute. Sie spürt ein unbändiges Verlangen zu beichten. Besser, zu reden, sich auszutauschen.
Im Hause Pretorius ist es still. Eine Stille, die bis weit in den Nachmittag reicht. Manfred hat die Nacht der Nächte durchlebt. Zweimal hat er noch Hand an sich gelegt, um die ungeheure Energie, die sich in seinem Unterleib nach den Stunden mit Marlene aufgestaut hat, wieder loszuwerden. Und auch wenn sich in seinem Kopf alles dreht, eines ist klar: Er will sie. Will ihr nah sein, wann immer es möglich ist. Sie muss mit ihren Eltern zur Kirche gehen, das weiß er. Der Sonntagmorgen ist damit verplant. Manfred wird auch in die Kirche gehen, Abstand halten, aber so viele Blicke wie nur eben möglich von ihr einfangen. Er weiß, wo St. Jodokus liegt, wenngleich er nie dort war. (Logisch, er ist schließlich nicht katholisch, so wie mein Bahnhof, wenn ich das mal an dieser Stelle werbewirksam einschieben darf.) Dann wird Gottes große Gnade den Liebenden zuteil. Manfred steht, lässig an sein Fahrrad gelehnt, auf der gegenüberliegenden Straßenseite und beobachtet die braven Kirchgänger, wie sie mit ruhigen Schritten zum Portal gehen, wo sie ein Mann in schwarzer Soutane begrüßt, bevor sie eintreten. Plötzlich, die Glocken läuten schon bedrohlich lange und der Strom der Gottesdienstgänger ist fast verebbt, rast ein dunkelblonder Engel mit wehenden Haaren auf einem alten Damenrad heran. Offener roter Anorak, darunter ein schwarzer Rock mit weißer Bluse. Manfred sieht gebannt hin: weit und breit keine Eltern des Engels. Eine himmlische Fügung? Er wartet eine kleine Minute, dann läuft er rüber, zieht die schwere Kirchentür auf und sieht auf der letzten Bank den begehrenswertesten Schopf des Erdenrunds. Ohne Griff ins Weihwasserbecken, ohne sich zu bekreuzigen, schlüpft er als letzter Teilnehmer der Veranstaltung neben die auf der Bank liegende rote Jacke, den Blick starr nach vorne gerichtet und atemlos, weil er sich schlicht nicht mehr zu atmen traut. Nach einer Ewigkeit rutscht er ein Stück an sie heran und legt eine Hand auf die Jacke. Sein Herz schlägt lauter als die Glocken im Turm. Doch dann legt sich eine Hand auf seine. Diese beiden Hände! Wie viele Worte sie miteinander wechseln! Zwischendrin muss man auf die Knie fallen, die Hände falten, ein Gesangbuch zur Hand nehmen und die Lippen bewegen. Dann herrscht wieder Ruhe und die Hände können weiter kommunizieren. Marlene sieht den leuchtenden Altar, und sie sieht ganz deutlich, wie sie selbst dort steht, als Braut in Weiß, die gleiche Hand in ihrer Hand wie gerade jetzt. Manfred sieht den Altar und träumt dasselbe, sieht sich und Marlene, nur will er es in seiner Kirche – hier ist es ihm zu fremd, zu lateinisch, und es riecht nach verbranntem Unkraut. Nach etlichem Auf und Nieder, nach Chorälen und Orgelgedonner, nach abgekanzelten Vorschriften und Empfehlungen fürs tägliche Leben, hört Manfred plötzlich ein geflüstertes „Geh!“ und sieht ihren Finger in Richtung Ausgang zeigen. Das Ende der Vorstellung. Manfred versteht und verdrückt sich als Erster, um die Strafe Gottes für seinen lästerlichen Auftritt entgegenzunehmen:
Sein Rad ist geklaut. Das können schon mal keine Christenmenschen gewesen sein, denkt er und ignoriert seinen Ärger. Er schlendert in Richtung Hausberg und dreht alle zehn Sekunden den Hals zurück. Seine Geduld wird stark gefordert, aber dann ist sie da, Marlene bremst und ruft lachend: „Du Teufel!“
Jeder Jüngling sehnt sich, so zu lieben, jedes Mädchen, so geliebt zu sein. aus: Zur zweiten Auflage des Werther, Goethe
Die Wochen nach dem Betriebsfest bei Pretorius Filter- und Anlagenbau werden zu den glücklichsten im Leben von Manfred. Kurioserweise hilft der Alte Fabrikant tatkräftig mit, das Glück möglich zu machen. Eine Initiative der Handelskammer in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Versehrtenbund organisiert Umschulungsmaßnahmen, in denen Kriegsinvaliden von Handwerkern zu Bürokräften umgeschult werden. Der Pförtner Lendruscheit soll Kalkulator werden und bekommt einen der wenigen Plätze dieser Saison, weil sich sein Chef für ihn einsetzt. Ein paar Telefonate, und schon werden im Souterrain die Koffer gepackt. Ein halbes Jahr läuft der Kurs in der Landesbildungsanstalt Pente bei Bramsche. Alle vier Wochen dürfen die Teilnehmer für ein verlängertes Wochenende nach Hause.
Gestern hatte Ché-Daniel seinen dritten Geburtstag. „Du bist auch eingeladen!“, sagte Hanna, aber es klang wie: Komm’ ja nicht! Es fand nämlich bei ihren Eltern statt. Das muss man sich mal klarmachen: Mein Sohn wird drei, und ich werde quasi ausgeladen. Natürlich wusste ich, dass dem Großvater meines Sohnes der Geburtstag seines Enkels völlig wurscht war – er wollte nur sein Geld zurück, das er mir geliehen hatte. Aber mein Sohn ist mir wichtig, der feiert nicht ohne mich. Verkorkste Typen gibt’s weiß Gott genug auf der Welt. Meistens sind es gestörte Vater-Sohn-Beziehungen. Genau auf diese Problematik habe ich Dennis Pretorius aufmerksam gemacht, als ich ihm vorschlug, mir einen weiteren Vorschuss für das Buch zu geben. Er kam mit zweitausend und wollte wissen, ob ich schon im Firmenarchiv gewesen sei. Ich vertröstete ihn qualifiziert und stockte aus eigenen Mitteln den Betrag um weitere tausend Euro auf. Der von mir fest eingeplante gute Eindruck gestern Nachmittag hat sich nicht eingestellt. Mein Puzzle für Ché-Daniel war angeblich erst für Fünfjährige zugelassen, und Hannas Vater nörgelte: „Ich bekomme aber fünftausend, und warum gibst du mir das Geld in kleinen Scheinen?“ Ich zischte nur: „Herrgott, weil bei mir in der Kneipe nicht mit Fünfhundertern bezahlt wird!“
Die Lovestory von Marlene und Manfred ist voll in Fahrt gekommen. Und ohne Vater Lendruscheit im Nacken lassen sich kleine Freiräume zu immer größeren ausweiten. Ausreden werden zum wertvollsten Kapital in diesen Tagen. Zum Beispiel die anstehenden Bundesjugendspiele. Marlene erfindet zwei extra Sportstunden, die dann in Manfreds Zimmer abgehalten werden. Mit vollstem Körpereinsatz. Am Talbach, in der Dämmerung, kniet Marlene sich hin und holt aus Manfreds Hose, was ihr nicht mehr fremd ist. Sie schaut zu ihm auf und küsst und liebkost. Kurz vor dem Äußersten bricht Manfred ab. „Nein – mein Engel – ich will dich nicht …bitte… es ist sooo schön!“ Dann kommt es aus ihm heraus und landet im Gras. Manfred vibriert, durchflutet von Glücksgefühlen. Sein Kopf ist außer Betrieb. Marlene umklammert ihn von hinten und nimmt die Sache in die Hand. Tempo-Taschentücher helfen. Es gibt keine Grenzen mehr zwischen den Liebenden. Nichts bleibt unbekannt. Aber alles aufregend.
Selbst an Tagen, an denen Frau Lendruscheit bei Pretorius putzen muss, kommt es zu Schäferstündchen in der dritten Etage. Sie schleichen durch die Kellertür ins Haus. Manfred läuft vor und checkt die Lage. Hört er seine Mutter und Frau Lendruscheit in der Küche tratschen, rennt er zurück, schnappt Marlenes Hand, und schon geht es auf Zehenspitzen im Hundertmetertempo durch das dunkle Treppenhaus hoch in die Kammer der Glückseligkeit. Kaum ist Herr Lendruscheit ein paar Tage weg, entdeckt Marlene ihre Leidenschaft für die Abendluft. „Mutter, ich geh’ ein paar Schritte vor die Tür, danach kann ich besser lernen.“ Vor der Tür ist hinter dem Rhododendronbusch, den Manfred im Sechzigsekundentakt kontrolliert. Taucht Marlene auf, stürzt er wie ein Falke die Treppen hinunter und hetzt in den Garten zum Spontan-Rendezvous.
Zunächst nur ein paar Momente, dann von Tag zu Tag mehr Minuten. Küsse, Fummelei, Geflüster und Liebesschwüre ohne Ende. Und immer gibt es zum Abschied den kleinen Zettel mit ein paar Goethe-Worten. Ein Ritual seit dem Betriebsfest.
Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde! Es war getan fast eh gedacht. Der Abend wiegte schon die Erde, und an den Bergen hing die Nacht.
Samstag und Sonntag darf Marlene bei ihrer Freundin Emmy schlafen. Die Eltern haben ein Wochenendhaus am Dümmer. Emmy hat einen Fußballer von der Arminia, der schon eine eigene Wohnung besitzt. Und ein Auto. Emmy darf das Wochenende zum Ausgleich bei den Lendruscheits verbringen. Damit gibt es ein nahezu wasserdichtes Doppelalibi. Marlene und Manfred spielen zwei Tage Ehepaar. In Werthers Rucksack steckt ein ganzes Graubrot, eine Dose Rama-Margarine, ein Glas Erdbeermarmelade von Schwartau, ein Stummel Salami und eine Dreierpackung Ritex-Gefühlsecht. Nötig wäre eine Sechserpackung. Die beiden können einfach nicht voneinander lassen. Ständig fallen sie übereinander her und schaffen es, immer das Gleiche zu wollen, gesteuert von einer unsichtbaren, magischen Kraft. Dieses Mal fragt Manfred: „Heiratest du mich?“ „Ja! Ja! Ja!“ „Wann?“ „Warum nicht sofort?“ Die erste Liebe. Und dann auch noch eine fürs ganze Leben! Nicht einfach eine Schwärmerei, ein bloßes Ausprobieren oder eine Romanze. Hier haben zwei Menschen das Glück, den Richtigen für immer gleich beim ersten Mal gefunden zu haben. Mutter Lendruscheit sieht es ihrer Tochter Sonntagabend an. Marlene ist hundemüde, aber glücklich. Klammheimlich freut sich die Mutter für ihre Tochter – Vorhaltungen und Ermahnungen entsprechen daher einem vermeintlichen Pflichtprogramm. Aber Marlene kann punkten. Sie erzählt vom Gottesdienst in Damme und hat eine perfekte Nacherzählung der Predigt im Angebot. Fantasie hilft.
Manfred macht die ersten Beobachtungen, wenngleich er sie nicht zu deuten weiß. Er tastet Marlenes Brüste und freut sich darüber, dass sie eher gewachsen, ja sogar fester geworden sind. Auch in ihrem Schritt gibt es Bemerkenswertes. Beim Streicheln über ihre Schamlippen kommen ihm diese runder und praller vor. Die zarte Wölbung ihres Bauches bemerkt er nicht. Erstaunlicherweise Marlene auch nicht. Ausgerechnet in der Mathestunde kommt ein deutlicherer Hinweis. Marlene steht an der Tafel und soll eine Gleichung lösen. Differentialrechnung in der elften Klasse, für Marlene kein Problem. Aber auf einmal wird ihr schummerig vor Augen. Später wird sie es als „schwarz“ beschreiben. Die Knie werden weich und es bleibt keine Zeit, sich noch rechtzeitig am Lehrerpult abzustützen. Sie sackt zusammen und kommt erst wieder zu sich, als sie schon auf dem Stuhl des Lehrers sitzt. Zur Schau gestellt vor der Klasse. Man könnte vermuten: als eindringliche Warnung. Zuhause spricht Mutter Lendruscheit zum ersten Mal mit ihrer Tochter über ein Thema, welches nun als Aufklärung leider zu spät kommt. „Wann hattest du denn zuletzt deine Tage?“ Und dann: „Erbarmen! Herr im Himmel, sei bei uns, beschütze uns, lass’ es kein Kindchen sein. Allmächtiger, sei gnädig mit uns armen Sündern jiib uns Stärke, jiib Hoffnung!“ Fromme Wünsche, aber alle vergebens. Es bleiben nur Tränen, Kummer und die schiere Ausweglosigkeit. Die Mutter weint die Nacht hindurch. Marlene kann nur noch schluchzen und zittern. Am nächsten Morgen: „Welch Unglück bringst du über uns! Der Vater wird dich zur Hölle wünschen! Ein Balg, Erbarmung! Verdammnis! Fegefeuer! Du zerstörst unser Leben! Herr Jott nimm dich unserer an!“ Es ist ein Freitag. Morgen wird der Vater zu Besuch kommen. Marlenes Situation ist ausweglos. Ausgerechnet jetzt ist Manfred auf Klassenfahrt. Seine Zwölfte fährt mit der Dreizehnten zusammen nach Berlin. Manfred schreibt drei lange Briefe und schickt sie vereinbarungsgemäß an Emmy. Diese Briefe kommen an, aber erst dreiundvierzig Jahre später. Frau Lendruscheit holt ihren Mann vom Bahnhof ab. Sie will das Schlimmste verhindern und den zu erwartenden cholerischen Anfall abmildern. Trotzdem schlägt er zu. Marlenes Kopf taumelt von den Ohrfeigen hin und her. Als sich die Mutter dazwischenwirft, ergeht es ihr nicht anders. Sie bekommt ein blaues Auge und Marlene sämtliche Finger ihres Vaters als rote Striemen ins Gesicht gezeichnet. Zwei Tage wird im Hause Lendruscheit nur gebrüllt und geweint. Die totale Verzweiflung übernimmt die Macht und bestimmt das Handeln. Bei allen.
Das Firmenarchiv der Pretorius Filter- und Anlagenbau GmbH & Co. KG hatte lediglich einen wohlklingenden Namen. In Wirklichkeit war es ein staubiges Kabuff, keine zehn Quadratmeter groß. Den Schlüssel für die Kammer verwaltete eine unattraktive, lustlose Sekretärin. Dies ist übrigens ein sehr doppeldeutiger Hinweis, denn wie ich später erfuhr, gab es für diesen Job in der Firmenvergangenheit durchaus attraktive, der Lust sehr zugetane Damen. Davon später mehr. Mein erster Besuch im Archiv war eher die Vortäuschung aktiver Recherchen. Ich wollte Dennis beruhigen und konnte deshalb mein Glück kaum fassen, als die Beleuchtung streikte. Die ausgeleierte Neonröhre schaffte nur noch ein unregelmäßiges Aufflackern. Um nicht mit leeren Händen zu gehen, schnappte ich mir wahllos einen Ordner, gab den Schlüssel wieder ab und verschwand.
Umso anstrengender wurden die Treffen mit meinem Sportskameraden Pretorius. Ich quetschte ihn aus über Themen, auf die ich scharf war, während er immer wieder monologisierte und Sachen zum Besten gab, die mich nicht im Geringsten interessierten. Aber ich erschloss mir neue, unerwartete Informationsquellen, die ergiebig sprudelten. Heinrich von Zegenhagen, Stammgast schon zu Zeiten, als mein Vater noch hinterm Tresen stand, erschien eines Tages an meiner Theke. Er hatte mich mit Dennis Pretorius im Café Fritzenkötter gesehen und wollte nun wissen, was ich mit diesem Taugenichts zu tun hätte. Kaum erwähnte ich den Namen des Jungen Fabrikanten, sprudelte der Mann schon los. „Manfred Pretorius? Ach was, Werther haben wir den genannt. Der konnte zu jeder Situation ein Goethe-Zitat beisteuern. Alles auswendig! Und jede Menge Gedichte hatte der auf der Pfanne. Glaubt man nicht. So ’n junger Kerl. Einer von uns und dennoch irgendwie anders. Sensibler, würde ich heute sagen. Na, und dann ist der so abgestürzt. Hat nicht mal Abitur gemacht. Jedenfalls nicht mit uns. Schade, aber er soll sich ja gefangen haben, später dann. Wir hatten nie mehr Kontakt zu ihm. Er kam auch nicht zu Klassentreffen. Es hieß ja, er sei an Liebeskummer fast krepiert. Machste mir noch ein Herforder?“
Montag früh erscheint der zu einem Umschulungskurs entsandte Pförtner Lendruscheit überraschend in der Firma. Grußlos und mit hochrotem Kopf läuft er an allen vorbei. Frau Zirpins sagt: „Da können Sie nicht rein!“ Doch, er kann. Er reißt die von innen mit Leder überzogene, schaumstoffgepolsterte Tür des Alten Fabrikanten auf und läuft auf dessen Schreibtisch zu. Mit geballten Fäusten presst er es hervor: „Ihr Sohn, das Schwein, hat meine Tochter geschwängert! Er hat aus ihr eine Hure gemacht!“ Mehr zu sagen gelingt ihm nicht. Sein am Sonntag eingeübter Text ist weg. Aber es ist auch nicht mehr nötig. Wilhelm Pretorius erfasst die Situation blitzschnell. Er steht auf und drückt auf die innere Deeskalationstaste, die er für Momente wie diesen zur Verfügung hat. „Mensch, Lendruscheit, das klären wir doch! Das klären wir wie Männer, was? Wir haben doch schon ganz andere Sachen durchgestanden, wie? Wir sind beide nicht vorm Iwan weggerannt. Und nun rennen wir auch nicht weg. Sie haben schon Ihr Bein verloren, da verlieren wir doch jetzt nicht auch noch den Kopf, was? Kommen Se, erst mal einen Weinbrand. Ach, was sag’ ich, einen Cognac natürlich. Und nicht irgendeinen, den besten, versteht sich. Komm, setzen Sie sich. Mensch, Lendruscheit, wir zwei, wäre doch gelacht, wenn wir da keinen Dreh reinkriegen. Kleinen Moment – Frau Zirpins, ich bin für niemanden zu sprechen, klar? Selbst wenn der Adenauer anruft, nicht durchstellen, keine Störungen, klar? So, Lendruscheit, nun besprechen wir das mal in Ruhe. Hier, trinken Sie. Prost! Auf uns!“
Zwei Männer mit völlig verschiedenen Ausgangs- lagen, aber einem gemeinsamen Problem. Der Alte Fabrikant findet es unstandesgemäß, seinen Sohn in den Fängen der Tochter eines Pförtners und einer Putzfrau zu wissen, dazu auch noch aus dem Osten. Der Pförtner glaubt, sich schämen zu müssen. Die Schmach im Angesicht der kirchlichen Instanz und die erwartete Häme der Gesellschaft lassen ihn verzweifeln. Und was soll die Verwandtschaft denken? Die Männer finden zusammen, schmieden einen Plan, der beiden Ausweg und Perspektive verspricht.
Als Alfons Lendruscheit das Büro von Wilhelm Pretorius verlässt, hat er nicht nur einen Scheck über zehntausend D-Mark in der Jackentasche, sondern er ist Teil einer Verschwörung, bei der er das Gefühl hat, sie mit entwickelt zu haben. Romeo und Julia sind ab jetzt nur noch Marionetten.
Manfred kommt erst am späten Abend von der Klassenfahrt zurück. Der Bus hat eine Panne, und an der Grenze nerven die Vopos mit stoischem Kontrollwahn. Von seinem Zimmer aus sieht er bei den Lendruscheits kein Licht mehr. Trotzdem rennt er noch einmal in den Garten und checkt die Lage von dort aus. Das Ergebnis bleibt gleich. Marlene schläft. Wie kann sie ruhig schlafen, wenn ihr Liebhaber vor ihrem Fenster hin und her schleicht?
Am nächsten Morgen ist sein erster Weg wieder zum Rhododendronbusch. Von hier aus sieht er nur gardinenverhangene Fenster. Ausgerechnet heute, an einem Samstag, ist schulfrei. Mittags radelt Manfred zu Emmy. Ihre Eltern sind liberal, da traut er sich zu klingeln. Emmys Großmutter öffnet und sagt: „Die sind alle am Dümmer.“ Verflucht, was wollen die zu dieser Jahreszeit dort?! Die Wohnung der Lendruscheits bleibt das ganze Wochenende über dunkel. Die Gardinen bewegen sich nicht. Auch die Messe am Sonntag wird ohne Marlene und ihre Eltern gefeiert. Manfred ist kurz vorm Durchdrehen.
Montag schwänzt er die Schule und steht schon vor der ersten Pause an der kleinen Mauer am Schulhof des Liebfrauen-Gymnasiums. Endlich klingelt es. Mehrere hundert Mädchen kommen teils kichernd, untergehakt, hüpfend, in Gruppen oder alleine heraus. Aber weit und breit kein kleiner, dunkelblonder Lockenkopf mit rotem Anorak. Endlich entdeckt Manfred Emmy. Es klingelt schon wieder und es bleibt keine Zeit für ausführliche Informationen. Nur so viel: Marlene ist schon seit Tagen nicht mehr zur Schule gekommen. Manfred wird fast verrückt. Er rast zurück und klingelt bei Lendruscheits. Laut und lange. Aber es regt sich nichts. Vom Herzklopfen ist es ein kurzer Weg zum Herzrasen. Manfred stürmt ins Haus, reißt die Tür zum Zimmer seiner Mutter auf und schreit: „Was ist mit Lendruscheits?“ Frau Pretorius ist noch klar bei Verstand. Sie legt die
Tageszeitung auf ihre Knie und schließt den Morgenrock. „Das wüsste ich auch gerne. Die gute Frau hat mir den Hausschlüssel gebracht und nur gesagt: ‚Ich gehe!‘ Das muss man sich mal vorstellen. Ist das eine Art zu kündigen? Jahrelang habe ich ihr die Treue gehalten, sie gut behandelt und all ihre Oberflächlichkeit ertragen. Und was ist der Dank? Sie lässt mich im Stich, sagt kein Wort der Entschuldigung und zieht mit ihren verheulten Augen davon. Es rächt sich eben, wenn man die einfachen Leute zu nah’ an sich heranlässt. Impertinent und undankbar!“
Manfred knallt die Tür zu und rennt in sein Zimmer. Ein Weinkrampf im Kissen. Er kann es nicht glauben. Dann die Eingebung. Der Briefkasten! Manfred braucht keine zehn Sekunden für drei Etagen. Keine Post. Kein Zettel. Seine Finger suchen im Inneren nach heimlichen Verstecken. Oder liegt vielleicht eine Nachricht unter einem Stein hinter dem Rhododendron? Manfred sucht alles ab. Immer wieder. Eine erfolglose Schnitzeljagd. Auf einmal kommt ihm ein furchtbarer Verdacht. Er wird ruhig und grimmig. Wieder setzt er sich auf das Rad seiner Mutter und strampelt zur Firma. Er kennt den Leiter der Lohnbuchhaltung gefühlt seit seiner Geburt. Ein freundlicher Mann, immer erfreut, wenn er den jungen Pretorius zu Gesicht bekommt. „Herr Behringer, was ist mit unserem Pförtner, dem Herrn Lendruscheit?“ „Ach Junge, der Lendruscheit, ja, den haben wir abgemeldet. Der hat uns verlassen. Musste alles zack, zack gehen. Der Mann kam mir vor wie auf der Flucht. Aber dein Vater wollte, dass wir uns beeilen. Kennst du den Lendruscheit denn überhaupt? Ach ja, der wohnt ja bei euch, stimmt’s?“
Grußlos ignoriert Manfred die Sekretärin seines Vaters, von der die halbe Stadt weiß, dass sie es mit dem Alten Fabrikanten treibt. Sein Vater sitzt am Schreibtisch und schaut über die Lesebrille zu dem unangekündigten Besucher. Er scheint über den Auftritt seines Sohnes nicht überrascht zu sein. „Hast du etwas mit dem Verschwinden von Lendruscheits zu tun?“ brüllt Manfred und ist außer sich. Aber die Wut gewinnt nicht die Oberhand. Er schafft es, vor dem fetten Arbeitstisch stehen zu bleiben. „Guten Tag, mein Sohn. Ich sitze hier seit Stunden über der konsolidierten Bilanz unserer Firmengruppe. Wer Bilanzen richtig lesen kann, weiß am Ende alles. Aber auf deine Frage konnte ich bisher nicht den kleinsten Hinweis finden. Was ist denn so interessant an Lendruscheits?“ Ein Vatermord? Wäre in diesem Moment nicht das, was die Vernunft empfiehlt, aber naheliegend. Manfred sieht die gusseiserne Leselampe auf dem Schreibtisch und spürt, dass sie jetzt auf dem Kopf des Vaters genau richtig platziert wäre. Grenzenlose Empörung und Abneigung kreuzen sich in den Blicken von Vater und Sohn mit der gleichen Menge an Desinteresse und Gefühllosigkeit. Aber zum Vatermord kommt es nicht, weil Manfred einfach schreit: „Du emotionaler Krüppel!“ Im Weggehen denkt er: „Was für ein mieses Schwein!“
So hab ich wirklich dich verloren? Bist du, o Schöne, mir entflohn? Noch klingt in den gewohnten Ohren ein jedes Wort, ein jeder Ton.
Man muss auch mal Glück haben im Leben! Schon bei der Begrüßung wusste ich es. „Hallo Ronald, haste mal ’ne Minute?“ Dennis Pretorius wollte was und kam mit einem riesigen Sack kleiner Brötchen in den Katholischen Bahnhof. „Warte mal einen Moment“, sagte ich strategisch und lief in den Clubraum, um dort absolut nichts zu erledigen. Dann kam ich wieder raus und fragte salopp: „Na, was gibt’s?“ „Hör zu, Alter, ich habe eine super Frau aufgerissen. Traumfrau sozusagen. Und ausgerechnet diese Schnecke steht auf die Arminia. Morgen ist das Pokalspiel, will sie unbedingt sehen. Ich habe ein bisschen auf die Kacke gehauen und gesagt: ‚Baby, da stehst du neben mir.‘ Verstehst Du? Ich brauche unbedingt deine Karte! Bitte, lass mich nicht hängen. Ich zahle einen Hunni!“ „Wieviel?“ fragte ich überrascht, und er meinte: „Zweihundert!“ „Bist du krank? Das ist das Spiel der Spiele. Wolfsburg, diese armselige Söldnertruppe, die blasen wir vom Rasen! Ein Schritt vorm Endspiel, und das soll ich deiner Meinung nach erst am nächsten Tag in der Zeitung lesen? Geh zum Arzt, Mann. Alleine für die Frage bekommst du Paragraph 20 StGB. Du spinnst total!“ Ich war ehrlich empört, geradezu entsetzt. Dieser Antrag war nicht nur unanständig, er war auch sittenwidrig. Jedenfalls in Fußballerkreisen. Dennis jammerte rum, erhöhte auf zweihundertfünfzig und stellte dann endlich eine vernünftige Frage. „Also komm schon, was ist dir die Karte wert?“ Ich ging in mich. Für die Idee, die dann kam, möchte ich mich ausnahmsweise loben. Besser ging es nicht. Ich sagte: „Gib mir die gesamte Kohle für das Buchprojekt. Steht mir ja sowieso zu. Mein Ehrenwort, dass ich es zu Ende schreibe. Dafür kriegst du die Karte. Umsonst, versteht sich.“ Zwei Stunden vor Spielbeginn kam er mit einem Scheck. Einundzwanzigtausend! Bedeutete die absolute Freiheit beim Schreiben. Übrigens, die Arminia hat die Partie 0:4 verloren. War klar.
Manfred Pretorius schafft es ohne zu heulen, das Firmengelände zu verlassen. Für ihn besteht nicht der geringste Zweifel. Wieder eine der perfekt eingefädelten Intrigen des Vaters, auf die er bei seinen Erzählungen am Abendbrottisch mit Stolz verweist. Wie auf seine intakten Seilschaften. Alte SS-Kumpel sitzen an allen möglichen Schaltstellen im Nachkriegsdeutschland. Lendruscheits sind weg. Garantiert durch die hinterhältige Hand des Alten Fabrikanten in Bewegung gesetzt. Und Manfred weiß sofort, sein Vater wird nicht den geringsten Hinweis liefern. „Für uns gibt’s immer was Besseres!“, eine häufig benutzte Floskel des alten Herrn. Breit grinsend vorgetragen. „Marlene war ihm nicht gut genug“, erkennt Manfred und beschließt: „Das büßt du mir!“ Auf dem Rad jagt er Richtung Sparrenburg. Die Nässe in den Augen könnte auch vom Fahrtwind kommen.
Die Sparrenburg hat einen schönen runden Turm. Von dort überblickt man die ganze Stadt. Für den letzten Blick im Leben geradezu ideal. Als es den Berg hochgeht und die Steigung ihm den Atem nimmt, schmeißt Manfred das Rad gegen eine Hecke. Er braucht es nicht mehr, und darüber hinaus ist es ab sofort auch nicht mehr Teil des Familienvermögens. Ja, Manfred ist nun hundertprozentig Werther. Hat der sich nicht auch das Leben genommen? Unglücklich verliebt und so? Ein super Vorbild für alles, was jetzt kommen soll. Ausweglosigkeit, Verwirrung und der unbeschreibliche Verlust des einzigen geliebten Menschen auf der Welt – da ist ein korrekter Selbstmord doch der naheliegende Schritt. Wie kommt man sonst damit klar? Manfred sieht zum Suizid keine Alternative. Dennoch bleibt ein Rest Pragmatismus handlungsbestimmend. Er wird aus dem Leben scheiden, der Entschluss steht fest. Aber wie? Zwei Faktoren spielen, bei aller selbstverordneter Konsequenz, eine Rolle. Erstens, wie macht man es stilvoll, und zweitens, wie minimiert man den körperlichen Schmerz? Die Entscheidung für den Turm der Sparrenburg ist somit nicht gedankenlos gefallen. Der Sprung geht über in einen zwar kurzen, aber dennoch berauschenden Flug. Aus dem Leben fliegen. Nicht schlecht. Danach werden die kleinen, abgerundeten und zu einem Pflaster zusammengelegten Findlingssteine ihren Job machen. Unnachgiebig hart werden sie Manfreds Körper zerschlagen, ohne ihn aus der Form zu bringen. Er wird von einer Sekunde zur anderen tot sein. Und wenn nicht, dann zumindest ohnmächtig und schmerzbefreit, falls das Herz noch eine Weile weiterschlagen will. Diese Gedanken vermitteln Zuversicht, und es bleibt die Frage auf der Strecke, wieviel Mut nötig sein wird. Er wird gleich springen und schließt schon mal die geliebte Lederjacke bis zum Hals. Und im Flug wird er, so laut es irgend geht, „Marlene“ schreien. Ja, „Marlene, ich liebe dich“. Genau dafür wird die Zeit reichen. Mehr gibt es ohnehin nicht zu sagen. Manfred Pretorius ist am Ziel. Der Turm. Er kennt ihn seit Kindertagen. Mit fünf Jahren, kurzen Beinen und Hosen ist er das erste Mal die Stufen hochgelaufen. Im Sauseschritt, wie der Großvater es beschrieb. Jetzt wird er gleich ruhig und achtsam jede Stufe nehmen.
„Montags ist der Turm geschlossen!“ Was soll dieses alberne Schild? Hier geht es um Leben beziehungsweise Tod! Durchkreuzt so eine banale Regelung nun das perfekt geplante Drama? Manfred steht fassungslos vor der schweren Holztür. Da schreibt ein sich in Pose werfender „Oberstadtdirektor“, dass der Turm geschlossen sei. Warum? Was steckt dahinter? Montags etwa keine Selbstmorde? Was denkt sich so eine Verwaltungs- kanone? Manfred stiert eine Ewigkeit auf das Schild und liest, welche Öffnungszeiten in den nächsten Tagen zur Verfügung stehen. Das sind Möglichkeiten, aber keine Alternativen. Einen Plan B hat er noch nicht. Nur ein weit geöffnetes Ventil: Manfred brüllt seinen Frust in die Landschaft. Jene bekannte braune Masse, die bei solchen Gelegenheiten meistens zitiert wird, muss auch jetzt herhalten. Sogar mehrfach.
Dann dreht er sich um. Vor ihm liegt der Hermannsweg, der in den tiefen Wald führt. Wenn nichts mehr geht, dann soll man wenigstens gehen. Laufen hilft immer. Einfach sich am Laufen halten. Die Beine bewegen, damit sie den Verstand beruhigen. Laufen, von irgendwo nach anderswo. Manfred stellt die Füße auf Automatikbetrieb ein und das Hirn so weit wie möglich ab. Einfach nur geradeaus trotten. Einem Weg folgen. Irgendwann wird der Weg schon zum eigenen. Die erste Stunde hebt Manfred den Kopf nicht ein einziges Mal. Gramgebeugt. Dann schaut er doch einmal hoch, folgt einem Stamm in dessen Krone, verweilt ein wenig in dem Astgewirr und überlegt, ob er hochklettern und von dort springen soll. Auf den Waldboden? Das kann er vergessen. Der ist zu weich. Aber der Stamm birgt eine Überraschung. Zunächst übersieht er das weiße H, den Hinweis auf den Hermannsweg über den Kamm des Teutoburger Waldes. Aber dann funkt es. Dieser Weg führt zum Hermannsdenkmal. Ein monumentaler Koloss, gewidmet einem Cherusker, der als Namensgeber und Sinnstifter teils für nationale, aber auch für demokratische Ideale herhalten musste. Genau – und dort gibt es eine Aussichtsplattform, ein Umlauf zu Füßen des Blechsoldaten. Mindestens dreißig Meter hoch. Eine ideale Selbstmörder-Absprungschanze. Jedenfalls ist das der Geistesblitz, der nun dem liebeskranken Werther-Nachfolger ein Ziel gibt, wenn auch ein weit entferntes. Mindestens fünfundzwanzig Kilometer hat er noch vor sich. Und eine dunkle Nacht, die bald dem Tageslicht den Garaus machen wird. Aber was sind das für marginale Problemchen. Hier geht es nicht um was Großes, nein, ihm geht es um das Größte. Sein Leben und ein Fanal! Das Ausscheiden aus dem Leben als maximal mögliche Strafe für, ja für wen eigentlich? Für den Vater? Vorrangig schon. Knapp dreißig Kilometer Chance, um die Sache nochmal von allen Seiten zu beleuchten.
Zwei Stunden später ist nichts mehr beleuchtet. Der Wald wird dunkler und dunkler. In gleichem Maße kommen Hunger und, noch schlimmer, Durst ins Bewusstsein und mindern die Konzentration. Eine Wetterhütte am Wegesrand ist im letzten Dämmerlicht auszumachen. Dort hinein verzieht sich Manfred. Das Hotel zur langen Dämmerung? Nicht alles hier ist schlecht. Für ihn unsichtbar, aber absolut vorausschauend und die Lokalität in ein gutes Licht rückend ist ein kleines Holzschild über dem Eingang. Goethe-Hütte steht da tatsächlich. Ein gutes Omen. Denn schon wenig später fängt es zu regnen an. Ein Holzbrett am Sims sammelt das Wasser und schickt es als festen Strahl in die offenen Hände. Durst gestillt, Hunger vergessen, bleibt nur noch die langsam in die Knochen ziehende Kälte. Dagegen muss er anzittern, zusammengekauert auf einer harten Holzbank und gegen die Wände in eine Ecke gedrückt. Der Wind hat jede Menge Laub unter die Bänke geweht. Perfektes Isolationsmaterial. Auf die Idee, sich die Blätter überall in die Jacke zu stopfen, kommt er spät, aber nicht zu spät. Irgendwann gibt es sogar eine Portion Schlaf. Und dann die Erkenntnis, dass der Tod durch Erfrieren in jedem Fall ausscheidet. Der ist einfach unangenehm, weil er quält.
Du versuchst, o Sonne vergebens Durch die düsteren Wolken zu scheinen: Der ganze Gewinn meines Lebens Ist, ihren Verlust zu beweinen.
Bei Anbruch der Morgendämmerung bewegt Manfred seine nahezu steifen Glieder. Alles tut weh. Die ersten Schritte schmerzen nicht nur gewaltig, sie vermitteln ihm das Gefühl, schon halb tot zu sein. Aber das Leben will auch in diesem Zustand gelebt werden. Eine halbe Stunde später ist ihm warm, drei Stunden später ist er am Ziel. Der Grund für das Ziel ist nach wie vor unverändert, wenngleich weniger vehement. Vorher gibt es noch Wichtigeres zu erledigen. Der Kiosk am Denkmal hat Leibniz-Kekse und Sinalco. Egal was man plant, man soll es nicht hungrig erledigen! Selbst die irrste Tat gelingt nicht ungestärkt. Die butterzarte Bahlsen-Leckerei, prickelnd aufgeschäumt von Kohlensäure mit Orangengeschmack, bringt eine satte Zufriedenheit in den Körper, gegen die man sich kaum wehren kann. Mundgefühle, die sonnige Kindertage im Zoo mit dem Großvater in Erinnerung bringen. Das Sterbenwollen wird schwerer. Oben auf dem Balkon, über ihm der tonnenschwere Hermann, der in Wirklichkeit Arminius hieß und dessen Varusschlacht überall, aber garantiert nicht hier stattfand, oben schaut jeder zunächst fasziniert ins Land. Oben bleibt auch Manfred Pretorius nicht einfach stehen und springt. Dort geht man in die Runde, schaut in die Ferne und sieht, wie schön die Welt ist. Manfred dreht etliche Runden mit langsamen Schritten. Im Kopf dreht sich alles in vielfacher Geschwindigkeit. Was ist ein Leben ohne Marlene wert? Wo ist sie? Warum hat sie ihn verlassen? Hat sie ihn überhaupt verlassen? Wurde sie entführt? Mit Sicherheit!
Die fröhlichen, geradezu übermütigen Laute einer auf den schönen Hermann zulaufenden Mädchenklasse dringen nach oben. Er hört Kichern, Rufe, das helle, kieksende Lachen einiger Schülerinnen, die sich nicht mehr um die Worte ihres Lehrers scheren. Sie haben ebenfalls ihr Ziel erreicht und wollen hinaufklettern, um wie alle seit 1875 ins Land zu schauen. Was interessieren die überfrachteten Inschriften am Fuße des Monuments, das patriotische Bürger einst mithilfe von Kaiser Wilhelm für nur neunzigtausend Taler errichten ließen? Manfred beugt sich zu ihnen hinunter, sieht die bunte Schar der quirligen Mädchenklasse, und in dem Moment weiß er – warum ausgerechnet erst dann? –, Marlene wird sich bei ihm melden! Diese plötzliche Gewissheit ändert alles. Vielleicht liegt schon eine Nachricht von ihr im Briefkasten? Oh nein, dann gerät der Brief womöglich in die falschen Hände! Das darf nicht sein. Er muss so schnell wie möglich zurück auf den Hausberg.
Ich berichte mal über meine erste Begegnung mit Emmy Schalkowski, geborene Stahlberg, der Jugendfreundin von Marlene. War ein Tipp von Herrn von Zegenhagen. Ohne heißen Brei: Die Lady traute mir nicht über den Weg. „Warum interessieren Sie sich ausgerechnet für Marlene Lendruscheit?“ Und: „Was wollen Sie da von mir?“ Das Ganze vorgetragen in einer Schnippischkeit mit Premiumzertifikat. Allerdings muss ich einräumen, dass ihr mein Äußeres für ihre bürger- lichen Kategorien eher gewöhnungsbedürftig erschienen sein musste. Vielleicht sollte ich mal wieder zum Friseur gehen. Mein Bartwuchs ist struppig, wenngleich nicht ungepflegt! Ach ja, ich trage häufig eine grüne Leinenjacke mit aufgenähten Taschen im Comandante-Design. Auch die Schiebermütze mit dem roten Stern vorne drauf hat nicht jeder. Ist alles völlig harmlose Touristenware, jedenfalls nicht militant. Brachte mir aber meinen Spitznamen ein: Fidel Gastro.
Bei Emmy Schalkowski blieb ich trotzdem hart- näckig dran. Ich spürte schon in der ersten Sekunde, dass sie mehr wusste über den Verbleib von Marlene. Nach zwei, drei Telefongesprächen – immer war sie kurz davor aufzulegen – bin ich zusammen mit Ché-Daniel und einem Blumenstrauß zu ihr gelaufen. Kinder und Hunde, die Masche ist ja bekannt. Anstatt Hund gab es bei mir Blumen. Es waren Tulpen von der Tankstelle. Die helfen ebenfalls. Dachte ich zumindest. Sie öffnete die Haustür, fand Ché-Daniel „entzückend“ und hatte keine Zeit. „Geben Sie mir Ihre Telefonnummer. Ich melde mich!“ Immerhin. Dann machte sie sich noch über meine Visitenkarte lustig. „Ronald Stiegmann vom Katholischen Bahnhof? Was soll das denn bedeuten?“ Oh Mann! Kleingedruckt steht sogar noch „Die HERFORDER Zapfstelle für ganz ausgeschlafene Trinker“ drunter, aber das fiel ihr wohl nicht auf. Genau drei Wochen ließ sich die Dame Zeit. Dann lud sie zum Tee, und es gab sogar hausgebackenen Apfelkuchen ohne Sahne. Dieses erste Interview lief exakt verkehrt herum. Sie fragte mir Löcher in den Bauch, und ich musste immer wieder aus meinem Manuskript vorlesen. Trotzdem, steter Tropfen! Ich wurde erneut eingeladen und mit dem Satz verabschiedet: „Den ersten Brief von Marlene bekam ich etwa fünfzehn Jahre nach ihrem Abtauchen. Ich suche den Brief. Kommen Sie wieder, junger Mann, dann werde ich daraus vorlesen!“
Einen Brief für Manfred von Marlene wird es nicht geben. Das ist die Vereinbarung der Väter Pretorius und Lendruscheit. Man könnte auch sagen: das Diktat des Alten Fabrikanten. Manfred weiß nichts davon und hofft. Die Tage verbringt er in seinem Zimmer, meistens im Bett. Nachmittags, wenn alles ruhig ist im Haus, schleicht er in die Küche. Manchmal auch nachts. Hunger hat er keinen, aber das Essen unterbricht die Monotonie. Lediglich vormittags verlässt er zwischen zehn und elf Uhr das Haus, läuft auf dem Bürgersteig hin und her und fängt den Postboten ab. Schon nach wenigen Tagen reicht ihm das Kopfschütteln des Postbeamten aus einiger Entfernung, und er verkriecht sich zurück in seine Höhle in der dritten Etage. Dem Sonntagsbraten bleibt er fern und überhört die Glocke sowie die mehrmaligen Rufe von Mutter und Vater aus dem Erdgeschoss. Beiden ist der Weg nach oben zu weit und Manfred der Weg nach unten eine Qual. Zwei Wochen gehen so ins Land. Dann weist Frau Pretorius dem Leben ihres Sohnes eine neue Richtung, eine sinnlose zwar, aber wer auf Berge will, muss vorher durch Täler. Es ist ein später Vormittag. Manfred kommt vom Wieder-mal-keine-Post-Kopfschütteln vor dem Haus in den Flur. Da steht sie.
„Bitte, Manfred, komm einmal herein zu mir. Ich möchte mit dir reden. Setz’ dich auf den Sessel da. Warte – hier, nimm ein Glas von dem Kirschlikör. Der tut gut, nicht wahr?“ Apathisch riecht Manfred an dem Likörkelch, dann schüttet er die Ladung hinunter, ohne sich auf den Geschmack zu konzentrieren. Er drückt das Kinn auf die Brust und fühlt die sämige Flüssigkeit in sich hinablaufen. Der Alkohol verbreitet ein leichtes Brennen im Hals, aber dann kommt doch der süße Kirschgeschmack ins Bewusstsein. Frau Pretorius hat wirklich nicht alle Tassen im Schrank, denn schon steht sie wieder mit der geöffneten Flasche neben ihrem Sohn und schenkt nach.
Jetzt behält Manfred den Eckes Edelkirsch eine Weile im Mund, schiebt ihn hin und her und schluckt ihn dann langsam in kleinen Mengen hinunter. Diese Prozedur braucht keine Worte. Mutter und Sohn in stillem Beisammensein, ohne Augenkontakt, nur in Gedanken versunken. Dann rafft sich Frau Pretorius doch auf und sagt: „Ich weiß, wie es dir geht“, nimmt die Flasche und schenkt nach.
Manfred gibt sich einen Ruck. Die angetrunkene Mutter erschrickt. „Wohin hat der Alte die Lendruscheits abgeschoben? Er steckt doch dahinter, oder?“ Bevor sie antwortet, füllt sie ihr Glas noch einmal halb voll, wie sie immer nur halbe Gläser trinkt. Das Glas ihres Sohnes gießt sie voll. „Manfred, ich weiß es nicht. Glaub mir. Wir reden kaum miteinander. Hattest du etwa ein Verhältnis mit der kleinen Lendruscheit? Habe ich mir doch gedacht. Kleines Flittchen. Aber niedlich, ja ja. Ach Gott, da kommen noch so viele…“
Manfred hört nicht weiter zu. Er läuft in die Küche, von dort in die Speisekammer, greift eine frische Flasche Eckes und geht hoch in sein Zimmer. Dort trinkt man nicht aus Gläsern, wenn man eine Flasche hat. Gegen achtzehn Uhr übernimmt Manfred Pretorius’ erster Vollrausch das Kommando. Neue Pläne, Ziele und Freunde sind im Anmarsch, der beste Beistand für die nächsten Jahre schläft bereits neben seinem Bett: die leere Flasche.
Der Klosterplatz ist Anlaufpunkt für alle, die offensichtlich aus dem System gefallen sind. Treffpunkt, Informationsbörse, Selbstbestätigungsbühne, Kontakthof und allem voran Trinksportzentrum. Dieser Platz wird für die nächsten zwei Jahre Dreh- und Angelpunkt im Leben von Manfred Pretorius sein.
Man sieht ihn nur noch selten ohne Flasche Bier in der Hand. Mittags taucht er in der Szene auf, gegen Mitternacht schläft er auf einer Parkbank ein. Taxifahrer sind vom Hause Pretorius angehalten, den Sohn einzusammeln, nach Hause zu fahren und die Fahrt der Filter- und Anlagenbau GmbH in Rechnung zu stellen. Mit kreativem Aufschlag, versteht sich. Diese Regelung hat der Alte Fabrikant diskret in Umlauf gebracht. Weniger diskret wickelt er den Besuch des Direktors von Manfreds Gymnasium ab.
Die nachfolgende Szene ist die einzige, bei welcher der Alte etwas sympathisch wirkt. Etwa fünf Wochen, nachdem Manfred nicht mehr in der Schule erschienen ist, taucht der Herr Direktor beim Alten Fabrikanten auf. Mit Termin. Aufgebracht gibt er der Empörung Ausdruck, dass seine Briefe in der Sache des Schulschwänzers Manfred Pretorius unbeantwortet geblieben sind. Wilhelm Pretorius hört sich den Sermon ruhig an und antwortet dann: „Mein Sohn hat ein Problem. Das werden Sie nicht lösen, und ich schon gleich gar nicht. Manfred braucht jetzt keine Schule, der braucht Zeit. Ich gebe sie ihm. Wenn Sie damit nicht klarkommen, melden Sie ihn einfach ab. Er wird sein Leben auch ohne Ihre Anstalt meistern, da bin ich mir sicher. Vielen Dank für Ihren Besuch.“
Wieviel mehr hätte dieser Vater für seinen Sohn tun können? Aber er tut es nicht. Weil er nicht will, nicht muss, nicht kann. Es fehlt ein Befehl. Naheliegende menschliche Reaktionsmuster scheinen ihm abhandengekommen zu sein. Wahrscheinlich vom Krieg zerschossen. Zwischen den Möglichkeiten, zu resignieren oder überheblich zu werden, gibt es für den Hauptsturmführer der Leibstandarte SS Adolf Hitler keine anderen Wege. Schon gar nicht den ins eigene Innere, in die Humanität oder ganz einfach in die Reflexion.
Wilhelm Pretorius kennt nur stark oder schwach. Und schwach bedeutet für ihn Untergang. „Schwächlinge können keine Firma leiten, Menschen Arbeit geben und sich im Dschungel des Konkurrenzkampfes behaupten.“ So denkt der Mann, und niemand kommt an ihn heran. Kein Wunder, dass solche Eltern ihre Kinder später, 1968, auf die Straßen und in den Widerstand getrieben haben. Streetfighting men, die Power to the people singen.
1960 ist Manfred achtzehn Jahre alt. Er wird erfasst und gemustert. Die Bundeswehr will wieder Soldaten, auch wenn es noch keine konkrete Front gibt, an der man sie verheizen könnte. Manfred ist zu schwach, um sich zu verweigern. Seine Fahne aus Hallertauerschem Hopfen und Herforder Malz ist nicht für einen Fahnenappell geeignet. Man wirft ihm böswillige Tauglichkeitsverweigerung vor und bestellt ihn erneut. Sein zweiter Besuch im Kreiswehrersatzamt ist noch desolater. Der junge Pretorius ist ungepflegt und orientierungslos. Der untersuchende Arzt diagnostiziert einen angehenden Alkoholiker, der wirres Zeugs redet: „Jungs, ich kämpfe für euch! Ich erschieße jeden, der uns zu nahekommt. Ich will Soldat werden! Bitte, bitte, nehmt mich auf. Ich mach mit! Ich bin dabei. Ich bin ein Killer!“ Niemand erkennt den ernsten Hintergrund seiner Worte. Er braucht Hilfe und spürt, dass ihm ein Tritt in den Arsch guttun würde. Disziplin. Einordnung. Ein geregelter Tagesablauf. Körperliche Betätigung. Gruppendynamik. Nun ja, jeder Punkt für sich genommen durchaus vernünftig und nachvollziehbar. Aber deshalb gleich Soldat werden? Geht’s nicht auch anders? Es geht! Dauert nur noch ein Weilchen: Erst kurz nach seinem zwanzigsten Geburtstag trifft Manfred seinen Retter. Kommt noch!
Zum täglichen Klosterplatzritual fügt er, ein paar Monate nach Marlenes unerklärlichem Verschwinden, ein neues hinzu, wenngleich schon viele Jahre alt. Sonntags nimmt Manfred wieder am gemeinsamen Mittagessen teil. Punkt zwölf Uhr läutet Mutter Pretorius im Flur eine Schiffsglocke. Dann erscheint der Alte Fabrikant im gedeckten Anzug mit korrekt gebundenem Windsor-Knoten, hochglanzgeputzten Schuhen, einer Wolke aus Rasierwasser und guter Laune. Seine Gattin trägt ein Kostüm und hat die Haare schön, dazu Lippenstift und etwas Rouge. Manfred erscheint wie immer – ungepflegt, häufig vor sich hin müffelnd. Die gesamte Kommunikation besteht aus einem nacheinander gemurmelten „Guten Appetit“. Manfred beobachtet den Vater aus den Augenwinkeln und hofft nach wie vor auf eine Erklärung zum Thema Lendruscheit. Der Gatte beobachtet seine Frau aus den Augenwinkeln und orakelt, wann sie sich totsaufen wird. Die Gattin beobachtet still ihren Mann und fragt sich, ob Frau Zirpins heute wohl ihre Tage hat – dann würde die Fahrt ins Büro an diesem Sonntag ausfallen und es wäre eventuell ein gemeinsamer Spaziergang drin. Vater und Mutter lassen den Sohn unbeobachtet, jedenfalls scheint es so. Das Essen ist wie jeden Sonntag vom Hotel Teutoburger Hof angeliefert worden. Frau Pretorius hat den Tisch gedeckt, die Haushälterin wird ihn am nächsten Vormittag abräumen. Nach dem Kompott fährt der Fabrikant zunächst zu Frau Zirpins und nach zwei, drei Stunden weiter ins Büro. Manfred läuft zum Klosterplatz und Frau Pretorius legt Patiencen neben einem stets halb gefüllten Glas ihres Seelentrösters.
Ist man als Gastwirt Drogenverkäufer? Mit diesem Quatsch muss ich mich immer wieder auseinandersetzen. Nervige Gäste versuchen, mir damit ein schlechtes Gewissen einzureden, ein Gespräch aufzudrängen oder einen Schnaps abzustauben. Den haue ich schon mal raus, damit sie Ruhe geben. Wenn ich auf den Blödsinn eingehe, sage ich: „In der Gastronomie werden keine Alkoholiker gezüchtet. Wir verwalten die höchstens.“ Die Trinkgewohnheiten eines abhängigen Säufers lassen sich mit dem Ablauf einer gesunden Kneipe nämlich gar nicht vereinbaren. In meinem Katholischen Bahnhof verkehrt nicht ein einziger Alkoholkranker! Dafür habe ich einen geschulten Blick. Ich sage es ständig: „Alkoholausschank dürfte nur unter Kontrolle von Fachleuten stattfinden!“ Und damit meine ich uns Wirte, damit das klar ist. Alkoholiker werden an Kiosken, bei Lidl, Aldi und Co großgezogen. Und den katholischen Brüdern Albrecht ist es scheißegal, wieviel Stoff sich ein Einzelner bei ihnen abholt. Die haben da kein Gewissen. Ich schon!
Manfred Pretorius ist soeben auf dem Klosterplatz angekommen, hat in die Runde gegrüßt und hält seine erste Flasche Bier noch vor dem Bauch an die Leder- jacke gedrückt. Ungeöffnet. Den Start der Sauferei zieht Manfred ein wenig hin, um sich zu beweisen, dass er nicht trinken muss, sondern nur trinken will. Der richtige Durst kommt sowieso erst nach der dritten Flasche. Vorher ist das Getränk eher unangenehm, weil es ihm zu bitter schmeckt. Da braucht es schon einen willensstarken Anlauf. Täglich. In diesem Moment kreuzt Ludwig Stahmer den Klosterplatz, im gleichen Alter wie Manfred und bis zur vierten Klasse sein Sitznachbar. Danach war Ludwig auf dem Altsprachlichen Gymnasium, während Manfred auf Wunsch des Vaters den mathematisch-naturwissenschaftlichen Weg einschlug. Die Jungen spielten bis zur Pubertät viel miteinander, dann gingen die Interessen auseinander und sie trafen sich seltener. „Hey, Werther, altes Haus, was läuft denn bei dir so?“ „Nichts Besonderes. Bin in einer Konsolidierungsphase.“ „Hä?“ „Na, eben bisschen abhängen und so. Und du? Machste noch Musik?“ „Klar! Ralf und Michael sind auch in Münster an der Uni, weil wir weiterspielen wollen. Wir haben jetzt sogar eine Sängerin in der Band. Die Sigrid Gehrels. Kennste die noch? Wohnte in unserer Gegend, ist ein bisschen jünger als wir. Studiert auch in Münster, Lehramt. Nur Peter Potthoff, unser Schlagzeuger, ist in Marburg. Macht Medizin. Soll da leichter sein. Ja Alter, falls du einen fürs Rührwerk kennst – immer her damit!“ „Warum nehmt ihr nicht mich?“ „Du spielst Schlagzeug? Seit wann?“ „Schon ewig!“ „Das ist ja super. Mensch, Werther, wusste ich gar nicht. Spiel doch mal bei uns vor. In zwei Wochen gibt’s Semesterferien, da sind alle in der Stadt. Wir üben bei Michael im Keller.“ „Klingt gut. Ich komme vorbei, versprochen!“ Manfred schaut Ludwig noch kurz hinterher, dann verschenkt er seine Flasche und geht zur Haltestelle.
Der Bus hält fast direkt vorm Filter- und Anlagenbau Pretorius. Im Sekretariat grinst er Frau Zirpins wissend an und sagt: „Ist er drin?“ Die Geliebte des Vaters wird rot, sagt irgendwas, und der Sohn öffnet die schwere Tür. „Oh, seltener Besuch!“ „Ich möchte Schlagzeug lernen, was dagegen?“ „Ah, interessant. Warum kaufst du nicht einfach ein paar Trommeln? Geh zu Firma Sprenz. Sag, die sollen auf die Rechnung irgendetwas Absetzbares schreiben. Die wissen schon, wie das läuft.“ „Danke!“ Manfred dreht sich um und realisiert, dass er soeben zum ersten Mal seit zwei Jahren seinem Vater in die Augen geschaut hat. Der Sohn schließt die Tür und der Alte Fabrikant lässt sich in seinen Schreibtischstuhl fallen. „Na bitte“, sagt er und genehmigt sich zur Feier des Tages einen Cognac, in den er die fette Zigarre eintaucht, bevor er sie anschneidet und genussvoll in Brand setzt.
Das Schlagzeug-Set wird nachmittags geliefert. Zeit genug, um vorher noch eine neue Wildlederjacke anzuprobieren und zurücklegen zu lassen. Dann inspiziert er die Kellerräume der Villa Pretorius. Der Raum vor dem Heizungskeller ist warm und trocken, wenngleich es nach Heizöl riecht und in unaufgeräumten Regalen all die Sachen vor sich hingammeln, die man zunächst aufbewahrt, um sie dann Jahre später wegzuschmeißen. Auf die Frage: „Haben wir einen alten Teppich?“ sagt Mutter Pretorius: „Alle unsere Teppiche sind alt. Und wertvoll!“ Nach kurzer Diskussion rollt Manfred drei pakistanische Buchara-Läufer aus dem Gästezimmer zusammen und verlegt sie nebeneinander im Keller. Der Plattenspieler aus der dritten Etage gesellt sich ebenfalls dazu und wird in das hölzerne Radio des verstorbenen Großvaters gestöpselt.
Am ersten Tag übt Manfred fünf Stunden, dann ist ein Finger blutig. Sein Drum Kit besteht aus einer Bass Drum mit Fußmaschine, einer Snare, einer Hi-Hat, einem Crashbecken sowie einer Stand-Tom. Auf dem Fell der großen Trommel steht vorne Ludwig, ein sehr gutes Omen. Am nächsten Tag hat der Drummer Boy Muskelkater und Pflaster um die Finger. Trotzdem übt er mit Unterbrechungen fast acht Stunden. Gegen den neuen Krach im Haus trinkt Frau Pretorius mit erhöhter Schlagzahl an. Manfred bleibt abstinent und senkt damit den Ausstoß seiner Stammbrauerei. Die unsichtbaren Schwielen in seiner Leber wechseln nun zu sichtbaren in den Händen. Nach zwei Wochen könnte er bei Buddy Holly, Chuck Berry, Elvis Presley, Fats Domino oder den Searchers einsteigen. Ihre Stücke begleitet er originalgetreu. Zehn Jahre später wird so ein Wunder unmöglich sein, weil Drummer wie Keith Moon oder Ginger Baker die Standards um ein Vielfaches nach oben trommeln.
Herr Abel, Gärtner bei Pretorius, transportiert Manfreds Schlagzeug in seinem Goliath Kombi – „Aus dem Hause Borgward!“, wie er gerne bemerkt – zur ersten Probe mit der Band. Ralf nörgelt: „Was hast du denn für ’n Timing drauf?“, kann es aber nicht weiter begründen. Die anderen sind begeistert. Die chromblitzende Krachmaschine macht Eindruck. Manfred gehört ab sofort dazu. „Wie heißen wir denn?“, will er vernünftigerweise noch wissen. „Ach du Scheiße!“, durchfährt es Ludwig. „Solange Peter Potthoff dabei war, nannten wir uns Pott Hope. Und jetzt?“ Nach einer Stunde Musik brechen nun zwei Stunden Brainstorming an. „Der Name einer Band ist die halbe Miete!“, weiß Michael. Alle erkennen den Ernst der Lage. Sigrid will was Provokantes, Ralf was Kompetentes, Michael was Logo-fähiges und Ludwig was Lustiges. Tausend Namen schwirren durch den Keller. Der neue Schlagzeuger hält sich zurück, bis Ludwig ruft: „Ey, Werther, schläfst du schon?“ „Genau, sag auch mal was! Streng dich gefälligst an!“ Typisch Ralf. „Jaaa…“, dehnt Manfred, und die Spannung wächst. „Wie wär ’s denn mit Sigrid Service?“ „Secret Service? Nicht schlecht!“ Es dauert, bis alle kapieren, aber dann gibt’s Gejohle. Manfred Pretorius ist der neue Drummer von Sigrid Service. Und endlich wieder ein wenig ausgeglichen.
In Biermanns Weinstube feiert sich die Gruppe am Abend selber. Karrierepläne werden geschmiedet, das Repertoire diskutiert und Auftrittsorte auf die Wunschliste gesetzt. Biermanns Weinstube liegt direkt am Klosterplatz. Für Manfred unangenehm. Er spürt die Nähe zum Zentrum seines Desasters. So fällt es ihm nicht schwer, den Stillen zu geben und bei Cola zu bleiben. „Trinkst du nix?“, will Ralf irgendwann wissen. „Doch, klar, sowieso. Aber ich hatte eine Grippe. Antibiotika. Kein Alkohol. Jedenfalls im Moment. Verstehst du?“ Dann winkt er schnell der Bedienung. „Noch ’ne Runde auf mich.“ Sigrid ist als Erste beschwingt. Sie umarmt alle, nennt sie „meine Boys“ und sieht einfach rattenscharf aus. Gott sei Dank hat sie keine Starallüren. Wäre mit ihrem Stimmchen auch etwas übertrieben. Sie ist aber die Mutter der Kompanie und damit ein Halt für alle. Besonders für den Drummer. Die nächsten Tage üben sie voller Enthusiasmus und werden besser. Fast schon gut. Bis das Soundproblem Thema wird. „Werther, Mann, du trommelst mir die Trommelfelle kaputt: Kannst du nicht leiser spielen?“ „Kannst du die Gitarre nicht lauter drehen?“ Nee, geht nicht. Nicht mit den mickrigen Boxen. Träume von Amps, also Gitarrenverstärkern, Bass-Boxen und Gesangsmikrofonen geistern durch die Köpfe. Eine Gesangsanlage wäre die Krönung. Bis auf Manfred wissen alle, wie es geht – wie es gehen könnte. Das Wort vom Lottogewinn macht die Runde, dann übernehmen die studentischen Budgets wieder die Macht in der Realität.
Der nächste Sonntag mit Hirschragout, Rotkohl, Klößen und einer Extraladung Soße, die der Vater Tunke nennt, startet pünktlich um zwölf. Der Junior erscheint frisch gewaschen, rasiert, präpariert und in seiner neuen Wildlederjacke. Er erzählt von seiner tollen Band und beschreibt in korrekter Wiedergabe die technischen Defizite. Beim Alten Fabrikanten verfängt sich das Wort „Anlage“ und bleibt hängen. „Wenn eine Anlage fehlt, dann muss man sie beschaffen, oder?“ „Meine Meinung!“ „Ich denke drüber nach.“ Jetzt bloß keine Zeit verlieren mit Diskussionen, für die ihm Lust und Verständnis fehlen. Frau Zirpins wartet, will genommen werden und dann ihr Rhabarber-Baiser auftischen. Das Baiser ist gekaufte Konditorware. Die kleinen Mitbringsel des Chefs kommen häufig vom Juwelier. Nur der Körpereinsatz im Bett ist noch beste Hand- arbeit. (Den Begriff „mundgeblasen“ verbietet der Verleger.)
Ein paar Tage später findet Manfred einen Brief seines Vaters auf dem Vestibül im Flur:
Manfred, besorge einen Kostenvoranschlag für Anlagen und Geräte, die nötig sind. Ich werde dann nachverhandeln.
Die Rechnung muss durch die Buchhaltung!
Also richtig getextet! Zwei Bedingungen:
1. Alles bleibt unser Eigentum!
2. Ich dulde keine Auftritte deiner Hottentotten- Band im Umkreis von 30 km rund um die Firma!
Du hast unserem Ruf bereits genug geschadet.
Vater
Manfred ist niedergeschlagen. Die anderen Mitglieder von Sigrid Service rasten aus, können das Glück nicht fassen. „Ist doch super, Werther, dann spielen wir eben in Münster. Mit dem richtigen Equipment rollen wir dort die Szene auf.“ „Und ich?“ „Mann, Werther, komm doch mit nach Münster!“ „Und was soll ich da außer trommeln?“ „Zum Beispiel studieren.“ „Ohne Abi?“ „Kannste doch nachmachen. Abendschule und so.“
Parry Sound, 15th October 1975
Liebe Emmy, ich traue mich endlich,
dir zu schreiben. Sorry, sorry.
Hoffentlich erreicht dich dieser Brief an
die Adresse deiner Eltern.
Falls nicht, ist es besser, wenn ich nicht zu viel erzähle. Kann ich dich irgendwo anrufen?
Schreibe mir doch bitte deine Telefonnummer, dann melde ich mich bei dir.
Ich denke oft an Dich!
Liebe Grüße
Dein Marlenchen
P.S.: Nicht mehr Lendruscheit. Gott sei Dank!
Dieses Mal gab es bei Emmy Schalkowski Sahne zum Apfelkuchen. Hatte ich mitgebracht. Und Ché-Daniel. Es war mein Nachmittag mit ihm und ich wollte nicht absagen. Hanna nutzt sowas nur aus und ich bin dann wieder der Unzuverlässige. Außerdem war der Kleine für die Stimmung eine Bereicherung. Frau Schalkowski kramte altes Spielzeug raus und war voll im Enkelmodus. Dann zeigte sie mir den ersten Brief von Marlene, von dem ich mir mehr versprochen hatte. Ich fragte: „Parry Sound? Wo liegt das denn?“ Ah, in Kanada. Nicht schlecht. Natürlich war ich pfiffig genug, mir ihren neuen Nachnamen zu merken. War oben rechts eingedruckt. Ich versuchte sogar, die angegebene Telefonnummer zu behalten. „Und, hat Marlene sie angerufen?“, wollte ich natürlich wissen. „Wir telefonieren seither einmal im Monat. Immer lange, falls Sie das interessiert.“ Mich interessierte alles, und es sprudelte endlich aus Tante Emmy – so sollte Ché-Daniel sie nennen – heraus. Es hätte gleich bei diesem Treffen Stoff für ein halbes Buch geben können, aber irgendwann kackte mein Sohn bei Tante Emmy auf den Teppich. Ich Dussel hatte ihm die Windel abgenommen, weil ich glaubte, es sei zu warm im Zimmer. Zum Glück hat er sich vorher die Hose runtergezogen.
Die Reinigungsaktion fraß leider viel Zeit. Als der Teppich endlich mehrfach chemisch gereinigt war, musste ich los. Die Plauderlaune war ohnehin verrauscht. Oder eben abgekackt. Wir verabredeten uns neu und ich versprach, beim nächsten Besuch nur noch Sahne mitzubringen.
Die Taxe ist für sechs Uhr bestellt. Familie Lendruscheit steht bereits um viertel vor sechs mit Koffern und Handgepäck vor dem Haus. Schweigend. Bei den Damen rinnen ein paar Tränen lautlos über die Wangen. Marlene kennt das Ziel der Reise nicht. Frau Lendruscheit ist ein wenig eingeweiht. Sie muss sich mit „Wir wandern aus!“ zufriedengeben. Weitere Nachfragen führen zu aggressiven Reaktionen. „Hättest du auf das Mädel aufgepasst, wären deine Fragen überflüssig!“ In Sekunden wird der Kopf von Alfons rot, und Rot bedeutet nun mal Stopp! Marlene ist der Auslöser für alles Übel und daher eine Gefangene der Situation. Sie verkriecht sich in ihr Inneres, wo sie nicht mehr allein ist. Sie beginnt mit dem ungeborenen Kind zu reden und tröstet sich, indem sie Trost und Zuversicht spendet. „Manfred und ich werden dich beschützen!“ So macht sie sich und dem unbekannten, geliebten Menschen Mut. Denn daran zweifelt sie nicht: Dieses Kind ist ein Kind der Liebe!
Am frühen Abend endet die Reise in der Fränkischen Schweiz. Dort sind sie nach einigem Umsteigen und stumpfem Warten auf undefinierbar riechenden Bahnsteigen im Zweiter Klasse-Abteil der Bummelzüge angekommen. Ein roter Triebwagen bringt sie von Nürnberg über Erlangen nach Forchheim. Die letzten Kilometer übernimmt ein Postbus den Transport. Das Dorf scheint keinen Namen zu haben. Nur ein paar Bauernhäuser und einen Landgasthof an der Regnitz. Im Blauen Karpfen ist ein Neffe von Vater Lendruscheit Hausbursche. Das schönste, größte und im Grunde einzige Zimmer hat vier Betten, einen Schrank, einen Waschtisch und – ganz neu – ein eigenes Wasch- becken. Dazu vier Nachttische neben den Betten. Schon am zweiten Tag kommen drei Stühle hinzu. Die Fenster über Eck geben den Blick frei auf den kleinen, aufgestauten Fluss, der früher ein schweres Wasserrad in Gang bringen musste, damit man Korn mahlen konnte. Zur anderen Seite sieht man die Straße und den kleinen Parkplatz. Am Horizont steigt ein Gebirge auf, das den lächerlichen Vergleich mit der Schweiz begründet. Wer nie dort war, gibt sich vielleicht damit zufrieden.
Marlene hat kategorisch Stubenarrest und verlässt das Zimmer nur in Begleitung der Eltern oder um zur Toilette zu gehen. Einmal pro Woche darf geduscht werden, wofür der Wirt pro Person eins fünfzig abrechnet. Die Übernachtung kostet zwanzig Mark und enthält ein armseliges Frühstück. Für jeden zwei Semmeln, einen Klacks Butter, Marmelade im Überfluss und für die Eltern je ein Kännchen Kaffee. Marlene trinkt Hagebuttentee. Nachdem die Mutter einkaufen war, isst man mittags Landbrot mit Lyoner Wurst, dazu für jeden eine saure Gurke. Die geliehene Thermoskanne hat heißes Wasser aus der Wirtshaus-Küche, mit dem man Caro-Kaffee