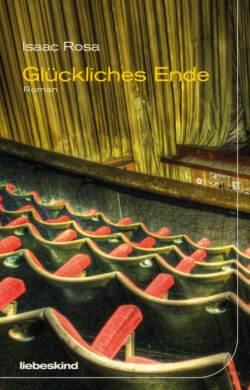Читать книгу Glückliches Ende - Isaac Rosa - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8
ОглавлениеGehen wir nicht ganz so weit zurück, noch nicht. Wenn wir mit unserer Ausgrabung beginnen, taucht direkt unter der obersten Erdschicht der Abend auf, der am Anfang dieser beiden Wochen stand: der Abend, an dem ich dir gesagt habe, dass ich mich trennen möchte. Da hast du uns: Wir sitzen bei einem Hochzeitsbankett, an dem Tisch, den Fabio die Schiffbrüchigen nannte. Unser heldenhaftes Pärchen hier hat ein Abendessen gewonnen, sagte Fabio, er stand hinter uns, eine Hand auf deiner, eine auf meiner Schulter, in der Stimme schon die erste Trunkenheit, und nachdem er uns beide schallend auf den Mund geküsst hatte, klärte er uns auf: Erinnert ihr euch noch an dieses Abendessen, um das wir vor Jahren mal gewettet haben? Ihr seid die Gewinner, Antonio und Ángela, Ángela und Antonio, Angelonio, ihr seid die Überlebenden, die Einzigen, die nicht über Bord gegangen sind, seht euch die anderen an, wie sie sich sonnenverbrannt an eine Holzplanke klammern. Fabio zählte die elf Tischgenossen auf: zwei, die nach der Trennung Single geblieben waren, drei in Begleitung ihrer neuen Partner oder Partnerinnen, Fabio selbst, frisch geschieden von Néstor, außerdem der Bräutigam, der, ebenfalls getrennt, nun ein weiteres Mal heiratete, und du und ich als einziges überlebendes Paar jenes Jahre zurückliegenden Treffens. Ich habe dich flüsternd gefragt, ob wir lieber gehen sollen, du hast deinen verkrampften Mund zu einem unwahrscheinlich süßen Lächeln verzogen und gesagt, auf keinen Fall: Wir bleiben, Schatz, wir wollten uns doch amüsieren. Fabios Bemerkung löste an unserem Tisch ein Gespräch über den Familienstand aus, ein Wirrwarr von Stimmen, bei dem ich nicht mehr weiß, wer was gesagt hat: In der Klasse meiner Tochter sind wir geschiedenen Eltern in der Mehrzahl. Es gibt nur deswegen nicht noch mehr Trennungen, weil sich das nicht jeder leisten kann. Schuld an dem Ganzen ist die gestiegene Lebenserwartung, wenn man noch so viel Leben vor sich hat, bleibt man nicht ewig mit derselben Person zusammen. Man wechselt tausendmal den Job, die Wohnung, den Telefonanbieter, die Frisur, und wenn es schon sonst nichts Dauerhaftes mehr gibt im Leben, warum dann ausgerechnet die Liebe. Da hast du dich eingeklinkt, offensichtlich hattest du Lust, diese frivole Unterhaltung auf ein anderes Niveau zu heben: Genau deshalb, weil nichts mehr dauerhaft ist in unserem Leben, brauchen wir etwas Beständiges, das uns Halt gibt, etwas, das dem Auseinanderdriften widersteht. Doch als Reaktion kamen nur scherzhafte Buhrufe, Romantikerin, Romantikerin, riefen sie, und es regnete Brotkrumen. Ein Hoch auf die widerstandsfähige Liebe!, brüllte Fabio mit erhobenem Glas, der ganze Saal prostete mit, und dann wandte er sich frech an dich: Angelita, Angelita, ich kann es nicht fassen, du bist ja immer noch dieses naive Mädchen, das an die transformative Kraft der Liebe glaubt, wie war noch mal dein schöner Spruch, die Liebe als absolute Hingabe, sich lieben ohne jede Berechnung …? Ángela hat recht, kam dir einer der Singles zu Hilfe, der vor ein paar Monaten von seiner Frau verlassen worden war: Ángela hat recht, wir nennen das Liebe, was nichts weiter ist als Begehren, eine andere Form des Konsums. Aber Liebe ohne Begehren ist unmöglich. Ich meine etwas anderes, Liebe ist das Gegenteil dieses Begehrens, das uns immer unbefriedigt zurücklässt, das Begehren will verschwenden und ersetzen, während Liebe bewahren will, erschaffen, sich vervielfältigen, irgendwo habe ich mal gelesen, dass die Liebe zentrifugal ist, während das Begehren zentripetal ist, also nach innen strebt. Die Liebe hält nur drei Jahre. Waren es nicht sieben? Ein Hoch auf die zentrifugale Liebe!, schlug Fabio vor, was Gelächter an den Nebentischen auslöste. Wir leben in einem Markt der Liebesangebote, und jeder Markt bringt Ungleichheit, Arme und Reiche hervor. Ich hör’s schon, gleich gibst du dem Kapitalismus die Schuld, wie immer. Wenn jemand sich trennt, sagen wir, er ist wieder zu haben, wir gehen auf den Markt und suchen uns eine neue Liebe wie jemand, der eine dieser blöden Wonderboxes kauft, neue Erfahrungen, Badespaß, Paragliding. Hey, hey, wir haben dem Brautpaar auch so eine blöde Box geschenkt. Besser hätten wir den beiden ihre zukünftige Scheidung geschenkt, ich habe da von einer Firma gehört, die einen kompletten Trennungsservice anbietet, sie kümmern sich um alles: Anwälte, Therapie, Hilfe mit den Kindern, Coaching, damit man wieder auf die Beine kommt; ich kann mir kein besseres Hochzeitsgeschenk vorstellen. Womit wir wieder beim Thema wären, manche Leute trennen sich deshalb nicht, weil sie es sich nicht leisten können. Der strahlende Sieger ist heute der Single, die Welt ist für Singles gemacht, für den freien Menschen ohne Bindungen, der bei jeder Gelegenheit sein Leben ändern kann, ohne sich darum zu kümmern, wie viele Leichen seinen Weg pflastern. Es leben die Singles!, brüllte, allmählich etwas penetrant, Fabio, was nur noch von einem fröhlichen Tisch hinten im Saal beantwortet wurde. Hör mal, einige von uns sind geschiedene Eltern, und ich lasse mir nicht sagen, dass Leichen meinen Weg pflastern, ich liebe meinen Sohn über alles, und ich habe mich genau deshalb für die Scheidung entschieden, damit er glücklich wird. Du wolltest selber glücklich sein, darum geht’s. Okay, ich nehm’s dir nicht übel, du bist betrunken. Eine gute Scheidung ist für Kinder besser als eine schlechte Ehe. Das war dein Stichwort, und du sagtest, zunehmend gereizt: Das ist ein beschissener Satz, mit dem wir uns trösten und entlasten, wir reden uns ein, wir tun es für sie, während wir doch nur unser eigenes Glück suchen, wir sind nicht bereit, bestimmte Dinge auszuhalten und uns mit weniger zufriedenzugeben, um unseren Kindern eine traumatische Erfahrung zu ersparen. Red keinen Quatsch, Ángela, genau das haben Frauen jahrhundertelang gemacht, aushalten und sich zufriedengeben. Sie hat doch recht, für manche Leute ist das Kinderkriegen eine weitere Form des Konsums, eine weitere Wonderbox. Hör doch auf mit deinen blöden Boxen. Du sprachst weiter und sahst mich dabei fest an: Eine Scheidung kann für Kinder verheerend sein, vor allem für kleinere, würden wir uns den Schaden, den sie davontragen, besser bewusst machen, dann würden wir uns nicht so leichtfertig scheiden lassen, sondern mehr dafür tun, um die Beziehung zu retten, und unsere Anforderungen an den Partner ein wenig herunterschrauben. Ich glaube, du übertreibst, Ángela, es gibt doch so viele Trennungskinder, einige von uns sind sogar selber welche, und ich glaube nicht, dass das so verheerend war. Mir kommt dieser Gedanke des Aushaltens sehr rückständig vor, meine Mutter hat jahrelang alles Mögliche ausgehalten, und ich kann dir versichern, meinen Geschwistern und mir wäre eine Scheidung zur rechten Zeit lieber gewesen. Ich hab es satt, ich will mit niemandem mehr zusammen sein, solange ich lebe. Wieso, das kann sich doch heute Abend noch ändern, ich sehe den Mann deiner Träume. Ich scheiß auf den Mann meiner Träume, ich scheiß auf diese blöde romantische Liebe, mein ganzes Leben lang habe ich falsche Entscheidungen getroffen, mich immer nur in die kleine Zweierbeziehungsliebe zurückgezogen und die vernachlässigt, die mich wirklich geliebt haben. Ich scheiß auf die romantische Liebe!, brüllte Fabio, und diesmal wurde er ausgepfiffen. Mein Leben besteht aus unverbundenen Teilen, ich muss mich ständig neu erfinden, wie soll ich denn immer denselben Menschen lieben, wenn sich doch alles ändert, wenn ich selbst mich ändere? Genau deshalb, sagtest du beharrlich, über das Geschrei hinweg: Genau deshalb, weil alles so unsicher, so kurzfristig ist; aber wir haben aus der Liebe, und ich meine jetzt nicht nur die Liebe für den Partner, sondern auch die für die Kinder oder die pflegebedürftigen Eltern, wir haben aus ihr einen Klotz am Bein gemacht, und gleichzeitig verlangt man von uns, schnell, agil, kühn und unbarmherzig zu sein, also müssen wir uns von allem lösen, damit wir schneller rennen können. Das seh ich anders, Ángela, was schlägst du denn vor, etwa dass wir zur patriarchalischen Familie zurückkehren? Ich dachte, davon befreien wir uns gerade, wir leben doch die Liebesbeziehungen heute freier. Es lebe die freie Liebe!, Fabio war außer Rand und Band, unerträglich, der Wirt bat ihn, leiser zu sein, und du wurdest lauter: Am Ende geht es immer um die Freiheit, aber was ist das für eine Freiheit, mit dieser beschissenen Freiheit ziehen sie uns doch nur den Boden unter den Füßen weg, ich hab die Schnauze voll von dieser ganzen Freiheit, der Freiheit, die Schule zu wählen, der Freiheit, den Arzt zu wählen, der Freiheit, die Karriere zu wählen, die Arbeitsstelle, die Zukunft, der Freiheit, seine Arbeitsbedingungen direkt mit dem Arbeitgeber auszuhandeln, der Freiheit bei den Arbeitszeiten, der Freiheit zu streiken oder zu arbeiten, wenn andere streiken, der Freiheit, sich zusammenzutun und wieder zu trennen, der Freiheit, Kinder in die Welt zu setzen und mit ihnen zu machen, was man will; eine Scheiße ist das: Diese ganzen Freiheiten können nur Menschen genießen, die sich eine gute Schule leisten können, eine vernünftige Krankenversicherung, ein Auslandsstudium, unbezahlte Praktika, die ihre Familie mit einem einzigen Gehalt ernähren können, für die jemand putzt und sich um die Alten und die Kinder kümmert, die eine Geliebte haben, die sich scheiden lassen können, und wir, die wir uns so viel Freiheit nicht leisten können, sind die Gelackmeierten, wir konsumieren unsere Freiheit in Form schlecht ausgestatteter Schulen, überfüllter Krankenhäuser, einer verarmten Arbeiterschicht und kaputter Familien, die Kinder werden von morgens bis abends in der Schule abgestellt, und dann diese ganze Liebe, die keine freie Liebe ist, sondern eine liberalisierte Liebe, leckt mich doch alle mit eurer Scheißfreiheit! Am Ende hast du laut gebrüllt, der ganze Saal hat zugehört, die umliegenden Tische schon seit du lauter geworden warst. Unsere Freunde schwiegen unbehaglich, sogar Fabio. Du bist aufgestanden und leichten Schrittes verschwunden, und als ich dich suchte, fand ich dich nirgends. Ich suchte an dem Teich vor dem Restaurant, war mir sicher, dass ich dich dort am Ufer sitzend finden würde, die verweinten Augen aufs Wasser gerichtet, was man nach so einem bühnenreifen Abgang eben erwartet, aber da warst du nicht, und dann war ich es, der die melancholische Pose am Ufer einnahm, bis mir eisig kalt wurde. Als ich in den Saal zurückkam, wo inzwischen Musik spielte, warst du wieder da: Du tanztest mit den anderen, mitten auf der Tanzfläche, warst Teil der Choreografie, du lachtest, und das zuckende Licht und der Alkohol in meinem Blut brachten dich irgendwie zum Flackern, verlangsamt, verschoben, eine Abfolge lächelnder Ángelas, mit offenen Augen, mit geschlossenen Augen, mit gespitzten Lippen, mitsummend, dir auf die Unterlippe beißend, mit herausgestreckter Zunge, mit eingefrorenem Lachen.
Kurz vor der Diskussion hattest du es mir mitgeteilt. Unsere Gruppe von elf Freunden hatte sich nach dem Aperitif am Teich gerade zum Abendessen gesetzt. Wir redeten über alles Mögliche: über Kinder, Fernsehserien, Abschiede, Eltern mit Metastasen, die Lage in Katalonien, darüber, was wir seit unserem letzten Treffen gemacht hatten, was es Neues gab bei Natalia und Jaime, die sich gerade getrennt hatten. Ich beteiligte mich an den Gesprächen, du bliebst still, sahst aber zu, mit der intensiven Aufmerksamkeit des Geistesabwesenden. Da nahmst du unter dem Tisch meine Hand, ich hielt es zuerst für eine zärtliche Geste. Dann merkte ich, dass dein Finger Buchstaben auf meine Handfläche malte, und stell dir vor, in welch glückseliger Ahnungslosigkeit ich lebte, ich war ganz erfreut: Du hattest mir schon ewig keine solchen Botschaften geschickt, in unserem alten Hand-Morsecode. Ich habe dich angelächelt, als ich das Kitzeln deiner Fingerkuppe spürte, und dann den Kopf abgewandt, damit es so aussah, als folgte ich weiter dem Tischgespräch. Mir fiel nicht schwer, die Buchstaben zu erkennen, die Striche, die dein Fingernagel auf meiner Handfläche zog: I, C, H, dann ein waagrechter Balken als Leerzeichen. W, I, L, L. Balken. D – »dich«?, dachte ich. Aber es ging weiter mit A, S, S und noch einem Balken, dann kam ein W, I, R, Balken. Da konnte ich noch annehmen, dass du müde wärst, gelangweilt, ich sah schon die ganze Hochzeitsfeier über, dass du keine Lust hattest, also erriet ich: ICH WILL DASS WIR GEHEN, was du vor unseren Freunden nicht einmal zu flüstern gewagt hättest, lieber sollte ich die Spielverderberin sein und unseren Aufbruch bekannt geben. Da schriebst du weiter: U, N, S, Balken, T, R, E, N, N, E, N. Und ein Klopfen mit dem Zeigefinger: Punkt. Meine Hand verkrampfte sich derart, dass es mir durch den Arm bis in den Nacken schoss. Ich sah dich an, setzte eine fassungslose Miene auf, aber du wandtest dich mit irgendeiner Frage an Fabio, ohne auf meine wortlose Bitte um eine Erklärung einzugehen. Okay, dachte ich, nahm deine Hand und ließ mich auf dein Spiel ein, kratzte Buchstaben für Buchstaben auf deine Tafel, hastig: W, A, S, Leerzeichen, S, O, L, L, Leerzeichen, D, A, S, dahinter ein rasch hingekritzeltes Fragezeichen. Ohne mich anzusehen, antwortetest du auf demselben Weg, und einige Minuten lang setzten wir das Gespräch unter dem Tisch fort, die Handflächen gerötet. Du: I, C, H, Leerzeichen, K, A, N, N, Leerzeichen, N, I, C, H, T, Leerzeichen, M, E, H, R. Ich: I, C, H, Leerzeichen, V, E, R, S, T, E, H, E, Leerzeichen, D, I, C, H, Leerzeichen, N, I, C, H, T. Du: I, C, H, Leerzeichen, B, I, N, Leerzeichen, A, M, Leerzeichen, E, N, D, E, Leerzeichen, W, I, R, Leerzeichen, S, I, N, D, Leerzeichen, A, M, Leerzeichen, E, N, D, E. Ich schrieb inzwischen überhastet, ließ Leerzeichen und Buchstaben aus: W, A, S, ?, I, C, H, D, A, C, H, T, D, I, R, G, I, N, G, E, S, G, U, T. Du hingegen seelenruhig und ganz sauber, um Missverständnisse zu vermeiden: W, I, R, Leerzeichen, S, I, N, D, Leerzeichen, L, Ä, N, G, S, T, Leerzeichen, I, N, Leerzeichen, D, E, R, Leerzeichen, N, A, C, H, S, P, I, E, L, Z, E, I, T. Und brachtest noch die Engelsgeduld auf, Buchstaben für Buchstaben, wie um mich einer chinesischen Wasserfolter zu unterziehen: N, U, R, Leerzeichen, N, O, C, H, Leerzeichen, G, A, R, B, A, G, E, Leerzeichen, T, I, M, E. Da hatte ich keinen Nerv mehr, Telegramme zu verfassen, ich beugte mich zu deinem Ohr, und mein Flüstern war fast ein Schrei: Was redest du da für Blödsinn, was für garbage time? Und du, eine Hand vor dem Mund, fast unhörbar in dem allgemeinen Stimmengewirr: Es ist aus, Ángela, einer von uns beiden musste diesen Schritt endlich tun. Ach, dann muss ich mich wohl bei dir bedanken, sagte ich laut, als Fabio aufstand und zwischen uns trat, eine Hand auf deine, eine auf meine Schulter legte, und du rauntest mit einem widerlich verkniffenen Lächeln: Nein, schon gut, mach’s nur nicht noch schwerer.
Ja, so habe ich es dir mitgeteilt, völlig unpassend, während eines Hochzeitsessens mit Freunden und über unseren alten Handtelegrafen, wahrscheinlich mutiger oder forscher, weil ich so viel getrunken hatte. Und ungeduldig, so ungeduldig, dass ich es dir beinahe schon in Worten gesagt hätte, als du mich zuvor beim Cocktail fragtest, was mit mir los wäre, warum ich so still sei. Oder sogar noch früher, als wir aus dem Standesamt kamen, die verschwitzten Hände voller Reis, und uns über die Treppe hinweg ansahen und du dich wundertest, weil ich dich so aufmerksam und ernst betrachtete. Derselbe ernste Blick war dir bereits im U-Bahn-Fenster aufgefallen, als wir zum Standesamt fuhren und du meine Hand drücktest und deinen Kopf auf meine Schulter legtest, ohne unser Spiegelbild im Fenster aus den Augen zu lassen, wir beide in Grau, gut aussehend und müde, irgendwie trüb, und da musste ich mich wirklich zusammenreißen, um es dir nicht zu sagen, denn die Worte lagen schon schwer in meinem Mund, aber es sollte nicht so aussehen, als wäre mein Entschluss eine Folge des routinemäßigen Streits, den wir beim Weggehen gehabt hatten. Deshalb habe ich gewartet, bis unsere schlechte Laune verflogen war, bevor ich ein Thema aufbrachte, das ich bereits am Morgen hätte anschneiden können, als wir aufwachten und du dich an mich schmiegtest, mit dieser Samstagsträgheit, dein Körper warm und kraftlos, so verletzlich. Du hast deine Stirn gegen meine gedrückt, das alte Zyklopenspiel, und mir gesagt, dass du mich liebst, mich jeden Tag noch mehr liebst, hast mich ohne Eile geküsst, und ich hatte Angst, du würdest den schalen Geschmack der Worte spüren, auf denen ich schon zu viele Tage und Nächte herumkaute, die ich hinunterschluckte und wieder hochwürgte, ohne den richtigen Augenblick zu finden, um sie zu äußern; die Worte, die ich schon mehrmals ins Handy getippt hatte, ohne am Ende den Mut zu haben, sie dir zu schicken: Ich will, dass wir uns trennen. Vor Tagen schon hatte ich diesen Entschluss gefasst. Wir setzten uns jeden Abend, wenn die Kinder ins Bett gebracht waren, ins Wohnzimmer, und du spieltest Haus-Umbauen: Das Notebook auf dem Schoß, gingst du auf die Suche nach preiswerten Heizsystemen, Herstellern für Zementfliesen, Elektroinstallateuren, Katalogen für Bäder, Lösungen für schadhafte Dächer, den Preisen für Heizkessel, für Küchenarbeitsflächen; und parallel dazu in unser Online-Konto, um Saldo und Umsätze zu prüfen und anschließend auf dem Taschenrechner die übliche Milchmädchenrechnung anzustellen; dann wurde Paint gestartet, um den Plan für das Haus abzuändern: eine Wand weggenommen, eine neue Tür eingefügt, das Wohnzimmer erweitert, das Badezimmer anders ausgerichtet. Alles begleitet von Kommentaren, und ich sollte mir das geometrische Muster von Kacheln anschauen oder sagen, wie ich es fände, wenn wir den Flur ganz wegmachten oder das Obergeschoss absperrten und fürs Erste vergäßen, uns also ganz darauf konzentrieren würden, das Untergeschoss bewohnbar zu machen, oder du erzähltest von einem Maurer, den man dir empfohlen hatte und der gut und günstig war. Aber während du weiter am Suchen, Zeichnen, Rechnen warst und dich deinen Landhausfantasien hingabst, verschanzte ich mich hinter meinem Notebook, antwortete nur einsilbig oder tat so, als müsste ich einen Artikel für den nächsten Tag fertig machen, stellte nebenbei aber meine eigenen Recherchen an: Immobilienportale, wo ich nach Mietwohnungen suchte und alle Ansprüche runterschraubte: nur ein Schlafzimmer, keine Mindestquadratmeterzahl, kein Aufzug, keine Heizung, unmöbliert, in schlecht angebundenen Vierteln und Schlafstädten, sogar Zimmer in Wohngemeinschaften. Alle paar Minuten löschte ich den Verlauf, auch wenn ich manchmal dachte, ich sollte ihn lassen, damit du ihn entdeckst und es mir dann leichter machst, den Satz auszusprechen, den ich hinunterschluckte und wieder hochwürgte, oder vielleicht als Warnung, als Hilferuf, bevor alles zu spät wäre. Und jedes Mal, wenn ich vom Bildschirm aufblickte und dich vor mir sah, konnte ich es dir einfach nicht sagen. Mein Entschluss war gefasst, und ich übte meinen Satz vor dem Spiegel ein wie ein unsicherer Teenager, doch dann sah ich dich und schaffte es nicht. Die Angst und die Schuld wogen zu schwer, klar, und die Mädchen, aber es war nicht nur das: Es warst auch du, vor allem du, die immer noch dort vor mir saß, von dir musste ich mich trennen, dir musste ich in die Augen schauen und diese Worte aussprechen. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber in diesen Tagen habe ich dich ständig angesehen. Wenn du schliefst, bevor ich das Licht ausmachte. Tagsüber, unbemerkt, wenn du mit den Mädchen beschäftigt warst, abends, wenn du das Notebook auf den Knien hattest. Ich sah dich betont beiläufig an, studierte dich aufmerksam, während in meinem Kopf immer wieder diese Verse nachhallten: »Es wird nicht mehr sein / nicht mehr / wir werden nicht mehr miteinander leben, ich werde nicht dein Kind aufziehen.« Ich hatte dich schon eine ganze Weile beobachtet, sogar schon bevor ich Inés wiedertraf. Es hat mich erstaunt, dich zu sehen, dich wiederzuerkennen, aber auch zu entdecken. An deinem Körper das Verrinnen der Zeit festzustellen. Der Zeit, die wir zusammen verbracht hatten. Du wirst mir das sicher nicht glauben, ich weiß, aber das ist das Wort: Staunen. Das Staunen, festzustellen, wie anders du warst als die Ángela, die ich vor dreizehn Jahren kennengelernt hatte. Nach und nach entdeckte ich die Unterschiede, jedes Detail, wie, ja, wie eine Lebensspur. Die Schädelknochen, die nun ein schmaleres Gesicht einfassten. Die Augen tief in den Höhlen. Die Vene, die deine Stirn schon immer senkrecht geteilt hat und die mit zunehmender Hagerkeit deutlicher geworden ist. Die violetten Lider, die Lachfalte in jedem Augenwinkel, die kleine Warze auf dem Lid, über die ich so oft mit der Zungenspitze gefahren bin. Die schmaleren, blassen Lippen. Die ehemals geraden Zähne, unten hat sich ein Zahn im Laufe der Jahre mit geologischer Langsamkeit gedreht. Die Haut, die ich, wenn du schliefst, mit der Aufmerksamkeit eines Dermatologen untersuchte: leicht orangefarben, ohne das Weiß der Jugend, die Strafe für ein Jahrzehnt Sonne. Der zarte goldene Flaum. »Ich werde dich nachts nicht haben / ich werde dich zum Abschied nicht küssen, du wirst nie wissen, wer ich war.« Die Hände. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber in jenen Tagen habe ich gern deine Hand genommen, sie betrachtet und berührt, was du vielleicht für Zärtlichkeit gehalten hast. Ich würde deine Hände unter einer Million Händen wiedererkennen, ich kenne die Form deiner Knöchel, Sehnen, Adern, Nägel, Handlinien. Und dann dein Körper. Wenn du doch noch mal vor mir die Kleider ablegtest, um dich rasch umzuziehen, oder wenn du aus der Dusche kamst, der flüchtige Augenblick, in dem ich deine Brüste sah, so klein wie eh und je, und doch haben sie zwei Töchter jahrelang genährt. Das nicht mehr ganz straffe Fleisch an den Armen, der leicht geblähte Bauch, die Hüften, denen man die zwei Geburten ansieht, die weißlichen, weichen Pobacken, die Krampfadern, die sich deine Schenkel entlangschlängeln, deine inzwischen schon etwas krummen Zehen, die ich, als wir uns kennenlernten, immer so bewundert hatte: Du hast junge Füße, habe ich gesagt, die Füße einer Gräfin. »Ich werde nicht erfahren, weshalb oder wie, nie / noch ob wirklich das war / was du sagtest, dass war / noch wer du warst / noch was ich für dich war.« Jedes Körperteil für sich zeigte mir diese Spur der Zeit, zeigte, wie wir uns abnutzen. Ich merke gerade, dass es für dich vielleicht nach Verfall klingt, nach etwas Hässlichem oder gar einem Ausdruck von Missfallen, wenn ich das so Stück für Stück, Zentimeter für Zentimeter und vielleicht zu detailliert aufzähle wie bei einer Autopsie, aber das ist es nicht, im Gegenteil: Diese genaue Beobachtung war ein Ausdruck von Bewunderung. Von Schönheit. Und wenn ich dann die Perspektive erweiterte und dich ganz betrachtete, war die Gesamtheit all dieser Fragmente das strahlende Bild von allem, was ich jahrelang an dir geliebt hatte. Es machte mich glücklich, all diese Zeichen unseres gemeinsamen Lebens zu registrieren, es war etwas Schönes, das mich rührte, mich sogar stolz machte, das oftmals Begehren in mir auslöste, aber es machte mich auch traurig, weil du und ich nicht mehr zusammen alt werden würden. »Du bist nicht mehr / an einem künftigen Tag / ich werde nicht wissen, wo du lebst / mit wem / noch ob du dich erinnerst.« Während ich dich betrachtete, wurde mir bewusst, dass ich bald nicht mehr der Notar deines Alterns sein würde, und dieser Ausdruck entlockt dir hoffentlich ein Lächeln. Ich würde nicht mehr derjenige sein, der tagtäglich feststellt, wie die Zeit vergeht, der sieht, wie ein weiteres Jahrzehnt deine Haut dünner macht, sodass die Knochen immer mehr durchscheinen, wie ein weiteres Jahrzehnt deine Haare ergrauen lässt, deine Hände sprenkelt und dein Fleisch schlaffer macht, und dieser Verschleiß würde sich fortsetzen bis ans Ende deiner Tage, würde Wirbel platt machen und Zähne zerbröckeln, dieser ganze grandiose Verfall, den ich mit dir teilen und erleben und aufschreiben wollte, dessen Schönheit mich in jeder Phase überraschen sollte, das neu aufkeimende Begehren, die unerwartete Erfahrung, einen gealterten Körper als erregend zu empfinden, der mir Jahre zuvor in seiner Nacktheit und Rauheit, mit seinem Geruch zuwider gewesen wäre, den ich nun aber würde streicheln, riechen, beißen wollen. Weil wir zusammen alt geworden wären. »Ich werde dich nicht wieder berühren. / Ich werde dich nicht sterben sehen.«
Wie rührend. Und was soll ich jetzt sagen? Muss ich mich bei dir bedanken, weil du schweigend meiner Schlaffheit und meinem faszinierenden goldenen Flaum gehuldigt, weil du sentimentale Gedichtchen vorgetragen hast, anstatt mit mir zu reden und zu sagen, dass es dir nicht gut geht, dass du dich in eine andere verliebt hast, und zu schauen, ob wir noch eine Lösung finden? Toll gemacht, wirklich. Notar meiner, wie war das noch mal, Notar meines Alterns? Nein, das fand ich überhaupt nicht witzig. Dieselben Liebesworte, die in einem bestimmten Augenblick rühren können, wirken für sich genommen, also außerhalb ihres emotionalen Zusammenhangs, einfach nur lächerlich. Deine Beschreibung meiner »Lebensspuren« ist eben das: lächerlich. Und nein, ich könnte deine Hände nicht unter einer Million Hände wiedererkennen. Ich habe deine gerichtsmedizinische Analyse nicht durch eine eigene erwidert. Mit Lebensspuren habe ich nichts am Hut, Notarin deines Verfalls will ich auch nicht sein. Und dass die Zeit verrinnt, beunruhigt mich nicht sonderlich. Denn wenn du mich in diesen Tagen so oft angesehen hast, dann nicht vor Erstaunen, Stolz oder Begehren. Nicht einmal, weil du an deiner Entscheidung gezweifelt hättest: Du hast mich einfach als Spiegel benutzt. Als einen Kalender. Schon seit Jahren war das Verrinnen der Zeit bei dir ein Dauerthema. Mit den Mädchen machtest du Witze über ihren alten Papa und die verlorene Jugend und die sportlichen Glanzleistungen, die wir bei einem über Vierzigjährigen doch bitte sehr bewundern sollten. Wieder und wieder kamst du darauf zurück, und nicht mehr nur im Spaß: Du hättest diesen Freund nach Jahren wiedergetroffen, der sei jetzt das reinste Wrack; gerade seien die Mädchen noch Babys gewesen, die du auf dem Arm tragen konntest, ihre Köpfchen hätten in deine Hand gepasst, und schau, wie groß sie jetzt sind; die Wohnung mit ihren gesammelten Abnutzungserscheinungen, den Mängeln und dem Schmutz, worüber du laufend Buch führtest; die Stadt, in der kaum noch eine der Bars von früher blieb. Wenn du mal vergessen hattest, den Browserverlauf zu löschen, entdeckte ich darin nicht etwa Immobilienseiten, sondern Tutorials zur Stärkung des Bizeps und Reduzierung des Bauchumfangs, hypochondrische Suchen zu urologischen Sachverhalten, nostalgische Videoclips und Pornoseiten, jede Menge Pornoseiten, immer mit blutjungen Lesben. Deine Playlist stammte ausnahmslos aus dem letzten Jahrhundert. In Sachen Film kreisten deine Vorlieben obsessiv um dasselbe Thema: Wiederbegegnungen von Freunden, die in einer gewaltigen Katharsis enden, Kinder, die ihre Eltern zu Grabe tragen, Todkranke bei ihrem Abschied von der Welt, Paare in der Krise, zurückgewonnene Jugendlieben, ein Junge, der während der zwölf Jahre dauernden Dreharbeiten immer größer wird, oder dieser nervige Streifen von Malick, den du dir gleich zweimal angeschaut hast. Im letzten Sommer, unterm Sonnenschirm an einem überfüllten Strand, sahst du mich, nachdem du eine Zeit lang einer Gruppe Dreißigjähriger zugesehen und zugehört hattest, die in ihrer lärmenden Ausgelassenheit wie aus einer Fernsehkomödie entlaufen wirkten, mit einem Ausdruck an, den ich für ironisch hielt, doch anstatt, wie ich es erwartet hatte, über ihre Unreife herzuziehen, fragtest du mich ganz ernst, mehr, um dich selbst zu hören als in Erwartung einer Antwort: Musst du auch manchmal daran denken, dass wir nie wieder dreißig sein werden? Und noch schlimmer, nach dem letzten Weihnachtsessen mit der Familie: Auf der Rückfahrt nach Hause, die Mädchen schlafend auf dem Rücksitz, du und ich hundemüde und mit diesem brennenden Unbehagen, das jedes Familientreffen bei uns hinterließ, brachst du ein langes Schweigen auf nächtlichen Straßen, um einen wenig weih nachtlichen Gedanken zu teilen: Wir kommen allmählich in das Alter, in dem uns die Eltern wegsterben. Du mit deinen Lebensspuren. Ich will nicht sagen, dass das alles nur eine klassische Midlife-Crisis ist, der über Vierzigjährige, den es schwindelt, wenn er auf einmal spürt, wie die Zeit verrinnt, der wehmütig auf das blickt, was er nicht erreicht hat, und nach der verlorenen Jugend sucht, indem er sich die junge Inés anlacht, und dann hebt er den Blick vom PC und sieht seine reife Ehefrau und staunt über ihre weißlichen Pobacken und ihre schlaffen Arme. Ja, ja, da ist noch mehr, allzu simple Erklärungen bringen uns nicht weiter, deshalb graben wir ja in die Tiefe, um die Ursachen für unser Scheitern zu finden. Ich habe dich auch manchmal angesehen, aber nicht mit diesem Gerichtsmedizinerblick, keine Sorge, ich gehe jetzt nicht zum Gegenangriff über, mit einer Ode auf dein verhärtetes Gesicht, deine Geheimratsecken oder deine Zähne, die lang geworden sind durch den Zahnfleischschwund. Wenn ich dich ansah, spürte ich weder Staunen noch Stolz, sondern Befremden. Das Befremden darüber, dich nicht zu kennen, dich nicht wiederzuerkennen. Und mich auch nicht. Je länger ich mit dir zusammen bin, desto weniger kenne ich dich. Der Satz stammt von dir, du hast ihn vor Jahren zu mir gesagt, als wir zu Hause mal wieder Streit hatten. Und du hattest recht: Dieses Gefühl, wir würden einander immer weniger kennen, uns immer fremder werden seit einem Anfangsmoment der völligen Verschmelzung. Und wenn wir uns erst getrennt haben, wird die Fremdheit noch weiter zunehmen, wir werden uns voneinander entfernen, bis irgendwann unsere Töchter uns bei einem Familientreffen anschauen und sich überrascht dasselbe fragen wie wir, wenn wir deine oder meine Eltern sehen nach all den Jahren der Trennung: Wie kann es sein, dass diese so andersartigen Wesen sich einmal ineinander verliebt und eine gemeinsame Zukunft gewünscht haben? Sooft wir uns das bei unseren Eltern fragten, landeten wir bei der Frage nach Henne oder Ei: Sind sie so unterschiedlich, so inkompatibel geworden, weil sie sich früh getrennt haben und jeder seinen eigenen Weg gegangen ist, oder lag es an dieser schon immer vorhandenen Unterschiedlichkeit, dass sie einander fremd wurden und sich schließlich trennten? Standen wir selbst uns wirklich mal so nah, oder ist das eine Idealisierung post mortem, der klassische Abschiedsschmerz nach einer Trennung? Im Park haben wir gerne die alten Leute beobachtet, Paare, die spazieren gingen, als machten sie das seit einem halben Jahrhundert: Sie an seinem Arm, ein Schweigen, das stilles Einvernehmen und Verbundenheit ausdrücken konnte oder auch Gleichgültigkeit und Erschöpfung. Wir vergnügten uns damit, körperliche Ähnlichkeiten festzustellen, die äußerliche Anpassung, nachdem man jahrzehntelang im selben Bett geschlafen hat, allgemein sagt man ja, dass Paare dazu neigen, sich anzugleichen, so wie das auch von Hunden und ihren Besitzern behauptet wird, Psychologen im Radio erklären es aus einem Zusammenspiel von selektiver Partnerwahl, Affinität und Gewohnheit. In unserer Anfangszeit wurden wir gelegentlich für Geschwister gehalten. Wir machten darüber Witze, wenn wir aus dem Haus gingen und uns im Aufzugspiegel sahen, gekleidet in denselben Farben, die Brillen so ähnlich, dass wir sie auf dem Nachttisch verwechselten, beide gleich schlank und häufig sogar mit einer ähnlichen Frisur. Ganz zu schweigen von dem Buch mit den zwei Lesezeichen, wenn wir es nicht gar zur selben Zeit lasen, nebeneinander auf dem Sofa, von unserem militärischen Gleichschritt und davon, dass wir die Wünsche des anderen vorausahnten oder uns kraft unserer geistigen Verbindung dieselbe Nachricht schickten. Das alles vermisse ich manchmal, und dann wieder finde ich es erstickend, eine Fehleinschätzung, ein allzu schnelles Verbrennen.
In diesen Tagen, als ich dich beobachtete und an meinem Entschluss zweifelte, habe ich gerechnet, denn das machen Menschen, die sich eine Trennung wünschen und sie gleichzeitig fürchten, ganz obsessiv: Sie stellen Rechnungen auf, immer wieder dieselbe Rechnung, auf den Rändern von Heften, auf Schmierpapier, der Serviette im Café, der Tafel ihrer Töchter, im geöffneten Dokument am Computer, auf dem Taschenrechner des Handys; stets dieselbe Rechnung, ich kannte sie schon auswendig, trotzdem schrieb ich sie immer wieder um und rechnete neu, als könnte ich durch meine Hartnäckigkeit die Mathematik bezwingen: Ich addierte die Miete, den allerniedrigsten Betrag, der zwar nie so in der Anzeige stand, den ich aber auszuhandeln beabsichtigte, Nebenkosten für einen Alleinstehenden, den Unterhalt für Germán, auf den ich dessen Mutter in meiner rechnerischen Illusion gern herunterhandeln wollte, und die Kosten für Lebensmittel, angepasst an ein Existenzminimum; in einer zweiten Rechnung bezog ich meine Außenstände mit ein und wagte eine maßlos optimistische Prognose hinsichtlich zukünftiger Aufträge, verrechnete meinen Anteil an unseren restlichen Ersparnissen mit den nächsten Monaten, überschätzte den Gewinn aus einem etwaigen Verkauf des Landhauses und träumte sogar davon, dass mein bankrotter Vater uns das Geld zurückzahlte, das wir ihm geliehen hatten. Auf dem Höhepunkt meines verzweifelten Optimismus bezog ich manchmal sogar die unwahrscheinliche Zahlung eines Honorars mit ein, das mir die Zeitung seit der Schließung schuldete. Und da die Rechnung dennoch nur für ein Jahr aufging oder für eineinhalb, wenn ich den Gürtel ganz eng schnallte, fügte ich dem Schlusssaldo noch einen Vorschuss hinzu, den ich einem Verlag für ein schnell zu schreibendes und hochaktuelles Buch aus den Rippen leiern wollte, dessen Thema ich bereits hatte, nämlich, du wirst lachen: Die geschiedenen Väter unserer Generation. Ich habe dir mal davon erzählt, halb im Scherz, es ging von meiner eigenen Trennungsgeschichte mit Germáns Mutter aus: Man müsste ein Buch über die Scheidungserfahrung von Vätern in meinem Alter schreiben, also ein Buch ganz speziell für diese Männer. In diesen Wochen machte ich mir Notizen zu dem Buchprojekt, das mal journalistisch, mal sozialkritisch, mal eine frivole Sittenkomödie war, mal Fiktion, mal Autofiktion, mal alles zusammen. Ein Buch, das eine Marktlücke schließen würde, so viele Väter, die sich jung scheiden lassen, und alle haben wir dasselbe Repertoire an Ängsten, Klagen, Ärgernissen, Schuldgefühlen, Freuden, Anekdoten und Engpässen. In den Cafés, an den Nachmittagen, an denen wir als Väter in Erscheinung treten, werfen wir uns solidarische Blicke zu, wir leben in derselben finanziellen Notlage und derselben Unsicherheit, haben in Sachen Emotionen und Rechtsstreitigkeiten ähnliche Erfahrungen gemacht, jedes Mal, wenn wir bei einem Kindergeburtstag zusammenkommen, äußern wir leise die gleiche Kritik an unseren Ex-Frauen. Wenn ich besonders mutlos war und meine Rechnung nicht aufging, wurde das Buch düsterer: eine Reflexion darüber, dass die Scheidung für einen Teil unserer Generation in einer Katastrophe endet. Ich schrieb sogar einen Artikel zu dem Thema, eine Reportage, mit der ich die Leser testen und das Interesse der Verlage wecken wollte, es ging darum, dass eine Trennung mit Kindern heute für viele Menschen unweigerlich den sozialen Abstieg bedeutet. Wir, die wir in dem Glauben groß geworden sind, eine Scheidung sei kein Drama mehr, sondern lediglich eine weitere Etappe in unserem Leben, sogar erstrebenswert, verdient, ein Freiheitsversprechen im Erwachsenenalter, Sprungbrett für ein neues, genussvolles Leben als Junggeselle, nach den Freuden einer Ehe, die vor allem dann freudvoll ist, wenn man sie vor ihrem Niedergang beenden kann. Die Reportage war ein ziemlicher Erfolg, der meistgelesene Text des Tages, mit Hunderten von Kommentaren, viel beachtet in den sozialen Netzwerken, eine Menge Leute brachten ihre eigenen Erfahrungen ein und klagten über diese Scheißscheidungen, die wir uns leisten können: Väter in winzigen Wohnungen, für die sie sich vor ihren Kindern schämen, oder die zu ihren Eltern in ihre einstigen Jugendzimmer zurückgekehrt sind oder die eine Wohnung mit anderen Vierzigjährigen teilen, ganz zu schweigen von denen, die gänzlich in die Bedürftigkeit abgerutscht sind, Geschiedene, die auf einem Campingplatz leben! Diese Männer und auch Frauen, alleinerziehende Mütter in winzigsten Wohnungen, in Panik, wenn der Unterhalt des Vaters zu spät eingeht, erbitterte gerichtliche Auseinandersetzungen um ein paar Euro mehr. Wir dachten, eine Scheidung in dieser Lebensphase wäre die Eintrittskarte in den begehrten Klub reifer Männer und Frauen, die wieder da sind und, emotional gepanzert und sexuell befreit, ihre zweite Lebenshälfte genießen wollen, mit großen Kindern und einer Zukunft auf dem richtigen Gleis, wofür wir natürlich die finanzielle Grundlage hätten, kein Vermögen, aber ausreichend. Doch irgendwas ist schiefgelaufen, verdammt noch mal, da stehen wir nun, schau uns doch an, wir haben nichts gemein mit den geschiedenen Helden aus diesen schönfärberischen Fiktionen, sind nicht der attraktive Vater, der eine Wohnung mit einem Zimmer für jedes Kind hat, in die er seine Wochenendbekanntschaften mitnimmt, mit denen er prickelnde Affären hat, und der im Sommer mit seinen Kindern im Wohnmobil durch Europa reist. Die einzige Möglichkeit, sich über Wasser zu halten, ist für viele eine neue Beziehung, in der man die Kosten mit der neuen Partnerin teilt, und so harren sie aus und wagen erst den Absprung, wenn eine andere Liane gefunden ist, an die man sich klammern kann. In meinen schlaflosen Nächten als mittelloser Scheidungsanwärter malte ich mir aus, dass Tausende dieser vierzigjährigen Trennungsväter, Zehntausende, Hunderttausende, dass sie alle sofort losstürmen und dieses Buch kaufen würden, in dem es um sie ging, in dem sie sich verstanden fühlten und anerkannt; und das würde rasch ein sensationeller Verkaufserfolg werden und ein gesellschaftlicher gleich dazu: Scheidungsgeneration Golf!, welcher Verlag würde einen solchen Vorschlag ablehnen, irgendein Fernsehproduzent würde darin den Stoff für eine Serie erkennen, eine Sittenkomödie mit sozialkritischem Touch, verarmte Väter in Wohngemeinschaften, eingeblendete Lacher, sag nicht, es hätte nicht was Poetisches, wenn ich mir meine Trennung mit einem Buch über die Schwierigkeiten von Trennungen finanzieren würde. In diesen Tagen, an denen ich Inés über Telefonate, Mails und heimliche Spaziergänge immer näher kam, in diesen Tagen, in denen du mir immer ferner wurdest, weil ich dir auswich, Arbeit vorschützte, deine Versuche abwehrte, über den Hausumbau oder die Planung unserer näheren Zukunft zu reden, in diesen Tagen brachte ich ein kleines Exposé zustande und nicht viel mehr, das Einzige, was ich letztlich geschrieben habe, war diese Reportage, von der ich nicht weiß, ob du sie gelesen hast, da du das, was ich schreibe, ja schon länger nicht mehr liest.
Nein, ich habe sie nicht gelesen, und du hast mir auch nicht davon erzählt, wird schon seinen Grund gehabt haben. Aber ich habe um diese Zeit einen anderen Text von dir gelesen, den ich jetzt besser verstehe. Einen, auf den ich stieß, ohne zu wissen, dass er von dir war, mich hat einfach die Titelzeile angesprochen: »Wirf die Briefe deiner Ex nicht weg!«, auf dieser Reise-Website, wo sie dich für einen Globetrotter halten und dir noch immer Reportagen über Orte bezahlen, wohin du nie einen Fuß gesetzt hast. Diesmal ging es um das Museum der Zerbrochenen Beziehungen in Los Angeles, über das du mit einem Enthusiasmus schriebst, den ich auffällig fand, wenn man bedenkt, dass es sich um ein kleines, unbekanntes Museum handelt, von zweifelhaftem künstlerischen Wert. In deiner Darstellung erinnerte es mich an die Kapelle, die wir vor Jahren in Portugal besucht hatten, wo von Krankheiten Geheilte der dortigen Jungfrau für ihren wundersamen Beistand dankten, indem sie die Wände mit Tausenden von Votivgaben aus Wachs dekorierten, eine scheußlicher als die andere: Hände, Füße, Köpfe, Beine, Arme, Ohren, Augen, Knochen, Gebisse, innere Organe, dazu Haarmähnen, Fläschchen mit Körperflüssigkeiten, Kleidungsstücke, Krücken, Fotos, Heiligenbildchen und handgeschriebene Briefe, das alles so dicht an dicht, dass man nichts mehr von den Mauern sah. Als ich über das von dir bewunderte Museum in Kalifornien las, verspürte ich einen ähnlichen Widerwillen gegen diese Sammlung von einzelnen Eheringen, Dessous, Haarsträhnen, Brautkleidern, Kuscheltieren, verlorenen Haustürschlüsseln, Liebesbriefen, Figürchen von Hochzeitstorten, Reiseaufzeichnungen, Flugtickets, billigem Nippes, dessen emotionale Bedeutung nur schätzt, wer ihn verschenkt hat, sogar zwei Silikonimplantate waren dabei, die sich eine enttäuschte Braut hatte herausoperieren lassen, was dich zu dem billigen Witz inspirierte: Das Herz hat sie wohl doch noch gebraucht. Ich konnte die Leidenschaft nicht begreifen, mit der du über die Säle schriebst, die du angeblich innig gerührt durchwandert hattest, vertieft in die Geschichten, die jeder Liebesreliquie beigefügt waren. Nach diesem emotional aufwühlenden Museumsbesuch, hieß es weiter, seist du dann recht melancholisch über den Hollywood Boulevard spaziert. Dem folgten ein paar Gedanken über den Schmerz am Ende einer Liebe, ziemlich trivial, wenn du gestattest. Abschließend fragtest du den Leser, was er denn dem Museum zur Verfügung stellen würde, um Zeugnis von seinem gebrochenen Herzen zu geben, auf welchen Gegenstand er all sein Glück und all seine Trauer über die verlorene Liebe konzentrieren würde. Tut mir leid, aber ich konnte mit der Frage nicht viel anfangen, meine Augen wanderten vom Bildschirm zum Wohnzimmer, ohne etwas zu finden, das ich für würdig befunden hätte, in einem Museum unser Zusammenleben zu repräsentieren. Ganz schön naiv von mir, ich kam keine Sekunde lang auf die Idee, den Text als Ausdruck davon zu interpretieren, dass dir etwas auf der Seele brannte. Wenn er eine Warnung war, habe ich sie nicht wahrgenommen.
Von dem Museum hat mir Inés erzählt, am ersten Nachmittag in ihrer Wohnung, nur zehn Tage nachdem der Zufall uns wieder zusammengebracht hatte, falls man den Algorithmus eines sozialen Netzwerks, der dir neue Freunde und Kontakte vorschlägt, überhaupt als Zufall bezeichnen kann. Inés war gerade von einem zweijährigen Aufbaustudium in Los Angeles wiedergekommen, und sie erzählte mir von diesem Museum der Zerbrochenen Beziehungen, nachdem ich ihr gestanden hatte, dass es zwischen dir und mir nicht mehr so gut lief, dass wir uns in der Nachspielzeit befanden. Oder eigentlich in der garbage time, um einen Begriff aus dem Basketball zu verwenden. Nach zehn Tagen Online-Verführung waren wir so weit und verabredeten uns in ihrem Apartment, um offene Rechnungen zu begleichen, zwischen ihr und mir, und ja, auch zwischen dir und mir. Apartment nannte sie es, obwohl es größer ist als unsere alte Wohnung, über neunzig Quadratmeter auf einer einzigen, offen angelegten Fläche, mit einer eingezogenen Ebene zum Schlafen, freigelegten Backsteinwänden, einer breiten Fensterfront, IKEA-Möbeln, aber den hochwertigen, einer guten Stereoanlage und zahlreichen Ausstattungsdetails, die nicht zu der Kaufkraft einer Stipendiatin in den Dreißigern passten, die in einem Forschungsprojekt arbeitet, weshalb sie gleich, als ich reinkam, ungefragt erklärte: Ich weiß, was du denkst, wie kann ich mir so was leisten, aber da ist ein Trick dabei, die Wohnung gehört meinen Eltern. Sie zeigte mir die Terrasse, das Apartment stellte sich nämlich als Penthouse heraus, und ans Geländer gelehnt betrachtete ich die umliegenden Gebäude, während sie mir erzählte, dass ihre Eltern, als die Wirtschaftskrise begann und alle Welt verkaufen wollte, sich ganz gut arrangiert hätten und später zu Stammgästen auf Versteigerungen geworden seien, wo Immobilien verstorbener Eigentümer ohne Erben verkauft wurden, wodurch sie sich eine hübsche Sammlung von Wohnungen zugelegt hätten, die sie nun vermieteten, außer der hier, die sie bekommen hätte. Auf einer Dachterrasse auf der anderen Straßenseite lag ein Mann in meinem Alter auf einem Liegestuhl, er las, barfuß, neben sich einen Drink mit Eiswürfeln, einer dieser Leute, die an einem normalen Arbeitstag abends um sechs auf der Terrasse ihrer Dachwohnung lesen und einen Gin Tonic trinken können. Auch auf Inés’ Terrasse stand ein Liegestuhl. Ich setzte mich darauf und zog meine Schuhe aus. Zurückgelehnt, die Augen wegen der Sonne halb geschlossen, fühlte ich mich in der sanften Oktoberwärme auf einmal müde. Sehr müde. Unendlich müde. Eine jahrhundertealte Müdigkeit. Müde von dir und von mir und von uns, müde von dieser langen Überfahrt, bei der mir inzwischen egal war, ob sie in einem Schiffbruch endete, ganz gleich, wie nah das verfluchte Ufer sein mochte. Du hast diese Müdigkeit auch oft gespürt, das weiß ich, und du weißt, dass es in diesen schwachen Momenten nur eines kleinen Anstoßes bedarf, damit alles zusammenbricht. Die Liane, die verdammte Liane, mit der Inés winkte, als sie sich über mich beugte, meinen Kopf zwischen ihre Hände nahm und mich auf die Stirn küsste. Aufs Ohr. Auf das andere Ohr. Auf ein Augenlid. Die Nase. Das Kinn. Was für eine Müdigkeit, Ángela, was für eine schreckliche und was für eine köstliche Müdigkeit in diesem Augenblick, was für eine Lust zu weinen, zu schreien, mich von der Terrasse zu stürzen, mich an Inés zu klammern, nach Hause zurückzukehren und dich dort anzutreffen, alles auf einmal, und nichts schien stark genug zu sein, um mich von dieser Müdigkeit zu kurieren. Ich zog Inés auf den Liegestuhl, und als wir uns küssten, spürte ich, wie die wenige Energie, die mir noch geblieben war, um mit dir weiterzukämpfen auf dem Boot, aus meinem Mund entwich und mein Körper gleichzeitig von einer neuen Energie erfasst wurde. Ohne meinen Mund von Inés’ Mund zu lösen, blinzelte ich mit einem Auge und sah den Nachbarn auf seiner Dachterrasse, und der hätte in diesem Augenblick ohne Weiteres sein Glas erheben und mir mit einem Lächeln zuzwinkern können.
Spazieren gegangen seid ihr, hast du gesagt. Heimliche Spaziergänge, so hast du es genannt. Die Vorstellung, wie du es in ihrer Neureichenwohnung mit ihr treibst, tut mir nicht annähernd so weh, wie zu erfahren, dass du mit ihr spazieren warst, spätnachmittags, wenn du unter irgendeinem Vorwand aus dem Haus gingst, wahrscheinlich habt ihr euch dann am Stadtrand getroffen, geschützt vor den Blicken Bekannter. In einem Park, einem Neubauviertel mit unberührten Gehsteigen und mickerigen Bäumen, auf einem schmalen Weg, der sich am Rand der Autobahn gehalten hat, vielleicht auf einem Friedhof. Auf meinem Heimweg von der Arbeit, im Bus, sehe ich sie immer durchs Fenster, Liebespaare, die etwas tun, das sich fast niemand mehr leisten kann: spazieren gehen. Ohne Ziel, ohne Eile, mit aller Zeit der Welt. Gemächlich, ganz gemächlich gehen, eine größere Auflehnung kann ich mir nicht vorstellen. Hand in Hand, einen Arm um die Taille oder die Schultern gelegt, die Schritte im selben Rhythmus. Sich an jeder Ampel küssen. Stehen bleiben, um an einer Fassade die Giebel zu bestaunen, eine Industrieruine. Das endlose Flanieren der Verliebten, für die Gehen eine andere Form ist, sich kennenzulernen, aber auch, sich den Raum neu anzueignen und daraus einen gemeinsamen zu machen, und dabei hinterlassen sie den glitzernden Speichel des Begehrens. Kommt dir das bekannt vor, dieses Wortgeklingel? Die Liebenden, die Parks und Brachen durchstreifen, auf den Wegen des Begehrens, desire paths, lignes de désir, das Begehren bricht sich stets Bahn und bewegt sich am liebsten auf einer Geraden. Hast du das mit den Wegen des Begehrens auch Inés erklärt? Unser, dein und mein letzter Spaziergang war vor dem Sommer gewesen, an unserem Hochzeitstag. Weißt du noch? Nachdem wir ihn jahrelang nicht gefeiert, sogar das Datum vergessen hatten, ließen wir diesmal die Mädchen bei meiner Mutter und gingen für ein paar Stunden aus. Doch anstelle eines Restaurantbesuchs schlug ich dir vor, spazieren zu gehen, nichts weiter, ein Spaziergang, wie wir seit Jahren keinen gemacht hatten. Du wirktest nicht sonderlich begeistert, warst aber dann doch einverstanden. Wir drehten eine lange Runde, durchquerten die Siedlung, in der meine Mutter wohnt, gelangten bei Einbruch der Dunkelheit in offenes Gelände und liefen über die Felder bis hinunter zum Fluss. Der Anfang war etwas zäh, wir erzählten uns lustlos, was es Neues bei der Arbeit gab. Dann ein paar Bemerkungen zu den Kindern: Sofías schwierige Nächte, Anas nächster Arzttermin, deine Sorgen mit Germán, Ideen für den nächsten Geburtstag. Als Drittes folgte ein schneller Gesundheitscheck, meine Zähne, dein Ekzem, bei dem Tempo würde uns schon auf dem ersten Kilometer der Gesprächsstoff ausgehen. Ich schlug vor, über das Haus auf dem Land zu reden, den eigentlichen Grund für diesen Spaziergang, irgendwann mussten wir das mit dem Umbau entscheiden und Termine planen, jeder von uns hatte sich die Sache durchgerechnet, bei mir ging die Kalkulation auf, bei dir nicht. Aber du sagtest, wir sollten das lieber ein andermal machen, du wolltest an unserem Hochzeitstag keinen Streit riskieren, und außerdem fändest du es absurd, Luftschlösser zu bauen, während wir an den obszön teuren Häusern in der Siedlung meiner Mutter vorbeischlenderten, die Leute, die diese Häuser gebaut hatten, müssten nie über Kostenvoranschläge verhandeln und in Industriegebieten Restposten kaufen, du wurdest den Gedanken nicht los, sie könnten uns mit ihren Sicherheitskameras sehen und hören und sich über unseren so bescheidenen wie aufreibenden Traum vom Landleben lustig machen. Ein paar Minuten lang herrschte zwischen uns ein unangenehmes, schlimmer noch, ein leeres Schweigen, und da war wenig, womit man es hätte füllen können, aber als wir die Siedlung verließen, beschloss ich, dem Gespräch eine Wendung zum Wesentlichen zu geben und dabei klammheimlich das Hausthema wieder einzuführen. Also stellte ich dir eine Frage, die in meinen eigenen Ohren hochtrabend klang und eher nach dir, wie eine schlechte Kopie dieser Filme, die du so magst und in denen ein Paar anderthalb Stunden lang herumläuft und die ganze Zeit nur redet, in Paris oder Manhattan oder auf einer wunderschönen griechischen Insel, nicht auf so einem Kartoffelacker wie wir. Sie laufen herum und reden und ziehen Bilanz und rechnen ab und bringen tolle Sprüche und tiefschürfende Fragen, die den Zuschauer bewegen, die uns jedoch, wenn sie auf unserer Seite der Leinwand ausgesprochen werden, stets aufgesetzt vorkommen. Wie stellst du dir die Zukunft vor? Das war meine Frage, später erweitert zu: Wie, glaubst du, ist dein Leben in fünfzehn oder zwanzig Jahren? Mein Leben in zwanzig Jahren?, hast du gelächelt, da ist nur eins sicher, nämlich dass ich nicht in einem von diesen Schuppen wohnen werde, und dabei hast du in Richtung der Häuser gezeigt, die wir inzwischen hinter uns gelassen hatten. Dann versuchtest du, dich mit Scherzen aus der Affäre zu ziehen, mit der Story vom Mann, der altert wie guter Wein, der interessante reife Herr mit unverminderter Potenz, platonische Liebe der Freundinnen seiner Töchter, aber mir war es ernst, und so fiel ich dir ins Wort: Hör auf, den Clown zu spielen, verdammt, ich würde jetzt gern ein ernsthaftes Gespräch führen, ich will nicht wissen, ob du glaubst, dass wir in zwanzig Jahren noch zusammen sind, ich spreche von dir, wo würdest du dann stehen, wo siehst du dich dann? Dir war bei der Frage offenbar nicht wohl, und so gabst du mir eine improvisierte Antwort, in der es um alles andere ging, nur nicht um dich: den unsicheren Arbeitsmarkt, den Zusammenbruch des Rentensystems, die neuesten medizinischen Entwicklungen, die nur Leute mit Geld sich leisten können, die kleinen, durch und durch klischeehaften Freuden des Lebens, die wir erst in den späten Jahren schätzen lernen, die Genugtuung des Vaters, der sieht, wie seine Töchter ihren eigenen Weg im Leben finden, das Alter, das uns weiser werden lässt, das unerlässliche Herunterschrauben der Erwartungen, den schützenden Zynismus, du kamst mir sogar mit diesem Stuss von wegen mit zwanzig ein heißes Herz und mit fünfzig einen kühlen Kopf oder so. So unangenehm war dir die Frage, dass du sie mir noch nicht mal zurückgabst, du hast einfach das Thema gewechselt, wir könnten doch umkehren, ins Auto steigen und irgendwo etwas trinken, und das war’s dann mit meinem Versuch, mit dir ins Gespräch zu kommen. Wenn du mich dasselbe gefragt hättest, hätte ich dir erzählt, wie ich mir mich und uns in der Zukunft vorstellte, denn mich beschäftigte das schon: wie mein Leben, wie unser Leben sein würde in fünfzehn oder zwanzig Jahren. Ich hätte dir von einer Zukunft erzählt, in der sich Willen und Wunsch ausdrückten, aber in einem durchaus realistischen Rahmen. In dieser Version der Zukunft sind wir zusammen, ja: Da werden wir zusammen alt. Um eine von den odysseeischen Metaphern zu verwenden, die mir bekanntlich so gut gefallen: Wir haben die Reise durchgestanden, haben Stürme überlebt, Schiffbruch, Verluste und Sirenengesänge, sogar die Müdigkeit haben wir überlebt und sind nicht am Ufer ertrunken. Wir haben festen Boden erreicht. Wir haben unser Haus, einen Platz nur für uns, von dem uns niemand mehr vertreiben kann und wo wir wie Robinson überleben würden, sollte dort draußen alles schieflaufen. Wir lieben uns, sicherlich nicht leidenschaftlich, aber wir lieben uns, nicht voller Begehren, aber wir lieben uns, jeder könnte ohne den anderen leben, aber wir lieben uns, wir haben akzeptiert, dass diese ruhige Art des Liebens weder Schwund noch Scheitern ist, sondern im Gegenteil ein Triumph. Wir sind zusammen, nicht aufgrund irgendeiner schicksalhaften Bestimmung oder als untrennbare bessere Hälften, nicht einmal aufgrund von wirtschaftlichen Zwängen, sondern weil wir beschlossen haben, zusammenzubleiben. Wir haben gelernt zu genießen, was uns verbindet, in erster Linie unsere Töchter. Wir haben ebenfalls gelernt, dass jeder Raum und Zeit für sich braucht, haben dabei die Bereiche des Gemeinsamen ausgehandelt, mit so viel Respekt füreinander, dass wir das gemeinsame Territorium in gegenseitigem Einverständnis erweitert haben. Wir verlangen voneinander weder Exklusivität noch eine Treue, die Frust verursacht, und eben durch diese Freiheit schwindet unser Interesse an der Außenwelt, denn wir haben sogar unser Begehren wiedergefunden, es an unsere jeweiligen Bedürfnisse angepasst und letztlich aufeinander abgestimmt. Wir gehen spazieren. Wir gehen viel spazieren, jeden Abend auf dem Hügel nicht weit von unserem Haus. Inzwischen kennen wir sogar die Namen der Bäume. Wir kümmern uns beide um den Gemüsegarten, mach dich gerne darüber lustig, aber in meiner Fantasie vom Leben gibt es auch einen Gemüsegarten, mehr zur Eigenversorgung denn als spirituelle Tätigkeit. Wir sind zusammen. Wir wissen, dass wir füreinander da sein werden, wenn uns irgendwann die Krankheit trifft, die Depression, der geistige Abbau, die körperliche Lähmung, die Inkontinenz und das gnadenlose Vergessen von Gesichtern und Namen. Wir sind unser eigener Wohlfahrtsstaat. Wir sind in Sicherheit. Wir sind zu Hause, so wie beim Fangenspielen in der Kindheit, als man »Zu Hause« rufen und sich auf einen erhöhten Punkt stellen musste, wo man dann außer Gefahr war und beschützt wie unter einer ehernen Glocke. Zu Hause.