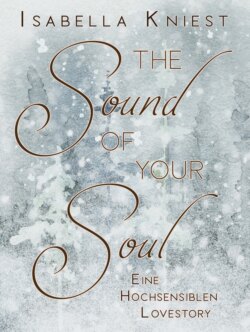Читать книгу The sound of your soul - Isabella Kniest - Страница 10
ОглавлениеAlleinsein stellt das höchste Gut dar,
Einsamkeit den tiefsten Schmerz
Ich erwachte am frühen Morgen nach einer von Albträumen durchsetzten Nacht, in welcher ich eine ausgedehnte Tiefschlafphase herzlich vermisst hatte und ich mich nun ähnlich erschöpft fühlte wie vor dem Zubettgehen. Den Barbesuch hätte ich besser sein lassen sollen. Zu viele fremde Menschen auf einem Haufen und Lärm gepaart mit mir unmöglich einzuschätzenden Situationen brachten mir stets unruhige Nächte.
Ich streckte mich.
Tom.
Ein sachter Adrenalinausstoß jagte mir quer durch die Blutbahn.
Alsbald mein Gehirn diesen Namen hervorgebracht hatte, sah ich seine durchdringenden, mich liebevoll betrachtenden Augen vor mir.
Gerne hätte ich gewusst, welche Farbe sie trugen …
Wie sahen sie aus, wenn die Strahlen der Sonne sie beschienen?
Himmelherrgott!
Welche Dinge kamen mir da in den Sinn?! Es wurde stündlich schlimmer mit mir!
Behäbig stemmte ich mich hoch, schlurfte ins Bad und duschte mich. Nach einem ausgiebigen Frühstück, das aus einem Dinkeltoast mit Tomaten, Mozzarella, ein wenig Ketchup und einer heißen Tasse Kakao bestand, setzte ich zu meinem wöchentlichen Wohnungsputz an. Da ich wochentags arbeitete und Samstag meinen Erholungstag bildeten, hatte ich mich vor einigen Jahren dazu entschlossen, Putzarbeiten stets auf Sonntag zu verlegen. Erstens waren sämtliche Geschäfte geschlossen, womit ich nirgendwo großartig hingehen konnte, zweitens bereitete ich mich dadurch auf den Start in eine neue Woche vor.
Indessen ich das Bett überzog, musste ich neuerlich an Tom und unser Gespräch zurückdenken. Und dieses warme, verbindende Empfinden trat zurück in mein Herz – und verstärkte sich. Gleichzeitig schlug mir ein schmerzhafter Blitz in die Seele, ausgelöst durch die bittere Tatsache, für Tom bestenfalls eine Bettgeschichte darzustellen.
Ich atmete tief durch, versuchte, meine Enttäuschung zu verdrängen. Zu meinem Pech wollte es mir nicht gelingen.
Tom hatte etwas so Einzigartiges an sich besessen – eine ehrliche, liebevolle Ausstrahlung, respektvolle Selbstsicherheit … und diese seltsame Schüchternheit, welche dann und wann in den Vordergrund trat und ihn für wenige Sekunden schier gänzlich ausfüllte.
Sein delikates Aussehen, seine Aufmerksamkeit …
Weshalb war es mir nicht möglich, einen Mann kennenzulernen, bei dem ich mich wohlfühlte und welcher sich eine Beziehung mit mir vorstellen konnte … und wollte?
Selbstverständlich, wahre Liebe existierte nicht. Bedingungsloses Vertrauen existierte nicht. Doch zumindest einen halbwegs anständigen Partner an meiner Seite zu wissen, auf den ich mich verlassen konnte – war dies zu viel verlangt?
Ich warf das Bettzeugs in die Waschmaschine und fing mit dem Abstauben an. Kästen, Lichtschalter, Türen, Türgriffe, Fensterbänke und der Bürotisch. Danach reinigte ich Bad und WC.
Du bist eine Niete, hallte es just durch meine Gehirnwindungen. Zum Glück habe ich bloß drei Monate meines Lebens mit dir verschwendet.
Mein Ex-Freund hatte mir diese wundervollen Worte vor die Füße gespuckt. Genauer gesagt: erster und bisher letzter Freund.
Weshalb hatte ich mich auf ihn eingelassen? Wahrscheinlich, weil er mich mit dummen und verlogenen Komplimenten um den Finger gewickelt hatte. Ich war zu naiv gewesen, hatte angenommen, Menschen wären grundsätzlich nett und zuvorkommend. Dabei ging es ihnen seit jeher um Machtmissbrauch und Erfüllung ihrer egoistischen Ziele. Solange ich ihnen half und alles tat, was sie wollten, waren sie halbwegs freundlich zu mir. Alsbald jedoch ich etwas forderte oder wünschte, wurde ich ignoriert – oder, wie im Falle meines Ex-Freunds, fallengelassen.
Und andere Männer, welchen ich in den darauffolgenden Jahren begegnet war? Diese wollten allesamt kurze Affären oder einen Blowjob.
Nun, eigentlich waren es lediglich drei Dreckskerle gewesen, die mich angesprochen hatten. Und alle drei waren verheiratet. Die Blowjob-Nummer hingegen bot mir ein Alkoholiker in seinem Suff an. Seine verfaulten Zähne und der penetrante aus Talg und Schweiß zusammengesetzte Körpergeruch hatten mich mindestens genauso abgestoßen wie das verwahrloste Erscheinungsbild und die Frage an sich.
Ja, liebes Leben, du beschenkst mich andauernd mit Lorbeeren. Womit habe ich derart viel Glück verdient?
Frustriert und verzweifelt packte ich den Staubsauger und schaltete das Lärmmonster ein.
In meinen Kindheitstagen hatte ich das Geräusch eines Staubsaugers nicht eine Sekunde lang ertragen. Alsbald meine Mutter zu saugen begann, hatte ich mir entweder die Ohren zugehalten oder mich ins entlegenste Zimmer der Wohnung verkrochen. Glücklicherweise gewöhnte ich mich nach und nach daran – und heute gelang es mir problemlos, selbst zum Teleskopauszug zu greifen und lästigem Feinstaub den Garaus zu machen.
Nach getaner Arbeit trat ich ans Küchenfenster. Es gewährte mir den Ausblick auf den parkähnlich angelegten Hinterhof des dreistöckigen Mehrparteienhauses.
Im Sommer tummelten sich dort Kinder und Rentner. Im Winter traf man meistens niemanden an. Die Spielgeräte wurden stets abmontiert und im Keller untergebracht, um sie vor starker Witterungseinwirkung zu schützen. Ebenso vergeblich suchte man Bänke.
Ich war zufrieden damit. Das penetrante Kindergeschrei reichte mir die Sommermonate über.
Schleierhafte Winterwolken tauchten den Himmel in ein cremiges Eisblau. Helios selbst präsentierte sich in Form einer weißlich-gelben Kugel, welche ihr schwaches, kaltes Januarlicht teilnahmslos gen Erde sandte.
Ich dachte zurück an Tom, und mit welchen negativen Gefühlen ich das Lokal verlassen hatte.
Einst hatte ich nicht solcherweise überreagiert. Ich hatte keinerlei Vorurteile gehegt und jedem Menschen die Chance eingeräumt, sich mir vorzustellen. Ich war ausnahmslos objektiv und hatte Verständnis und Mitgefühl für jeden – selbst für charakterlose Dreckskerle. Stets dachte ich: Hinter einem jeden Menschen steckt ein Schicksal, eine Geschichte, ein einschneidendes Erlebnis. Niemand reagiert grundlos kalt, unfreundlich, verängstigt oder fröhlich.
Aufgrund meiner Naivität hatte ich allerdings Egoismus, Eigennutz, Gier, Dummheit und andere negative Persönlichkeitsmerkmale nicht miteinbezogen – da ich dachte, diese würden sich zumeist im Rahmen halten. Stattdessen suchte ich die Schuld bei mir selbst. Ich dachte, wenn Menschen unfreundlich auf mich reagierten, läge es ausnahmslos an mir.
Wie man in den Wald hineinruft, hallt es zurück. Dieses Sprichwort hatte ich gegen mich gewendet, hatte mich geändert, mich freundlicher und nochmals freundlicher verhalten – und ich wurde noch weniger akzeptiert, noch mehr belächelt, ignoriert, ausgenutzt.
Ja, meine Metamorphose hatte lange angedauert. Doch nun stand da eine andere Sara. Eine, die sich nicht mehr belügen ließ.
Es war ein schmerzhafter Prozess gewesen – und manchmal fühlte ich mich erst recht schuldig, nun wie all die anderen asozialen, verkommenen, emotionslosen, nutzlosen Menschen geworden zu sein. Nichtsdestoweniger hatte ich einen Erfolg vorzuweisen: Niemand mehr hatte mich verletzt.
Und daran würde sich auch in Zukunft nichts ändern! Selbst wenn ich für den Rest meines erbärmlichen Lebens alleine bleiben musste!
Ich strich mir das Haar zurück und wandte mich der Küchenanrichte zu. Aus dem oberen Schrank holte ich ein Dinkelweckerl hervor, brach es entzwei und legte es zum Austrocknen auf die Heizung. Anschließend kredenzte ich mir gebratene Hühnerfleischstreifen auf gemischtem Blattsalat verfeinert mit Tomaten und Radieschen.
Ich liebte es, frisch zu kochen. Das Empfinden etwas zu kreieren, ließ mich den Aufwand gerne vergessen – zumal Fertiggerichte mir nicht sonderlich schmeckten und ich davon Hautunreinheiten und Bauchkrämpfe bekam.
Besonders gerne mochte ich Hühnerfleisch in Kombination mit Brokkoli, Rosenkohl oder Blattspinat mit Zitronensaft. Teigwaren, Obst und Pilze sagten mir ebenfalls sehr zu. Und süße Nachspeisen sowieso. Was mir überhaupt nicht schmeckte, waren Innereien, Kren, Spargel, Schweinefleisch und Hülsenfrüchte. Ausnahmen bildeten Leberstreichwurst, Frankfurter Würstel und zartgeräucherter Schinken.
Nach Essen und Abwasch nahm ich mein neu gekauftes Taschenbuch – ein Spionagethriller – zur Hand und setzte mich auf meine zwar neuwertige nichtsdestotrotz ungemütliche hellgraue Couch. Sie war zwei Meter lang, hart wie Beton und obendrauf rau wie Schurwolle. Ursprünglich hatte ich sie entsorgen wollen. Leider Gottes kannte ich niemanden, der mir beim Hinuntertragen dieses sperrigen Dings vom zweiten Stock ins Erdgeschoss geholfen hätte. Ferner wollte ich kein Geld für eine andere Sitzgelegenheit ausgeben. So hatte ich mich erzwungenermaßen dazu entschlossen, sie zu behalten.
Solche Momente erinnerten mich daran, dass ich nicht alles alleine bewerkstelligen konnte – gleichgültig, wie sehr ich es wollte oder wie viele Belange des Lebens ich bislang erfolgreich selbst geregelt hatte.
Wie dem auch sei – jammern brachte mich nicht weiter. Ich musste froh sein, eine Couch zu besitzen. Andere Menschen hatten nicht einmal das!
Obwohl ich mir dieser Tatsache vollauf bewusst war, gelang es mir nicht, diesen bitteren Beigeschmack der Verleugnung loszuwerden.
War es in Ordnung, angesichts meiner Einsamkeit mir durchgehend Ausreden zu suchen, um Positivität und irgendeinen Sinn in mein Leben zu bringen?
Jahrelang hatte ich nicht einmal bemerkt, dies ständig zu tun. Ich hatte all meine Wünsche und Sehnsüchte verdrängt, mich ausnahmslos auf den Alltag konzentriert, gegen auftretende Panikattacken gekämpft und sämtlichen Problemen aus dem Weg zu gehen versucht.
Stellte dies das Leben dar? Sich tagtäglich zu fürchten, zu bangen – und letztendlich Dankbarkeit zu empfinden, zumindest auf frisches warmes Wasser Zugriff zu haben und in einem kuscheligen Bett schlafen zu dürfen? Lebten sämtliche Menschen in diesem Land auf dieselbe Weise?
Aber … weswegen jammerten sie alle über jede unbedeutende Kleinigkeit: Das Wetter, den Ehepartner, die Kinder, die Arbeit, den Urlaub, das Auto, die Wohnung?
Falls sie ebenfalls dankbar und überdies gesundheitlich oder mental relativ stark waren … weshalb mussten diese Leute zetern?
Ich verdrängte die Gedanken und erfreute mich lieber an meiner Freiheit, tun und lassen zu können, was ich wollte.
Denn eines war klar: Solange ich allein lebte, brauchte ich keine Kompromisse einzugehen. Ich war frei, musste mich auf niemanden einstellen oder Rücksicht nehmen.
Lediglich dieses mich folternde Verlangen nach körperlicher wie gefühlsmäßiger Nähe, Geborgenheit, einem Zuhause … dies brachte mich allmählich um.
Wie üblich erwachte ich Montag morgen relativ ausgeruht und gestärkt. Diese Energie nutzte ich, um in der Arbeit sämtliche schwierigen Aufgaben zuerst abzuarbeiten. Zwar tauchten komplizierte oder anstrengende Tätigkeiten logischerweise ebenfalls an allen anderen Wochentagen auf, allerdings musste ich mich dann nicht unbedingt einen kompletten Vor- oder Nachmittag mit komplexen Themen herumquälen, sondern durfte mir mentale Pausen durch leichte Obliegenheiten zwischenschieben.
Als Webseitenbetreuer eines kleinen Online-Shops fielen großteils knifflige oder lästige Probleme an. Da ich überdies für den Kundensupport zuständig war, läutete meistens durchgehend das Telefon und wurde mein Mail-Account mit Dummies-Anfragen überschwemmt.
Der überwiegende Teil meiner Anfragen fiel in die Kategorien irrtümliche Bestellungen, Einloggschwierigkeiten aufgrund vergessener Passwörter sowie Unzufriedenheit mit der Paketzustellung.
Obwohl Telefonate und Kundenanfragen mich ziemlich nervten, mochte ich meine Arbeit. Ich hatte ein Büro für mich allein, durfte mir meinen Alltag zumeist frei einteilen und die Bezahlung war ebenfalls in Ordnung.
Meine halbstündige Mittagspause verbrachte ich gern in einem nahe gelegenen überschaubaren Park. Auf einer schmiedeeisernen Bank, welche das gesamte Jahr über unter einer zwanzig Meter hohen Linde stand, aß ich mein Pausenbrot und fütterte nebenbei die Tauben.
Ja, im Winter war es eisig kalt. Dennoch zwang ich mich hierher. Ein wenig Frischluft war wichtig und Abhärtung zugleich. Außerdem liebte ich es, die Vögel zu beobachten. Wie sie frech nach meinen getrockneten Brotkrumen pickten und geschäftig hin- und herstolzierten. Und das niedliche Gurren erst! Ein wenig erinnerte es mich an das Schnurren einer zufriedenen Katze.
Eben wollte ich mich von der Bank erheben, da bemerkte ich, wie ein schlanker Mann auf der gegenüberliegenden Straßenseite in eine schmale Gasse trat.
Tom, hallte es mir unwillkürlich durch meinen Geist. Und unmittelbar danach fragte ich mich, was mit meinem Verstand nicht stimmte.
Von dieser Distanz aus war es mir unmöglich zu sagen, wer dort herum irrte. Bedeutend lachhafter war es anzunehmen, es wäre Tom gewesen, wo ich nicht einmal seine Haarfarbe oder sein Alltagsoutfit kannte! Und überhaupt: Weshalb kam mir dieser Mann fortwährend in den Sinn?
Herrschaftszeiten!
Ich steckte die Hände in die Manteltaschen und eilte los.
Um halb fünf verließ ich das Büro und fuhr nach Hause. Erschöpft und ausgebrannt fühlte ich mich, weshalb ich mich sofort unter eine kochend heiße Dusche stellte. Danach schlüpfte ich in meinen übergroßen, schneeweißen Bademantel, belegte mir ein Brötchen mit Kantwurst, schlang dieses hinunter und kuschelte mich ins Bett.
Meine Schwäche nervte mich. Normalerweise müsste ich voller Energie sein. Schließlich leistete ich keine Akkordarbeit, ebenso wenig musste ich Lieferungen auspacken oder am Bau ackern. Trotzdem quälte ich mich immer wieder mit immensen Erschöpfungszuständen herum – seit meiner Schulzeit.
An einem Vitaminmangel litt ich jedenfalls nicht. Dies hatte ich erst vor Kurzem austesten lassen. Womöglich sollte ich mich sportlich betätigen? Ein Aufbautraining? Oder schlichtweg jeden Tag lange Spaziergänge unternehmen? Verkehrt war es sicherlich nicht …
Auf der anderen Seite war ich zu schwach, um nach der anstrengenden Büroarbeit überdies körperlich Leistung zu erbringen.
Leichter wäre es, mit einem Zwanzig- oder Dreißigstundenjob. Finanziell konnte ich mir einen solchen Luxus aber leider nicht leisten.
Wäre dies mit einem Partner möglich?
Ach, verdammt!
Wozu über etwas nachgrübeln, das ohnehin in unerreichbarer Ferne lag?
Die restliche Woche verlief ruhig und unspektakulär. Ich erledigte meinen Job, erholte mich von den Strapazen und unterdrückte lästige wiederkehrende Gedankenspiele über Tom und unser Gespräch.
Ich kapierte nicht, weshalb ich diesen Menschen nicht mehr vergessen konnte – Aussehen hin oder her. Er war ein niemand. Ich würde ihn niemals mehr wiedersehen. Punkt. Aus. Fertig.
Darüber hinaus wollte ich nichts mit Musikern zu schaffen haben. Natürlich waren nicht alle davon notorische Fremdgeher oder egozentrische, alkoholabhängige Exzentriker. Künstler blieb trotzdem Künstler – womit Konflikte ausgelöst durch verschrobene Persönlichkeitsmerkmale unvermeidbar waren.
Stopp.
Was, zur verfluchten Hölle, dachte ich da?
Ich wollte keine Beziehung mit ihm. Ich kannte diesen Typ doch gar nicht!
Offenbar war ich verzweifelter, als ich es mir selbst eingestand …