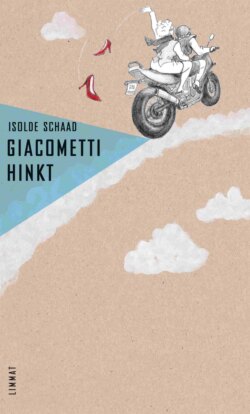Читать книгу Giacometti hinkt - Isolde Schaad - Страница 5
Losgeworden. Los geworden
ОглавлениеDa stehen sie, Wiedergänger eines Jahrhunderts, dessen Hauptwort Vernichtung war. Was tun sie hier? Militärschuhe vor dem Küchenblock aus Chromstahl, auf Jadeschiefer, dem coolen Bodenbelag in der neulich erworbenen Eigentumswohnung, die sie mit Uwe teilt, eine Faust aufs Auge ist das. Der Aktivdienst, aus dem solche Schuhe stammen, hat auf Jadeschiefer nichts zu suchen, nobler Schiefer verträgt keinen Schandfleck. Sie hat Uwe den heiklen Bodenbelag abringen müssen, das ist harte Arbeit gewesen.
Der blosse Anblick kommt im Befehlston daher. Sie hört den Tritt mit. Immerhin keine Springerstiefel, das nicht. Helen nimmt einen der zwei hartgegerbten Klumpen in die Hand, spuckt darauf, bevor sie den Lappen ergreift und leicht reibt, dann lässt sie den Fremdkörper wieder sinken. Schuhe wie Bollwerke, Angriff und Verteidigung. Schuhe, die in den Krieg aufbrechen, wollen keine Pflege, sie haben anderes vor, und deshalb muss man sie so rasch als möglich entsorgen.
Dass der Aktivdienst, diese Stammtischfloskel selbstgerechter alter Männer, endgültig vergangen sei – Helen legt den Kopf in Schräglage –, leider ist das eine Wunschvorstellung einer künftigen IKRK-Delegierten, von der Uwe noch nichts weiss.
Wenn sie Anatomie büffelt, deren Grundbegriffe für das Aufnahmeverfahren notwendig sind, schliesst sie die Tür zu ihrem Zimmer.
Aber die alten Männer, die damals junge Männer waren, konnten doch nichts dafür, dass sie einrücken mussten, raunt das Alter Ego, doch Helen wischt den Störenfried mit einer Handbewegung fort. Die Generation der Vorvorväter hat diese Schuhe an die Füsse ihrer Armeen diktiert, und die Väter mussten sie dann auf die Zielgerade setzen, eine Strategie als Vermächtnis des konventionellen Krieges nach Clausewitz. Davon will doch heute niemand mehr etwas wissen, nicht mal der bauernschlaue oberste Soldat im Bundesrat.
Mach dir nichts vor, Helen, raunt das Alter Ego. Wer regelmässig die «Tagesschau» konsultiert, weiss, dass dieser Krieg bloss verlagert wurde. Auf den Trikont. Dorthin, wo die Söhne der ehemaligen Untertanen der Kolonialmächte diese wüste Epoche Europas an den Füssen mitschleppen. Alle paar Jahre treten sie erneut in Aktion, etwa auf einer Hochebene Afghanistans, in einer Steppe des Iraks und jetzt in Aleppo, Homs und Mossul und weiteren Brandherden des Nahen Ostens.
Was fand Uwe bloss an diesen Schuhen. Man konnte mit ihnen lediglich marschieren, nichts anderes als marschieren, weder bummeln noch flanieren, schon gar nicht spazieren. Im letzten Jahrzehnt des letzten Jahrhunderts war dieses kriegerische Relikt nach Europa zurückgekehrt, in den Balkankrieg. Es war ein Schock gewesen, als der grüne Joschka, ausgerechnet der ehemalige Friedensaktivist, als deutscher Aussenminister mit den Wölfen heulte, die zum Bombardement bliesen. Mit den Franzosen, den Engländern und den Amerikanern. Mit flotten Grüssen aus Sarajewo.
Mit dem Krieg spielt man nicht, hatte Mutter gesagt, als die Zinnsoldaten aus der Kaserne stolzierten, das Lieblingsspiel ihres kleinen Bruders, wenn er bei den Grosseltern zu Besuch war, zu Hause war das verpönt. Mutter war eine Reformpädagogin, daher gab’s daheim ausschliesslich reformpädagogisch korrektes Spielzeug, Baukasten, Puzzles, Memory und Kügelibahn aus Holz. Als sei Holz das Gute an sich.
Feige, du bist feige, wenn du nicht fragst, wo warst du, Adam. In etwa so hatte sie Heinrich Böll als Teenager gelesen; freilich war Uwe noch lange nicht geboren, als sein Vater einrücken musste. In die Wehrmacht? Oder war’s gar die berüchtigte Waffen-SS?
Helen schreckt aus einem düsteren Tagtraum. Bloss weil Uwe, ihr Mann, mit dem sie nicht verheiratet ist, Militärschuhe vom Estrich geholt hat? Er wollte in ihnen nämlich die Greina überqueren. Die Wanderung war für den kommenden Sonntag vorgesehen. Sie hat ihn nie nach der Herkunft dieser Schuhe gefragt, und jetzt fiel ihr wie Patronen von den Augen, dass sie nichts von Uwes Vorgeschichte wusste, gar nichts.
Noch immer starrt Helen auf dieses Stück Wehrhaftigkeit, mit der sie auf keinen Fall unterwegs sein will. Sie packt die Schuhe, öffnet eine Türe und schleudert die im Grunde redliche Hässlichkeit in den Stauraum, ein befreiender Akt.
Helen dann im Wohnraum am langen Glastisch, barfuss auf Jadeschiefer, das tut gut, wenn man ratlos ist. Mit den Fusssohlen die Unruhe wegscheuern, das hilft. Sie stützt die Ellbogen auf und verschränkt die Hände über der Stirn. Bisher war das kein Thema gewesen, nicht der geringste Konfliktstoff zwischen ihnen. Dass Uwe Deutscher war.
Er würde sie auslachen, du ins IKRK? Dafür bist du doch viel zu alt, mein Schatz. Und sie würde trotzig erwidern, dann wird sich zeigen, ob diese vielgepriesene Jugendlichkeit, die mir dauernd attestiert wird, etwas taugt. Sie ging in ihr Zimmer, nahm das Fotoalbum aus dem Regal. War wieder das kleine Mädchen, das diese Schuhe im Korridor des Elternhauses stehen sah und entsetzt rief: Paps, musst du in den Krieg? Uwes Schuhe sahen genau so aus wie jenes Paar, das die Mutter am Vortag einfettete, wenn der Vater einrücken musste. Nein nein, Paps muss bloss zur Inspektion. Beschwichtigte sie, um das Kind zu beruhigen, das nachts aus dem Schlaf aufschreckte und schrie, weil es die Kriegsbilder aus dem Nachbarland hatte sehen wollen. In einer Mappe, die ein ausländischer Besuch hinterlassen hatte, es waren scharf konturierte Schwarz-Weiss-Fotos. Während die Siebenjährige die deutsche Katastrophe betrachtete, lief im Radio Ravels «Bolero». Seither konnte Helen diese Musik nicht mehr hören, ohne dass Ruinenstädte auftauchten, finstere Bauten hinter Stacheldraht, Wachtürme und stehende Waggons, vor welchen Häftlinge herumfuhrwerkten, wozu, war ihr schleierhaft. Im Nachhinein staunte sie über ihre Mutter, die Reformpädagogin, die keine Zinnsoldaten als Spielzeug duldete, wohl aber den Anblick dessen, was man kleinlaut als Zivilisationsbruch bezeichnet hat: die Vernichtungsmaschinerie des Naziregimes. Helen dachte mit Wärme an sie, die seit langem tot war. Sie war eine mutige Frau gewesen, vollkommen unsentimental in der Erziehung, hatte ihre Kinder früh konfrontiert mit den Greueltaten, zu welchen Menschen fähig sind. Du kannst mich immer fragen, wenn du etwas auf dem Herzen hast, Helen hat diesen Satz noch im Ohr. Aber die Erstklässlerin fragte nicht. Es gab zu diesen Bildern, hinter welchem sie das Schlimmste witterte, keine Fragen, ausgenommen die eine, unbeantwortbare: Warum?
Der Krieg hat ein Medusenhaupt, und jedem angeblichen Friedensvertrag wachsen ein paar neue Kriege aus dem abgehauenen Stumpf. In Den Haag, am Internationalen Strafgerichtshof, behaupteten die Kriegsverbrecher vom Balkan, jene wenigen, die man endlich hatte fassen und zur Verantwortung ziehen können, sie wüssten von nichts, das seien Hirngespinste des ehemaligen Feindes, ausserdem hätte man sich doch längst versöhnt.
Die Wahrheit stirbt zuerst, eine Binsenweisheit im Krieg oder in der Politik, seiner Vorläuferin. Das weiss sie jetzt bis ins Knochenmark, wenn sie in der Session sitzt, vor sich das heroische, dabei grandios unschuldige Panorama, genannt die Wiege der Eidgenossenschaft. Es ist ein harmloses Landschaftsgemälde vom Urnersee, das von einem Maler namens Charles Giron stammt. Eingelassen in eine heimelige Täfelung aus Holz, und Holz das Gute an sich.
Seit bald einem Jahr ist sie Nationalrätin, eigentlich aus Versehen, sie fühlte sich zur Annahme des Mandates gedrängt. Politik war schmerzhafter, als sie geahnt hatte. Das Haupthandwerk der Parteien bestand im Uminterpretieren einer Tatsache in ihr Gegenteil, das war die übliche Methode, wenn die Sachgeschäfte aufs Tapet kamen, die vorher theoretisch untermauert worden waren. Sachzwang war auch so ein Wischiwaschiwort, das jede Lüge rechtfertigen musste unter der Himmelskuppel der vereinigten Nationalversammlung. Was man unter sich abgesprochen hatte, vorher, in den unzähligen Kommissionssitzungen, war im Sessionssaal auf einmal nichts mehr wert. Wurde nicht verfochten, ja, es war, als hätte man gar nie davon gesprochen. Sie war empört, damit hatte sie dann doch nicht gerechnet, und nach vier Jahren würde sie genug gehabt haben von diesen Füllhörnern der Heuchelei. So reifte der Entschluss, mit eigenen Augen zu sehen, was vor Ort ablief.
Als Uwe nach Hause kam, war die erste Frage, Helen, wo sind meine Bergschuhe?
Sie liess sich Zeit für die Antwort, sie sollte kein Stimmungskiller sein. Aber die Ungeduld in ihr preschte vor.
Uwe, sie sind scheusslich! Ich kaufe dir bequeme Wanderschuhe, die etwas taugen. Dafür nehme ich mir einen freien Tag.
Ach woher, diese Schuhe sind praktisch und solide, sozusagen untilgbar.
Eben, das ist es ja.
Er schüttelte den Kopf, er war irritiert.
Du sprichst in Rätseln.
Weisst du, sagte sie hastig, der Krieg, sie erinnern mich an den Krieg.
Ach du liebes bisschen, rief Uwe erleichtert, ihr Schweizer wisst doch gar nicht, was Krieg ist. Und auch ich kann nicht behaupten, es zu wissen, dafür bin ich nicht alt genug.
Das war vor einem Monat gewesen, Ende August. Uwe hatte sich nicht umstimmen lassen und war in seinen Militärschuhen über die Greina geprescht. Lass mich vorangehen, so verschonst du mich wenigstens vom Anblick deines Militärlooks. Ach Helen, er schüttelte erneut den Kopf, ihre Umstandskrämerei mit seinen Schuhen versteht er nicht. Die Wanderung war fast wortlos verlaufen: Wenn man die Greina in zwei Tagen bewältigen will, ist sie zu anstrengend für einen Disput. In der berühmten Bergeinöde walten die Kräfte der Natur; sie sind vordergründig, und man muss sich konzentrieren, wenn man nicht stolpern will oder sich das Knie verrenken. Sie hatten ihre besten Jahre hinter sich.
Der Zweite Weltkrieg ist niemals zu Ende, sagte sie jetzt und rührte gedankenverloren in ihrer leeren Kaffeetasse. Der Mann blickte sie prüfend an, so, als müsste er ihr Gesicht skizzieren.
Der Zweite Weltkrieg macht Station auf der ganzen Welt.
Wie meinst du das?
Sagen wir mal so: Die Ukrainer wollen ihre Rechte, die Tschetschenen desgleichen, die Armenier und die Kurden sowieso. Überall müssen die Kleinen sich die Hände schmutzig machen und einen Hinterhofkrieg gegen eine Grossmacht führen. Und das sind nur die alten Fehden auf unserm ausgebufften Kontinent, von den akuten Brandherden im Nahen Osten und Übersee nicht zu reden.
Das sind doch alles Interessenskonflikte aufgrund der ungleichen Ressourcen, das kann man doch nicht mit dem Zweiten Weltkrieg kurzschliessen.
Doch, doch, kann man. Es sind nämlich immer die gleichen Schuhe, die ausrücken, um die blühenden Zivilisationen in Sumpf und Schutt zu stampfen. Wenn diese Schuhe nicht wären, könnte es besser bestellt sein auf dieser Welt.
Sie rutschte auf dem Stuhl hin und her.
Wenn die Krieger von heute Sandalen trügen wie damals in der Antike, in Antiochia oder auf den Feldzügen des Perseus, dann wäre mir wohler. In Sandalen wäre der Krieg vermutlich menschlicher.
Du phantasierst, sagte der Mann hinter der Zeitung, der moderne Krieg hat andere Methoden, er geht nicht mehr zu Fuss.
Oh doch, das ist ja das Monströse, er geht in denselben Schuhen, wenn er Minderheiten bekämpfen und um ihr Recht und ihr Land bringen will. In Tat und Wahrheit will er sie beseitigen, krass gesagt ausrotten, das ist das grosse Tabu im Parlament. Das wird spürbar, wenn’s wieder mal um die Waffenausfuhr geht. Die Minderheiten sind leider oft die Initialzündung, wenn ein Weltkrieg beginnt. Das heisst, wenn er in einer anderen Weltgegend aufflammt, denn er hat ja gar nie aufgehört. Palästina brauch ich wohl nicht speziell zu erwähnen.
Helen, willst du wirklich darüber reden, jetzt?
Sie seufzte und schwieg.
Komm schon, du vergisst den Arabischen Frühling, es gab, trotz aller Rückschläge, Fortschritte vor Ort.
Der Arabische Frühling war eine Revolte und kein Krieg.
Uwe näselte und erhob sich. Frau Professor, soll ich uns noch einen Kaffee machen, ist dir das recht?
Sie nickte. Und versank in Gedanken. Einst waren wir glühende Israelfans und dachten, so ein Kibbuz sei das bessere Pfadfinderlager. Das sagte sie laut, und er lachte, das wollte ich auch. Die gesamte Nachkriegsgeneration wollte nach Israel, um sich gross und gut zu fühlen. Uwe setzte sich, stellte die Kaffeetasse auf den Tisch und schaute ihr geradewegs in die Augen.
Ist was los?
Sie schüttelte den Kopf. Sie hat verdrängt, dass Uwe vier Jahre jünger ist als sie, also vier Jahre unbeschwerter von einer sagenhaften Kindheit. Uwe war gut drauf, wie die Heutigen sagen. Uns Studenten machte die Haganah, eine der beiden zionistischen Untergrundorganisationen, grossen Eindruck. Es ist, als sei das Heldentum dort drüben wiederauferstanden, wenn du dir die Siedler in den besetzten Gebieten anhörst.
Sie nahm einen tiefen Schnauf. Yes dear, die Nationalkonservativen sind gross in Fahrt. Sie benehmen sich wie die von der Weltregierung gesandten Vollstrecker des Bibelworts. Wie jener Ari Ben Kanaan aus dem Schmöker «Exodus». Ein Rassist, dieser Leon Uris, vor allem in seinen Afrikabüchern, bloss haben wir das damals nicht gemerkt.
Nun kam das Thema also auf den Tisch, in einem schändlich lockeren Ton, der sie verdross, immerhin würde sie so Mumm bekommen, das heisse Eisen zu packen. Sie nach Syrien, das würde etwas absetzen, obschon ihr Gefährte ein friedlicher Mensch war.
Uwe war guter Dinge, weil seinem Gesuch stattgegeben worden und die Beiträge für sein Forschungsprojekt an der ETH erhöht würden. Geht klar, hatte er gestern lakonisch gesagt, als sie sich danach erkundigte. Er pfiff einen Song aus den Anfängen ihrer Geschichte, nahm sie in die Arme und setzte zum Tanz an. So etwas war lange nicht mehr vorgefallen, schon gar nicht im dürren Alltag der ehemaligen Mietwohnung. Offenbar fühlte sich Uwe freier in Beton und Glas mit fashionabler Aussicht. Die fürstlich bemessene Terrasse hatten sie allerdings noch nicht eingeweiht.
Später goss sie sich statt Kaffee ein Glas Orangensaft ein, Vitaminspender, um den Disput zu eröffnen, der eintreten würde, wenn sie losplatzte: Uwe, ich werde nach Syrien gehen. Aber dann schwieg sie doch: erst denken, dann sprechen. Vorher musste sie den Argumentationskatalog bereithalten, ihn repetieren. Sie wolle etwas mitbekommen, wissen, was hinter den Mauern der offiziellen Verlautbarung abgehe. Selber sehen, was an Assads unglaublichem Zermürbungsterror dran sei, von dem man ausschliesslich Bilder des Grauens aufgetischt bekomme. Sie halte es für ihre Pflicht als Politikerin, die Orte des Schreckens zu besichtigen.
Und dann würde sie im Rat ein Projekt zum Wiederaufbau von Palmyra starten. Ihr Palmyra in Scherben, der alte Reisetraum verpufft.
Uwe raschelte mit der Zeitung, dieses Rascheln war heilig am Samstagmorgen. Es ging weniger um den Inhalt der Lektüre als um das Ritual. Und sie? Nervös klopfte sie mit dem Löffel an das Wasserglas.
Jetzt muss es raus.
Dieses Kriegen hört nie auf, solange es mit diesen entsetzlichen Schuhen einrückt. Sie räusperte sich, dann wisperte sie. Uwe machte keine Miene, von der Zeitung aufzublicken.
Wo doch die Deutschen, ausgerechnet die Deutschen, ihre Stimme erstarb. Nun sandte der Mann gegenüber einen erbarmungslosen Blick über den Blattrand.
Die Deutschen sind vorbildlich in Sachen Vergangenheitsbewältigung, wenn ich mir so eine gewagte These erlauben darf, meinte er freundlich und liess die Zeitung sinken.
Ja, dachte sie. Das stimmt. Weil die sieben Gerechten, die überall auftauchen, wo es etwas aufzuarbeiten gibt, dafür sorgen, dass keine Schandtat der Vergangenheit unangeprangert bleibt, während die Verbrechen der Gegenwart kein Thema für sie sind.
Sie hütete sich, den Satz, der ihr auf den Lippen lag, auszusprechen.
Das mag sein, sagte sie matt, doch die Gegenwartsbewältigung ist wohl ein anderes Kapitel.
Eine Schweizerin sollte den Mund nicht zu voll nehmen, was den Zweiten Weltkrieg angeht.
Die Feststellung kam ohne Aggression über den Frühstückstisch. Uwe war ein aufmerksamer, ein wohlwollender Partner, obschon er den vollen Müllsack auf dem Treppenabsatz meistens vergass. Doch nun empfand sie eine nie gekannte Entfremdung zwischen ihnen.
Ihr seid doch die Profiteure der Nazis gewesen.
Klar, sagte sie und schwieg.
Sie sah vor sich die lederne Sturheit an den Füssen blutjunger Grenadiere oder Infanteristen oder wie sagt man, dieser deutsche Militäreinsatz in Afghanistan hatte noch Flaum ums Kinn und muss doch das Erbe der Väter ausfechten. Mit dieser zähen deutschen Waffentreue an den Füssen durch Sümpfe waten, endlose Steppen durchmessen, in der Steinwüste marschieren, und hinter jedem Stein ein schiessender Taliban.
Dabei trug der Feind dieselbe Monstrosität von Schuhen, lag vielleicht darin das Problem?
Sie sollen verschwinden. Ich will sie nie mehr sehen. Das murmelte sie deutlich vor sich hin, und nun lächelte das Gegenüber: Du hast vergessen, dass die Alternativler und die Punks doch gerade solche Schuhe mögen. Auch die Dienstverweigerer tragen sie. Unzerstörbares Handwerk, Militärschuhe sind für die Ewigkeit gemacht.
Eben, das ist der Punkt. Deswegen hört das Töten nicht auf.
Gutes Kind, du bist naiv.
Meinetwegen.
Sie würde Uwes Militärschuhe ins Brockenhaus bringen. Ungefragt. Vor der nächsten Wanderung wird sie ihm samtene Waldläufer präsentieren. Die sind zwar weniger robust, aber ansehnlicher als sogenannte Qualitätswanderschuhe mit ihrem Anspruch auf Leistung. Qualitätswanderschuhe sehen nach Müssen aus, nach dem ewigen Muss zur Ertüchtigung. Gab es denn keine stilbewussten Schuhmacher oder wenigstens Pazifisten unter den Sportschuh-Designern?
Die Athletisierung der Füsse schreitet voran, trau, schau, wem. Helen hält sie für eine getarnte Militarisierung, die überall eindringt, in die Schulen, die Galerien, die Chefetagen, die Verwaltungen. Obenrum erscheint eine klassische Kostümschönheit und unten dann dieses mit buntem Patchwork aufgehübschte Vorwärts, Marsch, als sei man überall auf der Startbahn zur Direttissima.
Was das Mädchen Helen spürte, aber nicht hätte benennen können: Diese Schuhe waren Symbole einer ins Dunkel murmelnden Vergangenheit, da das Thema Naziherrschaft und Judenvernichtung an der deutschen Grenze zu Schaffhausen bis Anfang der Sechzigerjahre ein Raunen blieb. Es kam lediglich als Pro- oder Anti-Hitlertum zur Sprache, und das Bekenntnis dafür oder dagegen mündete in einen politischen Abnützungskampf zwischen den sogenannten Roten, angeführt von Nationalrat Walter Bringolf, und den braunen Fröntlern. Wohl verschwand da und dort ein Lehrbeauftragter, ein Professor von der Bildfläche, auch ein bekannter Theatermann wurde von der Bühne entfernt, doch die Gründe kannte niemand, der nicht in den entscheidenden Gremien sass, sodass der eigentliche Skandal nach dem 8. Mai 1945 ein von hoher Warte abgekartetes Stillhalteabkommen in Presse und Öffentlichkeit war. Auch an privaten Einladungen wurden bloss dumpfe Andeutungen gemacht. Wenn der Studienfreund von Helens Vater aus Düsseldorf zu Besuch kam, beteuerten die Eltern den Nachbarn und Bekannten gegenüber, dass dieser Deutsche ein guter Deutscher sei.
Die Antwort auf das Warum hat sie bis dato nicht erhalten, diese Helen Grossniklaus, Nationalrätin der Grünen, und die Schuhe motten im Schuhgestell vor sich hin. Dann hat sie die plötzliche Eingebung, die Schuhe würden auf dem Flohmarkt in die Allgemeinheit eingehen. Also trägt sie ihre Bürde in einer Fair-Trade-Tasche auf den Max-Frisch-Platz hinter dem Bahnhof Oerlikon, wo einmal im Monat alles zu haben ist, niemand mehr haben will. Sie stellt die Schuhe diskret auf einen Gartentisch, der offenbar Hinz und Kunz zu Gebote steht. Allerlei Gerümpel, Blumenvasen, Nippes und Stofftiere haben darauf Platz gefunden. Keine Verkaufsperson ist in Sicht, und so pirscht Helen durch medias res und stellt dabei fest, dass sie mit ihrer Definition des Flohmarkts falschliegt. Ein Flohmarkt ist vielmehr ein Sammelsurium von Vergeblichkeit, die für nützlich gehalten wird. Sie fühlt sich wie eine Strauchdiebin, als sie den Rundgang durch die Hügellandschaft von Häkeltäschchen, Pulswärmern, Hausschuhen und Wollsocken antritt, vorbei an Arsenalen von Kerzenständern, Serviettenhaltern und Kleiderbügeln, alle mit naturgefärbten Überzügen bedacht. Sie inspiziert das Eingemachte, Eingetopfte und Selbstgeknüpfte, benimmt sich wie eine Gutachterin angesichts der Flut von emsiger Eigenkreation, die offenbar nur sie für eine Verzweiflungstat hält. Die Leute hinterm Bahnhof Oerlikon greifen zu, wägen ab, vergleichen Jacke mit Hose, Rüben mit Kraut. Man schwelgt hier im Sog der in schöpferischer Hingabe gestrickten, umhäkelten, durchgefilzten, eingenähten Quasigebrauchsgegenstände, die der Selbstvergewisserung dienen. Nun denn, inmitten all des Feingesponnenen, Feinziselierten und Feingeknüpften benehmen sich Militärschuhe ziemlich drastisch. Wirken wie ein Angriff auf den häuslichen Goodwill, sodass Helen sich weiter umsieht, nach einem geeigneten Platz des von ihr geschmähten Corpus Delicti aus dem letzten Jahrhundert.
Ein Max-Frisch-Platz an diesem Ort ist Bedeutungsfledderei. Zwar belebt einmal im Monat eine betuliche Hausfraulichkeit diese Brache hinter den Geleisen, doch was für ein Hohn, den Schriftsteller zu ihrem Patron zu machen! Die Politikerin in Helen fragt sich, wessen Schnapsidee es gewesen war, eine städtebauliche Leerstelle, eine räumliche Pause ausgerechnet dem Vorzeigeautor der Stadt Zürich zu widmen. Zwar versucht man, sie mit einem ziemlich stilvollen Baukörper, parallel der Perrons geführt, einer Busstation anzugleichen, die aber niemand aufsucht. Und niemand bedient die von ihr beschirmten rostglänzenden Metallboxen, die man vergeblich für Billettautomaten hält. Helen schlendert den Rändern dieses Unorts entlang und denkt nach.
Wie wär’s, die Schuhe am Sonntag hier aufzustellen, auf Beton? Inmitten des harmlosen Nichts müssten sie auffallen und zusammen mit Frischs «Dienstbüchlein» ergäbe das immerhin einen politischen Eyecatcher.
Doch fragt sich, ob dieser dann eher als eine verfremdete Version von Kunst am Bau begriffen würde, respektvoll bestaunt statt abserviert.
Die Nationalrätin der Grünen sieht sich um: Wo der Bau fehlt, einfach Kunst, nichts als Kunst? Sie lacht sich ins Fäustchen, diese Helen, bevor sie auch diese Idee verwirft. Und mit zwei ledernen Ungetümen in der Hand zur nächsten Tramstation trottet.
Um sie anderntags beim Brunnen vor dem von Kastanien gesäumten Park ihres Wohnviertels zu postieren. Hier könnten sie einen Abnehmer finden. Aber nein, am nächsten Tag steht das Paar noch immer beim Brünnlein, das sorglos drauflos plätschert, als wüsste es nichts von der Not, Militärschuhe loszuwerden, und diese Not wird zur Plage, die Schuhe wiegen schwer und schwerer, sie sind ein moralisches Schwergewicht geworden.
Helen kramt wieder in den Fotoalben, da liegt alles kunterbunt in einem Karton, was hätte geordnet und eingeklebt werden sollen. Die Sicht auf die rege politische Vergangenheit hat ihre Vaterstadt dann bald verklärt und an Tischrunden popularisiert. Schliesslich verteidigte der Pater familias in den verabscheuten Schuhen das Vaterland. Ihr eigener war am Gegenufer des Rheins, im Hügelzug des Kohlfirst als Soldat der Fliegerabwehr postiert worden, wo er auch Pläne von der Abwehrstellung gegen die feindliche Luftflotte anzufertigen hatte. Militärschuhe dienten also grundsätzlich und ganz persönlich einem edlen Zweck, wenn man darin gegen die Hitlerbarbarei aufstand, in diesem Sinne lautete die Erzählung, wenn je die Rede darauf kam, freilich wurde sie niemals ausgedeutscht, während an den eidgenössischen Stammtischrunden die Saga vom Heldentum des tapferen Eidgenossen schon fast bilderbuchmässig kolportiert wurde, heruntergebetet. Nie bestätigt, nur gemunkelt wurde ferner über ein tragisches Ereignis, das dem Vater im Aktivdienst widerfahren sei. Dass er einen Flüchtling, der bei Diessenhofen über den Rhein geschwommen war, hatte an Land ziehen wollen, und dem schon fast Ertrinkenden, nach Atem Ringenden am Ufer seinen Karabiner als Rettungsstange hinhielt, doch der junge Mann sei vor seinen Augen erschossen worden. Legenden, Geschichten, Vermutungen, sie waren das Erinnerungsfutter der Nachgeborenen, die im nur langsam ausgeatmeten, stetig glimmenden Deutschenhass aufwuchsen. Denn eines war klar und konnte an den Stammtischen nicht genug betont werden: D’Schwobe: Die gesamtdeutschen Sauschwaben hatten diesen schrecklichen Krieg verschuldet, aus welchem das Tagebuch der Anne Frank als ein sprechendes Dokument aufgetaucht und in der Schule weitergereicht worden war, unter der Bank, denn man wusste, dass kein Lehrer darauf eingehen würde und die Antwort ein verschwommenes Das-versteht-ihr-noch-nicht sein würde, sollte jemand den Finger aufstrecken.
Für Anne hatte Helen beinahe schwesterliche Gefühle empfunden, und sie machte sich Gedanken darüber, was denn dieses Bergen-Belsen bedeutete, ein Ortsname, der ihrer wiederholten Lektüre des Tagebuchs ein abruptes Ende setzte. Das Fotoalbum mit dem Trümmerhaufen und den Häftlingen, die Kohle schaufelten, war wohl etwas ganz anderes, das nichts zu schaffen hatte mit dem lebendigen Alltag der Familie Frank im Versteck des holländischen Hinterhauses.
Oder doch? Die Mutter hätte sie gewiss fragen können, doch seltsamerweise hatte sich Helens Unerschrockenheit inzwischen aus dem Staub gemacht. Verzogen, verabschiedet, auf einmal war es peinlich, eine Sache anzugehen, von der man Ungeheures witterte. Sie war inzwischen zwölf geworden und genierte sich für die Damenbinden, die sie auf Geheiss der Mutter tragen sollte, weil das Blut den Oberschenkeln entlang rann, anlässlich der ersten Mens. Gleichzeitig fühlte sie etwas wie Stolz, dass sie nun eine Frau war, das hatte Mutter jedenfalls beteuert. Mit der Pubertät war die Scham eingekehrt, und wie man weiss, Scham macht verschwiegen. Vielleicht auch duckmäuserisch oder gar verlogen. Dachte sie jetzt.
Das Brockenhaus nahm die Schuhe nicht. Damit könnten wir Säle füllen, wissen Sie. Also wieder eingepackt, ins Velokörbchen und erneut ins Schuhgestell. Sie hatte Uwe nicht nach der Herkunft gefragt. Sie scheute eine Auseinandersetzung über die Verantwortung deutscher Nachgeborener. Sie war nicht befugt, über ein Thema zu reden, gar zu urteilen, das in keinster Weise auf dem Stück Folklore beruhte, die der Aktivdienst für helvetische Kriegskinder gewesen war. Schweizer Militärschuhe stammten aus einer Vergangenheit, die sich nur schleppend daran machte, in Geschichtsschreibung umgewandelt zu werden. Eine heftige Aufgabe, die Rolle dieser fragwürdigen Friedensinsel im Zweiten Weltkrieg aufzuarbeiten! Die mutigen unter den Journalisten und Historikern wurden mundtot gemacht, man verweigerte ihnen den Zugang zu den Dokumenten im Bundesarchiv, sie wurden der Kollaboration mit dem Bolschewismus verdächtigt, als Stalinisten verschrien, das war zur Zeit des Kalten Kriegs das übelste Vorurteil, das einer engagierten Nachwelt, die es genauer wissen wollte, entgegengebracht wurde. Der Bergier-Bericht, von der Linken und der Gewerkschaftsbewegung begrüsst, bald an höherer Warte schubladisiert, das heisst kaltgestellt. Die Analyse und Beurteilung der Verantwortung der Schweizer Behörden, die sich der Judenvernichtung mitschuldig gemacht hatten, wurde auf die lange Bank geschoben, Experten, die das Thema unverblümt anpackten, als Nestbeschmutzer denunziert. Jean-François Bergier, Zeithistoriker von Rang, Professor mit ausserordentlichen Meriten, der zum Leiter des Forschungsteams berufen worden war, starb wenige Jahre nach der Veröffentlichung des umfassenden und infolgedessen wenig schmeichelhaften Befundes, wohl auch aus Gram, dass die immense Arbeit ohne jede politische Konsequenz bleiben würde.
Es war am ersten schönen Frühlingstag acht Uhr morgens, Uwe hatte es eilig, Helen hatte frei.
Uwe, heute Abend gibt’s Kino, als Pflichtstoff, du als Filmlover musst dabei sein.
Was wird denn gegeben?
Die «Shoa» von Lanzmann, du weisst, der jüdische Franzose.
Uwe hielt ein, dann blähten sich seine Nüstern.
Sie wusste, was das hiess.
Das kannst du nicht im Ernst von mir verlangen.
Warum nicht?
Weil ich es satthabe, den Musterknaben der deutschen Vergangenheitsbewältigung zu spielen. Die Schweizer scheinen scharf auf so einen zu sein.
Hast du den Film denn gesehen?
Ist das ein Verhör? Ich wiederhole, ohne mich. Ich muss jetzt gehen.
Sie klingt flehend, was ihn noch madiger macht.
Uwe, es ist wichtig, wichtig für uns beide. Für unsere Beziehung.
Ach du liebe Unschuld, kleine behütete Schweizerinnen haben keine Ahnung.
Und er nahm Mantel und Mappe und verliess wortlos die Wohnung.
Der Gefährte kam nicht nach Hause. Er rief auch nicht an. An diesem Abend trank sie eine halbe Flasche Bordeaux und lallte, als ein fremder Mann namens Uwe um zwei Uhr nachts zu ihr in die Federn stieg.
Der Film war schwere Kost. Es stellte sich heraus: Sie war genau das, was Uwe ihr vorwarf, eine brave ahnungslose Schweizerin.
Lanzmann, der Autor, war der Mann, der Simone de Beauvoir verehrt, ja geliebt hatte, er begab sich auf fremdes Terrain, nach Ostdeutschland, nach Polen, nach Tschechien, ja, er schaffte es sogar, einen lange gesuchten ehemaligen Zeugen in den USA ausfindig zu machen. Es war ihm keine Reise zu mühselig, kein Gang zu unbequem, um den Ablauf der Vernichtungsmaschinerie in allen Details zu erforschen, die offenbar international ihre Schaltstellen hatte. Zu einer Zeit, als die Bundesrepublik sich kaum an das heranwagte, was diffus die deutsche Schuld hiess.
Sie hört Uwe fragen, sie führt einen stummen Dialog mit ihm.
Was gibt’s denn da zu sehen, Jahrzehnte danach?
Wär man neunmalgescheit, würde man es Ecce homo nennen. Folgendes, Uwe: Ein rundlicher unauffälliger Zeitgenosse unbestimmten Alters steht da auf den Leerflächen der Geschichte, auf den Stumpengeleisen der Abtransporte, an den Schaltstellen der Tilgung, auf denen kein Gras wachsen wollte, keins gewachsen war: Es sah nur so aus. Er steht da auf den Spuren des Namenlosen und sucht das Gespräch mit allen, die sich ihm stellen, den Ehemaligen, jetzt geduckte und gezeichnete Schergen, Kommandanten, Verräter, Mitwisser, lauter sogenannte kleine Leute, die die Befehle von oben ausführten, und im Hintergrund schliessen die Dörfler die Fenster, wenn wieder so ein rätselhafter Lastwagen, der von Uniformierten auf dem Dorfplatz deponiert worden ist, nach Sonnenuntergang ins Rütteln und Schütteln kommt. Wenn die Uniformierten dann eine Beige von vergasten Juden aus dem Laster karren, um sie an einem Abhang neben der Müllhalde zu verscharren, treten die Zaungäste, polnische Bauern, aus den Häusern, um das Spektakel mit dumpfer, ja stoischer Miene zu betrachten. Das ist das Schlimmste, dieses Glotzen aus dem Hintergrund, da kommen Helen die Tränen, und das Warum ist wieder da.
Der Bau der geplanten Konzentrationslager hatte sich offenbar verzögert, und so erhielt Helen auf unerbittliche Weise Anschauungsunterricht über jene verschwiegenen, unter den Tisch gekehrten Vorgänge hinter dem Horizont der deutschen Trümmerfelder: Sie fand keinen Schlaf nach der Visionierung von Lanzmanns «Shoa» und erkannte darin die hohe Wirksamkeit seiner Leistung.
Die Schuhe, das Anathema. Wohin damit? Vielleicht lassen sie sich auf dem Mäuerchen der gut frequentierten Kneipe bei der Bushaltestelle postieren? Asylbewerber und Sans Papiers tauchen neuerdings in der Gegend auf. Vor allem sind es buntbetuchte Eritreerinnen, die in Gruppen erscheinen und sich mit lautem Geplauder an der Strassenkreuzung einfinden. Am Samstag strömen bäuerliche Marktfahrer herbei, sodass sich das vom Quartierverein zaghaft verschönerte Zentrum mit Kundschaft füllt. Immerhin beschicken dann Gemüse- und Obstauslagen eine schräg abfallende städtebauliche Nullstelle, die einst voll guten Willens zum Platz erklärt worden ist.
Gelegentlich hält man auch hier so etwas wie einen Flohmarkt ab, die nächste Gelegenheit, die Helen abwartet. An diesem Samstag geht sie stracks zum ersten Stand, in jeder Hand einen Militärschuh. Die Eritreerinnen haben sich bereits eingefunden, die farbenprächtige Schar macht sich ans Prüfen der handfesten Artikel: solide Topflappen, gleissende Toaster, polierte Stabmixer und Ständerlampen aus den Fünfzigerjahren. Und siehe da, sogar ein intakter Felltornister hängt an einem Garderobenständer. Das passende Umfeld für Armeetaugliches, also stellt sie ihre Last zu Füssen des Hausrats, steckt einen Zettel mit der Aufforderung «Zum Mitnehmen» hinein. Dann macht sie sich dünn, denn sie fürchtet, eine Bekannte zu treffen, die zu laut «Hello, long not seen» rufen könnte, und sie wäre ertappt, beim illegalen Deponieren, das kann sie sich nicht leisten als Abgeordnete der Grünen. Also nichts wie weg.
Dann fällt ihr Blick auf den dunkelhäutigen Jungen, der dicht bei den Eritreerinnen steht und sich hinter der Grossgewachsenen unter ihnen duckt. Helen bleibt stehen und betrachtet ihn aus Distanz von der Weinlaube des nahen Restaurants. Ein Mischling, oje, verpöntes Wort, doch ihn ein afrikanisches Halbblut zu nennen, geht noch weniger. Seine Züge sind edel wie jene der Niloten, der Nilquellenanwohner, und sein sinnlicher Mund schürzt sich, als wolle er die versammelten Habseligkeiten küssen, die vor ihm ausgebreitet sind. Ein Junge im vorgerückten Schulalter, er dürfte elf oder zwölf Jahre alt sein, schwer zu schätzen bei einem Afrikanerkind, das in der Linie der Königin von Saba erschaffen scheint, sodass man ihn gern und gut zum Coverboy für Sammelaktionen küren könnte. Er ist heller als die anwesenden Eritreerinnen, hat aber pechschwarzes Haar. Schön wie der Morgentau ist der junge Fant, dessen mutmasslich weisser Vater sich wahrscheinlich aus dem Staub gemacht hat. Ach was, Helen, hör auf zu spintisieren. Sieh zu, dass der Pinkel deine Schuhe nimmt. Jetzt taucht er aus dem Schatten der Mutter, dieser hochgewachsenen Frau, einer Herrin ähnlich. Er steckt in einer modisch sportlichen Aufmachung, ein atmungsaktiver grellfarbiger Trainer schlottert um seinen schmalen Körper, wahrscheinlich eine mildtätige Spende der Caritas. Nun entdeckt er die Militärschuhe, kratzt sich den runden Schädel unterm Kraushaar, nimmt das linke Exemplar in die Hand, begutachtet es intensiv, während er den Zettel in die Tasche seines Trainers steckt.
Helen, in Deckung, applaudiert im Stillen und begibt sich auf den Heimweg. Als sie erneut nach dem Jungen späht, ist er nicht mehr in Sicht, während zwei der Eritreerinnen sich fröhlich schnatternd nach Hause aufgemacht haben, in ihrer Richtung. Die souveräne Hünin, die aus der Gruppe herausstach, schleppt die Ständerlampe mit sich.
Sie schlurfen, die meisten Migrantinnen schlurfen, sie tappen schwerfällig in ihren glitzernden Slippers einher, doch wirken sie unabhängiger als ihre Leidensgenossinnen. Vielleicht leiden sie gar nicht? Helen auf der anderen Strassenseite drosselt das Schritttempo. Denn die beiden gewandeten Frauen bleiben ständig stehen, um das erworbene Gut zu examinieren. Dabei müssten sie das Schlurfen, diese Gangart der Frustration, welche die Demut, ja, Unterordnung innerhalb des kategorischen Patriarchats ausdrückt, doch hinter sich gelassen haben. Manche Eritreerinnen sind emanzipiert, haben sich selbständig gemacht, vermutet Helen, und beschliesst, diese beiden näher kennenzulernen.
So, das wäre erledigt, sagt sie fast triumphierend zu Uwe, der sich in der Küche zu schaffen macht. Was denn?, fragt er arglos und streckt eine halb geschälte Karotte in die Luft. Helen fällt ihm um den Hals, wobei die Karotte auf den Boden rollt. Ich mag deine Zerstreutheit, sie hat uns schon oft gerettet. Sein Blick ist belustigt, als er sie sanft von sich streift, um sich zu bücken. Auf dem Herd brodelt Tomatensauce. Und ich mag deine Kapriolen, die uns die Langeweile vom Leibe halten.
Kapriolen? Ach wo, ich bin lediglich pragmatisch und setze meine Worte in die Tat um.
Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, ich weiss bloss, dass es um halb acht zu essen gibt, die liebe alte Leier aus meinem Ein-Menü-Repertoire.
Der Horizont hat sich gelichtet. Helen geht ihrer Wege, froh, ein Stück des fatalen zwanzigsten Jahrhunderts losgeworden zu sein. Uwe ist zwar nicht begeistert von seinen neuen Waldläufern, zu smart für ihn, nichts für robuste Unternehmungen, wendet er ein, doch hat er sich gefügt in die schäumende Aktivität seiner Frau, die jene Entscheide trifft, die ihm nicht wirklich wichtig sind. Er hütet sich, das auszusprechen, dankt ihr mit einem freundschaftlichen Tätscheln, das sie leicht irritiert abschüttelt, worauf das Tagwerk eines berufstätigen Paars ohne Kinder den gewohnten Fortgang nimmt. Morgenkuss, hastiges Frühstück, Abendkuss, ausgedehntes Nachtmahl mit folgendem Küchen-Cleaning, das sich in der neuen Küche sozusagen von selber erledigt, obschon der Mann sich sogar schwertut, einen Geschirrspüler zu füllen, was die Frau zu einem stoischen Seufzer verleitet. Sie dreht sich im Hamsterrad der Resignation, was das häusliche Job-sharing angeht. Zu viel Energie verpufft in diesem ewigen Abnützungskampf, den ihre Generation nicht lösen konnte.
Die Frau kocht meistens, nicht weil sie besonders gerne kocht, sondern weil sie früher zu Hause ist. Dann folgt die «Tagesschau», dann Lektüre, während Helen irgendwas zu erledigen hat, oft korrigiert sie noch Schulhefte, sie unterrichtet an zweieinhalb Tagen Französisch an einem Gymnasium. Er kann kein Französisch, und eigentlich interessiert ihn französische Politik kaum, was Helen immer wieder von neuem anmahnt, wir sind doch Europäer, Uwe. Aber Uwe hat keine Ohren für das Französische, diese Sprache liege ihm nicht. Ausserdem habe er keine Zeit für etwas anderes, jetzt, da sein Projekt endlich ankomme und gut aufgestellt sei. Uwe ist Biochemiker und entwickelt eine Getreidesorte für aride Zonen, sie soll sogar im Sahel spriessen, da der Wasserhaushalt sich selbst reguliere, sagt er, durch eine Kombination stabiler Aminosäuren, deren Zellstruktur innerosmotisch wirke.
Aha, innerosmotisch, meinte Helen letzthin, etwas mehr Innerosmose könnten wir zu Hause auch brauchen, sie erwartet, dass er über ihre Anspielung lacht, aber nein, nach einer Weile taucht er mit verständnislosem Blick aus seinem inneren Laborwinkel auf und fragt wie üblich: Ist was los?
Er fährt halt mega ab auf sein Projekt, sagt seine blutjunge Assistentin, wenn sich Helen ausnahmsweise am Telefon nach ihm erkundigt. Also brütet er nach Feierabend weiter über den Bedingungen einer erfolgreichen Zellteilung seiner Protozoenzucht. Er brütet wo auch immer, auf dem Lokus, in der Garage, beim Zähneputzen, sogar im Kino, sodass Helen unterlässt, mit ihm den Film zu diskutieren, was sie dann doch verdriesst. Es scheint, dass das Imago seiner Saat bereits aufgeht und über die Netzhaut seines inneren Auges flimmert. Es macht ihn happy, wenn der Grossbildschirm im Livingroom der Wissenschaft die Zukunft signalisiert. Triumphal! Dort steht nämlich in fluoreszierender Leuchtschrift: «Biochemiker der ETH löst das Welthungerproblem».
Dabei ist er doch genügsam, und eigentlich bescheiden. Ein bescheidener Egozentriker. Helen hat es aufgegeben, im Detail nachzufragen, obschon sie sein Projekt grundsätzlich interessiert. Zur Zeit gewährt der Gespons keinen Einblick in das Verlies seiner Laborbesessenheit.
Er murmelt im Schlaf, die Protozoen tuckern durch seine Träume, oder sind das etwa Frauenschenkel? Oder die Möse seiner Labormaus? Und wenn sie ihre Phantasien dann ins Eigenleben lotsen will und im Bett mehr möchte als den obligaten Gutenachtkuss, erfüllt der Mann an ihrer Seite die quasi eheliche Pflicht, der er etwas träge und ohne Begeisterung nachkommt. Nun ja, das innere Seufzen weiss ja gut genug, dass die Zeiten des wilden Begehrens over sind, over, sagen die Jungen, auch die junge Assistentin, als sie einmal eine Liste mit Helens Fragen erstellt hat. Over, die Fragen werden ihm morgen unterbreitet, dem Chef. Nie mehr wird Helen im Verlies der Labormaus anrufen, nie mehr, schwört sie im Stillen. Und sie hält sich dran. Over, and easy, ja, wenn’s doch so wäre, wie die Jungen sungen. So wenig Zeit für sie und ihre Anliegen hat er noch nie gehabt, da muss ausser seiner Labormaus, die sie nicht ernsthaft bedroht, eine weitere Frau im Spiel sein. Könnte, denn sie glaubt nicht im Ernst, dass Uwe fremdgeht, ohne mindestens eine Andeutung zu machen. Und wenn es wichtig ist, wird er sie ins Bild setzen. Dieses eine nämlich haben sie sich gelobt, Transparenz in der Beziehung. Damals, als sie fanden, Ringe würden nicht getauscht, Ringe seien Fesseln. Seither lautet die Devise des geprüften Paars: kein Spitzeltum, keine Handykontrolle, Privatsphäre gestattet, sonst hältst du es zu zweit allein nicht aus.
Höchste Zeit, ihn in ihre Pläne einzuweihen. Ihre Reise könnte doch auch seine Chance sein. Er hätte als Strohwitwer die volle Konzentration auf seine Forschung. Und wenn sie nicht gestorben ist, in Mossul oder Afrin, dem neuesten syrischen Schlachtplatz, dann könnten sie sich irgendwo in der Mitte des Planeten Hoffnung treffen. Zu einem Badeplausch in Oman, nicht wahr, Helen, das sind die Widersprüche einer grünen Nationalrätin. Obszöne Gedanken schleichen sich ein, wenn der Nichtangetraute nicht kooperiert mit Tisch und Bett. Sie klopft sich auf die Schulter. Bis dann wirst du nicht mehr im Rat sein. Doch kann sie nicht verhehlen, dass sie in letzter Zeit von Destinationen der euphorischen Plakatromantik träumt. Träumen wird wohl noch erlaubt sein.
Die Ansteckung ihrer Schülerinnen? Das wäre Grund zur Besorgnis. Denn Gymnasiastinnen von heute wollen zwar studieren, aber gleich darauf, oft schon vorher heiraten und Kinder kriegen. Von wegen Berufsleben, Frauen in die Politik, Quotenfrauen oder keine, da bricht ein einziges Oh Gott / oh Gähn / oh du Scheisse aus, und die grosse Freche fängt an, sich die Fingernägel zu lackieren. Man kann so lausig daherkommen, wie man will, doch Fingernägel müssen hip und vorneweg sein, knallroter Lack ist obligatorisch.
Der Hochzeitstag sei das Grösste, der wichtigste Tag im Leben der zeitgemäss denkenden Frau. Verkündet anschliessend die grosse Freche und gibt sich lasziv. Man müsse klar die Entjungferung vorher absolvieren und fleissig üben. Damit es in der Hochzeitsnacht dann megageil klappe. Dafür sei jeder Geld- und Zeitaufwand gerechtfertigt, inklusive das umfassend professionell durchgeführte Fotoshooting, das die Gesamtinszenierung von der Kirche bis zum Bankett begleite. Die Kosten habe klar der Pa des Bräutigams zu übernehmen, denn der sei stinkereich, darum geht’s ja, dass der stinkereich ist, damit sich die Chose lohnt; ist doch logisch. Sind da noch Fragen?
Helen hat es aufgegeben, mit ihren Schülerinnen zu diskutieren. Sie hat ein paar Begabten des Romanistik-moduls ein inoffizielles Seminar angeboten. Da sind vier Girls und drei Jungs, die hell im Kopf sind und arbeiten wollen. Sie fand es schade, die wirklich interessierten Kids aussen vor zu lassen. Doch die Eltern haben dagegen opponiert.
Der Sex, das strapazierte Thema in den Medien. Von wegen der Mann will immer, nein, will er nicht, wenn er den Kopf voll Forschung hat. In dieser problematischen Phase der Zweisamkeit würde ihr der gegenseitige Besuch der ehemaligen Feuchtgebiete genügen, die nun ziemlich spröde sind, aber immer noch ansehnlich. Eine zwar mürbe gewordene, aber noch nicht erschlaffte Fleischlichkeit aus Mulden, Hügeln, Abschussrampen, lässt sich manuell behandeln, das mag sie, das hat er früher auch gemocht. Ist die Tätigkeit genannt Streicheln definitiv ausser Betrieb? Bloss weil man seit achtundzwanzig Jahren zusammen ist? Das kann nicht sein. Was will die Frau? Statt einen schnellen Akt und das Schnarchen kurz darauf die ausführliche Beziehungspflege, ja gewiss, körperlich mit Haut und Haar. Wichtiger als der Koitus wird dann das Spiel, und nach dem Spiel einschlafen in der Löffelstellung. Das panische Geschlechtswerkzeug des Mannes im Zenit seiner Manneskraft darf auch mal ruhen, dann findet sich stattdessen ein lustiger Trabant von einem Penis in der gemeinsamen Mitte, ein Familienmitglied, mit dem frau tändeln und herumflottieren möchte. Das wäre dann der Flow, der in der Kreativproduktion erwünscht ist. Sie legt sich auf die Seite und hört Uwes näselnden Atemzügen zu.
Das Spiel hat einen Namen zwar, doch der ist von den Therapeuten und Beraterinnen ausgelutscht und abgenutzt, er weiss nicht mehr, was die wahren Körperfreuden sind: Er lautet Kuschelsex. Dass Uwe nie von Kuschelsex spricht, ist Helens Hoffnung. Und ja, hat dieser nun vorwiegend fremde Mann im Bett nicht letzthin freiwillig und spontan gekocht? Das muss wohl eine Liebeserklärung gewesen sein.
Sie wird die Erinnerung nicht los. Die Inspektion, eine freundeidgenössische Zeremonie. Zu diesem Zweck stieg der Vater in die tannengrüne Lodenuniform – daher wohl Helens Abneigung gegen Tannen –, gegürtet mit ledernen Patronenhaltern, den Felltornister mit dem gerollten Caput auf dem Rücken. Jeder Schweizer Staatsbürger hatte seine militärische Ausstattung, die wie eine camouflierte Rüstung im Mottenschrank auf dem Estrich ruhte, einmal im Jahr seiner Feldkompagnie vorzuführen. Dazu war der Karabiner aus dem Dachschrank zu schultern, ein bedrohliches Gerät. Die ganze Aktion schien dem Teenager fehlgeleitet, ihr Vater gab sich so der Lächerlichkeit preis. Denn eine solche Aufmachung entsprach einem Pausenclown, der sich HD Läppli nannte und das Boulevardtheater bediente. Auch im Radio riss er faule Spässe und heizte die radiophone Heiterkeit an. Das hatte nichts mit dem aufgeklärten Zeitgenossen, der ihr Vater war, am Hut, besser gesagt am Helm, die Krone der militärischen Einkleidung. Helen verstand diese künstliche Maskerade nicht, ihr Vater war kein billiger Sprücheklopfer, sondern ein ernsthafter Debattierer über das Weltgeschehen, und nicht nur, wenn Besuch kam.
Helen wartet die nächste Gelegenheit ab, mit den Eritreerinnen ins Gespräch zu kommen. Sie begegnet ihnen fast täglich auf dem Gang zum Grossisten. An diesem Tag sieht sie, dass der schwarze Junge in seiner grossen Tasche unförmige Gegenstände mitschleppt. Nun fasst sie sich ein Herz, überquert die Strasse und spricht die beiden Frauen an.
Hallo, Ladies, ich glaube, wir haben denselben Heimweg. Ich würde Sie gerne kennenlernen. Ihr Junge ist reizend, wie heisst er?
Dann beisst sie sich auf die Zunge. Was ist in sie gefahren, so kann sie doch nicht mit der Tür ins Haus fallen.
Die Eritreerinnen sind stehen geblieben. Sie blicken Helen misstrauisch an. Sind Sie vom Migrationsamt?, fragt die grosse Eindrückliche.
Ach woher, ich bin Ihre Nachbarin, ich wohne Ihnen schräg gegenüber.
Aha, sagt nun die Kleinere und verzieht ihre feingesponnenen Züge.
Wissen Sie, eigentlich interessiert sich niemand für uns ohne Grund.
Der Junge sperrt die Augen auf und schmiegt sich an die grosse Eindrückliche. Sie tastet nach ihm, als wolle sie ihn abweisen, dann fährt sie fast schnippisch fort: Wir sind sonst nur interessant für das Steueramt und die Fremdenpolizei.
Oh du meine Güte, verzeihen Sie meine Zudringlichkeit.
Nun drängt sich der Junge vor und schaut Helen herausfordernd an. Die grosse Tasche hat er im Rinnstein deponiert.
Schön, dass du deiner Mutter hilfst, sagt Helen etwas tapsig.
Das ist nicht unser Kind, wir wüssten selber gern, wer er ist. Er spricht kein Wort, er hat sich bei uns eingenistet. Er haust in unserm Keller.
Also, wirklich, das ist ja, also eine Überraschung.
Falls, falls ich Ihnen behilflich sein kann. Helen stutzt, sie fühlt sich dermassen ohnmächtig, dass sie zu stottern beginnt.
Wir sind bereits daran, herauszufinden, wer er ist. Bevor Helen antworten kann, gehen die Eritreerinnen weiter. Ihre Geste ist eindeutig, sie heisst Ablehnung. Der Junge schleppt die Tasche, in dem Helen die Militärschuhe vermutet, knapp hinter ihnen her.
Die folgenden Wochen verfliegen im Nu, am Feierabend sinniert Helen über den Dokumenten und Formularen, die sie von der Geschäftsstelle des Schweizerischen Roten Kreuzes angefordert hat. Einen Universitätsabschluss kann sie vorweisen, ein Lizentiat in Romanistik, aber genügen ihre Sprachkenntnisse?
Das Spanische, das Englische werden vorausgesetzt, Arabisch erwünscht. Also heisst es Spanisch büffeln und Englisch lesen. Arabisch wird sie ohnehin nur radebrechen können.
Uwe fällt nicht auf, dass sich seine Gefährtin jeden Abend in ihrem Zimmer verbaut. Erst als sie eines Abends ruft, mach dir ein Spiegelei, Mann, ich bin beschäftigt bis mindestens um zehn Uhr, bemüht er sich herbei, klopft an ihre Zimmertüre und poltert frohgemut, als sie einen Spalt öffnet, komm, gehen wir zum Italiener, ich hab keine Lust auf Spiegeleier.
Der Italiener, die beste Erfindung der deutschen Nachkriegsgeneration! Eine protokulinarische Schöpfung, die sich im südlichen Ausläufer der vereinten Bundesländer ausführlicher präsentiert, den Italiener gab es im Land der Eidgenossen um jede Ecke, er hatte einen klangvolleren Namen und die besseren Weine.
Helen stochert in den Ravioli alla panna und bringt ihr Anliegen nicht heraus. Wieder vertröstet sie sich selber mit der reiflichen Vorbereitung und beschliesst, Uwe erst dann zu informieren, wenn sie das Aufgebot in der Tasche hat. Wobei sie im Grunde weiss, dass sie sich das Aufgebot vormacht, sehr wahrscheinlich wird sie ihm nicht genügen, ihr Jahrgang spricht dagegen, also wozu Uwe informieren, wenn die Sache sowieso im Sand verläuft?
Uwe räuspert sich und legt die Dessertkarte, die der Kellner bringt, auf die Seite. Weisst du, deine Phobie gegen meine Bergschuhe, die will mir nicht in den Kopf. Als ob Schuhe Kriege anzetteln könnten. Dieser Gedanke stand in seiner halb amüsierten, halb besorgten Miene, als er sie beim Stochern inspizierte, bevor er sich seinem prall gefüllten Teller zuwandte.
Uwe, du musst verstehen, dass diese Schuhe meine Kindheit tyrannisierten. Es geht um die traumatischen Bilder, die sie in mir auslösen. Es sind die Bilder, die ich weghaben möchte, ausradieren.
Ihr Ton war eindringlich, und sie sah, dass er ein Stück weit verstand.
Dann sieht sie die Schuhe wieder auf dem Flohmarkt im Quartier. Inmitten des versilberten Nippes. Gegen diesen geschwätzigen Kleinkram wirken sie wie stumme Tölpel aus dem Bilderbuch des ewigen Gestern. Sie nähert sich, sie untersucht die Schuhe, sie muss wissen, wo der Junge ist, nein, es sind nicht ihre Schuhe, das heisst Uwes Schuhe, das heisst Vaters Schuhe. In der Lederferse dieses zum Verwechseln ähnlichen Verwandten findet sie eine winzige Etikette, die den Namen des ehemaligen Trägers enthält. Wanzenried Robert, Korporal, Wiesendangen, Abteilung 56B II / Kompanie B5, drittes Corps 1941.
Wo ist der Junge, diese Frage wird dringend. Sie will sicher sein, dass der Junge ihre Schuhe hat. So sucht sie den Kontakt mit den Eritreerinnen diesmal gezielt. Tatsächlich tauchen sie bald auf dem lokalen Marktplatz auf, und Helen spricht sie an: Verzeihen Sie, ich bin besorgt um Ihren Schützling, wie geht es ihm? Haben Sie seine Identität feststellen können?
Die Frauen zucken die Achseln. Ach, Sie sind’s? Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass der Bursche getürmt ist. Ausgerissen mit seinem kleinen Habundgut, das er in der grossen Migrostasche herumschleppt. Er hütet es wie einen Schatz. Wir hoffen, dass er wiederauftaucht, wenn er Hunger hat. Helen verkneift sich die Frage, ob sich unter dem kleinen Habundgut Militärschuhe befänden. Sie tritt von einem Fuss auf den anderen.
Würden Sie mir, also könnten Sie …
Was wollen Sie eigentlich von uns?
Ihnen Hilfe anbieten.
Es entsteht eine Pause, in der die Jüngere verlegen auf ihre mit Henna verzierten Zehenspitzen blinzelt.
Wissen Sie, sagt schliesslich die grosse Eindrückliche, wir brauchen Ihre Hilfe nicht, wir sind beide ordnungsgemäss registriert, wir haben den Ausweis A, seit drei Jahren arbeite ich bei der Asylbehörde als Übersetzerin und unterrichte in der autonomen Schule. Und Armeida, meine kleine Schwester, sie legt der Jüngeren die Hand auf den Unterarm, hilft mir im Haushalt und lernt Deutsch. Sie ist diplomierte Ingenieurin und möchte später in ihrem Fach arbeiten.
Helen tritt ein paar Schritte zurück.
Dann, also, möchte ich Sie nicht weiter stören.
Die Enttäuschung steht ihr ins Gesicht geschrieben, als sie durch die Wohnungstür tritt. Uwe kommt auf sie zu, nimmt sie ordentlich partnerschaftlich in Empfang. Es ist lange her, dass er jene Frage stellte, die man nicht beantworten kann: Wie geht es dir?
Da kann Helen nicht an sich halten und bricht in Tränen aus. Das ausgiebige Gespräch, das folgt, wirkt zwar wie ein reinigendes Gewitter nach der geballten Sommerhitze, doch hätte man nicht behaupten können, seither sei der gewohnte Alltag dieses Paars eingekehrt und damit das gute Leben nach Seneca, das die beiden pflegen. Aus der Distanz hätte man zwar feststellen können, alles sei paletti mit diesen beiden, wie man sagt, wenn man im Trend liegt. Von nahem jedoch wirken die zwei Leute zwar verbunden, das schon, aber nicht verbündet. Denn wir wissen nicht, inwieweit Uwe nun auf dem Laufenden ist, ob Helen ihn endlich über ihre Pläne orientiert hat. Zwar hat sie die Erfahrung mit den Eritreerinnen direkt und ohne Umschweife berichtet. Hat diese Erfahrung aus der Mördergrube, zu der sich ihre Seele zusammenkrampft, geborgen, vor ihm entfaltet, ausgebreitet, um nicht zu sagen brühwarm aufgetischt. Auch über den Jungen ist Uwe informiert, doch das Eigentliche ist Schweigen, und das ist – frei nach Shakespeare – kein Rest.
Die Zeit geht dahin, und mittlerweile sind die zwei weiter voneinander entfernt als je. Das hat seine Gründe, die wir nun kennen, und es soll ja, wie am Anfang der christlichen Zeitrechnung feststeht, gemäss den biblischen Predigern eine Zeit zum Reden und eine Zeit zum Schweigen geben, eine Zeit zum Warten und eine Zeit zum Handeln. Doch zerrt das Warten mit dem Geständnis, das Helen vor sich herschiebt, allmählich am Grundeinvernehmen dieses Paars. Er schweigt länger als sonst, und sie ist nervös. Er scheint keinen Dunst von ihrem inneren Aufruhr zu haben. Ja, sie ist für ihn gar nicht mehr vorhanden, er sieht sie nicht mehr, oder bildet sie sich das bloss ein?
Menschen enttäuschen einander, das ist die Lektion. Menschen tun nie das, was man von ihnen gerne hätte, jedenfalls nicht von selber. Helen ist daran, sich mit dieser Lebenslehre abzufinden. Und dann kommt der Tag, da Uwe sie überrascht mit dem Vorschlag, endlich die gesprochenen Forschungsgelder zu feiern. Er wolle kochen, halt das Übliche, ja, den ewigen Sugo, halt nichts Neues, aber das Bewährte umso besser. Dazu würde er endlich diesen grossen Bordeaux entkorken, diesen Château Grand Cru de soundso, in diesem Punkt mangelt es Helen an Detailkenntnissen, nun, sie stimmt erfreut zu und erwägt, ob der Anlass zu ihrem IKRK-Geständnis tauge oder nicht. Sie bietet sich an, den Tisch zu decken, kauft sogar wieder mal Blumenschmuck, diese ökologisch einwandfreien Carolröschen, die sie mag. Und dann geht Uwe in den Keller, um diesen sagenhaften Bordeaux, diese Inbrunst von einem edlen Tropfen, von dem Uwe endlos schwärmen kann, heraufzuholen. Nach seinen beherzten Schritten ins Dunkel passiert jedoch nichts. Warten, ein Knistern und wieder nichts.
Es kann doch nicht so lange dauern, einen Wein aus dem Keller zu holen. Sie blickt auf die Uhr, nun steckt Uwe schon volle zehn Minuten dort unten, in seiner Effektenkammer, die Helen seit Monaten nicht mehr betreten hat.
Sie fühlt den bekannten Ärger in sich aufsteigen, und bevor der Abend im Eimer ist, bevor die Zweisamkeit in einem Fiasko landet, beschliesst sie, den Mann aus dem Keller zu holen, dieser Terra incognita für sie.
Sie kommt ihm auf der Treppe entgegen, und als Uwe sie sieht, flüstert er, dann spitzt er die Lippen zu einem «Pscht», er ist auf Zehenspitzen die Treppe hochgeschlichen, die doch sonst in der Kurve ein Knarren von sich gibt. Komm, sagt er leise, leiser geht’s nimmer, komm, ich muss dir etwas zeigen.
Hinter den Regalen mit den Klasseweinen liegt der Junge auf einem Lager aus Holzscheiten. Er schlummert selig auf der Tasche, die er mit einer alten Wolldecke gefüllt hat, um sich eine Bettstatt herzurichten. Seine Fundstücke hat er um sich herum gruppiert. Uwes Schuhe, Vaters Schuhe, diese Chimären der Vergangenheit presst er an sich wie den heiligen Gral, dessen Energie er spürt. Er lächelt im Schlaf.
Wir lassen ihn, haucht Uwe, und sie nickt.
Die beiden schleichen aus dem Abteil, als seien sie zwei Strauchdiebe, die sich ohne Skrupel in reichen Häusern bedienen. Oben nimmt der Abend dann einen gebührenden Verlauf, mit Dauerprost und verschworenen Blicken über der schmackhaften Pasta, auch der Salat und erst der Nachtisch sind nicht zu verachten. Dann stellt Uwe unvermittelt eine Frage: Wie siehst du das? Ist der Junge nun unser Kuckuckskind, oder würdest du ihn für den von den orthodoxen Juden lange erwarteten Messias halten?
Helen ist perplex. Sie hat den Mund geöffnet und haucht, also du, ich bin verblüfft, ich möchte. Bevor sie weiterfahren kann, sagt Uwe ohne irgendeine Betonung: Ich denke, da wartet eine Aufgabe auf uns, und weisst du was, er nimmt einen Schluck, holt aus mit seinem Vorzugsprädikat «göttlich», das ausschliesslich für Weine reserviert ist, bevor er fortfährt: Ich denke, diese Aufgabe ist dringender und ausserdem bekömmlicher als ein Einsatz mit dem IKRK. Sie pausiert mit offenem Mund: Woher weisst du, was weisst du, und er setzt das Glas prompt und mit ungewohntem Nachdruck auf den Untersatz.
Liebe Helen, ich bin doch nicht blind. Was du vorhast, hast du schlecht verhehlt.
Warum hast du nie etwas gesagt?
Worüber man nicht reden kann, darüber soll man schweigen.
Du bist doch einer, also einer … Sie kann sich kaum erholen, dann prustet sie los. Also deinen Wittgenstein – ist doch Wittgenstein? Den kannst du dir sparen. Ich bin nämlich froh, dass es endlich heraus ist.
Es ist, als sei eine Zentnerlast von ihr gefallen, sie hat vergessen, wie klug und bedacht der Mann an ihrer Seite ist. Und wie gern sie mit ihm zusammen ist. Das ist ein Glücksmoment. Der Moment, der sagt: jetzt. Jetzt und nichts anderes. Und endlich fühlt Helen den verschütteten Humor in sich aufsteigen.
Ich denke, sagt sie entwaffnend, ein vorhandenes Kuckuckskind lässt sich wohl einfacher adoptieren als ein kommender Gottessohn.
Der Mann gegenüber räuspert sich:
Helen, von Adoption zu reden, ist viel zu früh.
Das ist Uwe, der Alte. Der, der er eben ist.
Ich weiss, lächelt sie über den Tisch. Schenk mir noch ein Glas von deinem Supergigaweissnichtwas Bordeaux ein.
Göttlich, ich kann mich nur wiederholen.
Sie kosten und schweigen. Bis Uwe sagt: Du, ich bin so froh, dass Syrien nun in die Nähe rückt, es liegt jetzt sagen wir mal in der Distanz von Schlieren oder Affoltern am Albis. Dann hält er ein, ist ja im Grunde ein zynischer Gedanke, gebe ich zu. Du wirst mir vergeben müssen.
Die Nacht ist sternenklar, als sich die beiden Arm in Arm zum Fenster hinauslehnen. Eine frische Brise fächelt sie an. Von der nahen Turmuhr schlägt es Mitternacht. Als der Klang verhallt ist, schwirrt ein Zitronenfalter herein.
Lass ihn, sagt sie zu Uwe, der findet seinen Weg. Wie der Junge. Und ich hoffe, wir finden ihn auch.
Uwe murmelt – Wittgenstein wäre wieder fällig, aber den magst du ja nicht.
Das hab ich nicht gesagt, ich meinte, ich … Uwe legt ihr zwei Finger auf den mit Lippenstift und einem Rest Dessert versalbten Mund. Dann sagt er trocken, es gibt da einiges nachzuholen, denke ich. Die Fortsetzung ist klassisch, geradezu klassisch. Mit viel Basic Instinct. Und noch mehr Zustrom aus einem verantwortungsvollen Muskel, der Herz genannt wird.
Um sechs Uhr morgens zwitschern die Vögel wie verrückt. Sie wissen, was los ist. Helen erhebt sich schlaftrunken und steigt über den königlich schlummernden Uwe hinweg. Sie greift nach dem Seidenhemd, das auf dem Stuhl übernachtet hat, sie will nach dem Jungen sehen. Das Kellerfenster steht offen, und sie erschrickt. Aber die Tasche und der Krimskrams liegen noch da, die Schuhe stehen säuberlich gepaart vor der Holzbeige. Helen atmet auf. Sie muss an sich halten, um nicht in Jubel auszubrechen und dann in Gelächter, denn der Anblick der verhassten Schuhe ist die reine Lieblichkeit. Nun sind sie ein Pfand für ein grösseres Abenteuer geworden, das ihr bevorsteht. Und sie hofft, dass auch Uwe mit von der Partie sein wird, wenn es darum geht, ein stummes kluges fremdes Menschenkind kennenzulernen. Tagtäglich.
War es tatsächlich so? Natürlich war es nicht so. Wishful thinking war’s, der Tag- und Nachttraum einer sozial Engagierten, die wider Willen bei den Grünen politisiert. Und dass sich der bestens dotierte Weinkeller eines gut situierten Paares in Bethlehems Stall verwandelt, ist des Guten zu viel. Das mit den Körpern und Seelen traf hingegen zu. Und es hatte nichts, aber auch gar nichts zu schaffen mit dem, was sich derzeit erotisch auf der Benutzeroberfläche des Digitalkosmos kräuselt. Selfies und Emojis und Blümchen und Herzchen und Softporno und Hardporno und beide mit einem Strauss Bildchen, die Minderjährige und Überfällige bloss mit der Netzhaut wahrnehmen können, falls sie darauf stossen. Dieses Paar findet sich rasch in der Tiefe darunter, dort wo sich die letzte archaische Kraft regt, die alles wegschwemmt, was sich an Ratgeberliteratur für sogenannten guten Sex sowie an therapeutischem Beigemüse auf der Haut des mitmenschlichen Umgangs ansammelt.
Doch es war der Zitronenfalter in lauer Nachtluft, den der durchgepeitschte Wissenschafter nicht ertrug. Weshalb das Vorspiel zur anstehenden Liebesnacht besonders rigoros ausfiel. Und weil das die Gefährtin kommen sah, nahm sie dem Gefährten den Wind aus den Segeln und holte zu einem Präventivschlag aus. Damit du dir nicht zu viel einbildest auf deine Verführerqualitäten, Sex ist nur das Mittel zum Zweck der Erkenntnis, wo du anfängst und ich aufhöre. Diesen heftigen Satz prustete sie ins Lavabo, mit einem Wattebausch voller Abschminke in der Hand, während ihr Uwe über den Rücken fuhr und sie, was sie mag, kräftig unter den Schulterblättern massierte.
Gut zu hören aus dem Mund einer Komforthumanistin, gab Uwe schlagfertig zurück. So eine Bezeichnung kann eine Helen Grossniklaus hingegen nicht auf sich sitzenlassen. Warte, die Antwort kommt noch und nicht zu knapp, sagte sie erregt und wütend zugleich. Und das grosse Aber, das hier folgen möchte, muss passen.
Die Antwort zeigte Wirkung. Wochen später finden wir Helen nicht im IKRK auf einer Mission in Syrien, sondern als Freiwillige in einem Durchgangsheim im Kreis 5. Neben ihrem Pensum am Gymi jobbt sie dort zwei Nachmittage in der Woche als Dolmetscherin und Coach für minderjährige westafrikanische Flüchtlinge. Der dunkle Götterliebling hat nämlich, seit er bei den Eritreerinnen wiederaufgetaucht ist, ein paar Wörter von sich gegeben. Faim, nuschelte er, dann sagte er: boire, vous-plait, und dann: il fait froid. Die Eritreerinnen freilich hegten keinerlei humanitäre Absichten, weshalb sie den Jungen in jenes Durchgangsheim einlieferten, obschon Helen ihn liebend gern zu sich genommen hätte. Das kommt nicht in Frage, sagte die grosse Eindrückliche, dieser Junge muss erst einmal unter die Leute, unter seinesgleichen, er muss erzogen werden. Dass jemand in der Nachbarschaft tuschelte, der Wunderknabe tauge nicht als Accessoire für ein Hipsterpaar, hat Helen mit wundem Herzen weggesteckt. Wie sie so vieles im neuen Job wegstecken muss. Aber das Wegzusteckende liegt hier näher bei der Condition humaine als das willfährig Falsche, die kalkulierte Heuchelei im Wandelgang der Politik.
Und die Schuhe? Sie sind, und das ist Helens winziger Triumph, nach den fruchtlosen Aktionen mit dem Jungen ins Durchgangsheim gegangen. Als Helen ihn nämlich darauf ansprach, äusserte er sogar einen ganzen französischen Satz. Er sagte: Les souliers, vous savez, c’est génial avec.