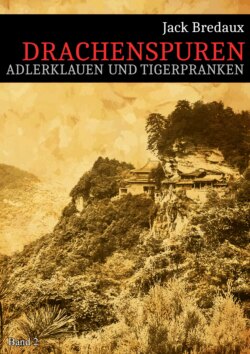Читать книгу Drachenspuren - Jack Bredaux - Страница 4
Verschlungene Pfade
ОглавлениеWohl nie werde ich, Friedrich Weber, Sohn eines Xantener Tuchhändlers, den 9. April des Jahres 1641 vergessen. Den Tag, an welchem ich mich von Amsterdam aus aufmachte, das ferngelegene Batavia zu erreichen. Schutz sollte mir die Fahrt auf der Mirte, dieser wehrhaften Galeone des Amsterdamer Reeders, Herrn van Dyck, gewähren. Schutz vor den schon langewährenden kriegerischen Auseinandersetzungen, welche den europäischen Kontinent ebenso innehatten, wie die Pest oder die Allmacht und Willkür der Kirchenmänner. Desweiteren sollte mir die Dauer der Reise, die mit etwa zwei Jahren anberaumt war, eine Lehrzeit sein, so war es der Wunsch meines Vaters.
Nach meiner Rückkehr, so die Hoffnung, würden wohl endlich ruhigere Zeiten angebrochen sein, die einen friedvollen Alltag ermöglichten.
Gäbe es nicht die freundschaftlichen Bande, die mein Vater bereits seit Jahren mit dem Amsterdamer Reeder verband, wäre ich wohl kaum an Bord dieses Schiffes gelangt. Ja, was hatte ich während der vergangenen Monate an Bord der Mirte nicht alles erlebt. Diese mit Waren und Waffen vollbeladene schwimmende Festung führte mich zu den Fieberküsten Westafrikas. Dort sah ich selbst, wie Hunderte, gar Tausende von jämmerlichen Gestalten in den Bäuchen der bereitliegenden Schiffe verschwanden, um als Sklaven nach Westindien geschafft zu werden.
Die Fahrt führte mich weiter zum Kap der Guten Hoffnung, wo wir den schwer erkrankten Herrn van Dyck zurücklassen mussten, bis wir schließlich, nach scheinbar endloser Zeit, nur umgeben von der unendlichen See, den angestrebten und bekannten Handelsplatz Batavia erreichten. Stets befand ich mich, mit meinem gerade erst erreichten elften Lebensjahr, dabei in guter Obhut. Herr van Houten, der Ziehsohn Herrn van Dycks, trug Verantwortung für mich und lehrte mich viele Dinge an Bord. Ihm gleich tat es, welch ein Zufall, Herr Juncker, ein Botaniker, der beinahe täglich an Bord mit mir zusammensaß und mir dabei von Flora und Fauna erzählte.
Ein überaus gebildeter Mann, der sich an jedem Tier, zu Wasser, am Lande oder in der Luft erfreuen konnte und sogleich mit den entsprechenden lateinischen Namen dafür aufwartete. Doch dann, kaum dass wir unsere Füße auf den Boden Batavias gesetzt hatten und Herr van Houten seinen Geschäften nachgehen konnte, geschah dieses unheilvolle Beben der Erde.
Die Erde tat sich auf, Mauern stürzten in sich zusammen und so mancheiner wurde von herabstürzenden Teilen verletzt. Ein heilloses Durcheinander entstand bei dem scheinbar sinnlosen Unterfangen, sich irgendwohin in Sicherheit zu bringen.
„ Herr van Houten, Herr van Houten, so sagt doch etwas!“, rief ich voller Verzweiflung.
Meine Knie schmerzten von dem Sturz, als Jener, der mich schützen sollte, von einer Schindel am Kopf getroffen, zu Boden stürzte und mich daraufhin mit nach unten zog. Mein Handgelenk schmerzte ebenso, weil sein fester Griff sich nicht lockeren wollte. Das Erdbeben, welches Batavia in Mitleidenschaft zog, kam plötzlich und dennoch kaum unerwartet. Bereits seit Tagen spie der ferne Feuerberg seine glühenden Massen aus, wie wir zuvor noch auf See befindlich ausmachen konnten.
Nun, wo ich versuchte mich aus der Umklammerung Herrn van Houtens zu befreien, stießen Füße und Beine schmerzhaft in meine Seite. Hilflos, ohne jeglichen Schutz und vergeblich auf Rücksicht hoffend, hockte ich neben Herrn van Houten. Wie eine gewaltige Herde junger Stiere trampelten die Menschen um uns herum alles nieder, um das eigene Leben zu retten.
„Herr van Houten, kommt zu Euch“, rief ich abermals, doch kein noch so leises Wort kam über dessen Lippen. Nur das Blut rann bedächtig aber unaufhörlich aus einer klaffenden Wunde seines Kopfes. Erschreckt zuckte ich zusammen, als ich zwei gewaltige Hände unter meinen Achseln spürte, die mich nach oben zerrten, als wäre ich nicht mehr als ein Blatt im Winde. Wie ein Sack Getreide lag ich plötzlich auf den Schultern eines wohl stattlichen Mannes, denn er lief, als würde ihn meine Last überhaupt nicht stören. Meine Rufe nach Hilfe blieben ungehört und meine zappelnden Versuche, der Umklammerung zu entkommen, waren nicht von Erfolg gekrönt. Schmerzhaft drückten bei jedem Schritt die Schulterknochen des Mannes in meinen Magen, und mein Körper schlug hin und her. Ich sah nichts, außer den sich rasch voran bewegenden Füßen und mir wurde übler, als mir es je an Bord der Mirte widerfahren war.
Abrupt blieb der Kerl stehen und ließ mich von seiner Schulter gleiten. Zunächst sah ich das Hafenbecken vor mir liegen, dann hob ich den Kopf und schaute in das Gesicht des Fremden und das Blut gefror mir in den Adern. Waren wir ihnen zuvor auf See noch entkommen, so hatten sie mich nun in ihre Gewalt gebracht. Piraten! Ich blickte in das Gesicht des Mannes, das so rund war, wie die Kugeln unserer 24-Pfünder an Bord. Der Schädel war ebenso glatt wie diese, nur am Hinterkopf hing ein dünner geflochtener Zopf. Die Augen bildeten schmale schräge Schlitze und die Oberlippe zierte ein dünner Schnurrbart, der zu beiden Seiten lang herab hing. Und als wäre dieser Anblick nicht furchteinflößend genug, stand ein zweiter Mann gleichen Aussehens daneben.
Sie trugen weite Hosen und ihre sonderbaren Blusen aus dickem Stoff, waren über der Brust übereinandergeschlagen und an der Seite verknotet. Doch weitaus beeindruckender als die ungewohnte Aufmachung der Beiden, kamen ihre Schwerter daher, die sie an den Seiten trugen.
Kürzer als jene, die ich daheim schon zu Gesicht bekommen hatte, dafür jedoch um ein vielfaches breiter als diese. Das mussten Piraten sein.
Die Kerle sprachen miteinander, wovon ich allerdings kein Wort verstand. Kurz wandte ich meinen Kopf ab, schaute wieder zum Wasser hin und erblickte vor mir eines dieser fremdartigen Schiffe, die mir unser Offizier, Herr Wachtendoonk, als Dschunke beschrieben hatte. Nur, dass das vor mir liegende Schiff bei weitem nicht so große Ausmaße hatte, wie die Dschunken die drüben im Hafenbecken, nahe der Mirte lagen. Dieses Schiff hier war eher nicht für Frachten bestimmt.
Die beiden Männer würdigten mich keines Blickes, aber es hatte den Anschein, als würden sie sich schützend vor mich stellen, damit keiner der Vorbeihastenden mir zu nahe kommen konnte. Oder galt es eher, mich an der Flucht zu hindern? Doch daran war kaum zu denken, da selbst ein beherzter Sprung in das brodelnde Wasser des Hafens keine Sicherheit versprach. Worauf warteten die Männer? Gerne hätte ich mich einfach auf den Boden gesetzt, denn mir zitterten die Beine dermaßen, als würde der stärkste Winter herrschen, den ich je erlebt hatte. Doch die Angst ließ mich schweigsam verharren.
Wie auf ein Kommando hin traten die beiden Männer jeweils einen Schritt zurück und bildeten so eine Gasse für einen weiteren Mann, der sich näherte. Als Sohn eines Tuchhändlers wusste ich sehr wohl zu unterscheiden und bemerkte, dass die Kleidung des Neuankömmlings zwar den gleichen Schnitt aufwies, wie den der beiden Piraten, doch aus weitaus feinerem Stoff bestand. Dieser Mann trug ebenfalls kein Haar auf dem Kopf; schleppte weder Zopf oder Schnurrbart, noch ein breites Schwert mit sich herum. Er besaß ein feiner geschnittenes Gesicht, so dass er mehr einem Kaufmann, als einem Piraten glich.
Er stand noch nicht vor den beiden Grobschlächtigen, als diese sich tief verbeugten und sie sich erst wieder aufrichteten, nachdem der Mann diese kleine Gasse passiert hatte. Einen Moment verharrte er als er mich erblickte und ich meine die Andeutung eines Kopfnickens bemerkt zu haben, dann schritt er an mir vorbei, enterte die angelegte Planke und ging an Bord eben dieser Dschunke.
Mit einem deftigen Stoß in den Rücken und begleitet von unverständlichem Gemurmel, forderte mich einer der beiden kräftigen Männer auf, ebenfalls an Bord zu gehen. Alle schienen nur auf das Erscheinen dieses Mannes gewartet zu haben, der geradeeben vor mir das Deck betrat, denn eifrig wurden nun die Leinen gelöst.
Ein schlanker Mann, beinahe dürr und nur wenig größer als ich, trat auf mich zu.
„Wie ist Dein Name?“, fragte er in meiner Sprache.
„Friedrich, Friedrich Weber, mein Herr“, beeilte ich mich mit der Antwort.
Obwohl mir das Herz bis zum Halse schlug, oder wie es Kapitän Snijder wohl beschrieben hätte, ich die Hosen voll hatte, konnte ich mir ein Lächeln nicht verkneifen, als dieser Herr meinen Namen fragend wiederholte.
„Fliedlich Webel?“, nickte er mir zu und sah mich erwartungsvoll an.
„Ja, mein Herr, Friedrich Weber ist mein Name.“
Der schmächtige Mann rief daraufhin einige für mich unverständliche Worte über Deck, erhielt wohl eine Antwort und sagte nun etwas zu den Seeleuten, die an der Reling gerade die Taue einrollten.
Alsdann stießen sie die Dschunke von der Hafenmauer ab, so dass sich das Schiff daranmachte, den Hafen zu verlassen. Nur einen Moment noch dachte ich daran, den rettenden Sprung ins Wasser zu wagen, doch wegen des grollenden Berges, dem Beben der Erde und des überall herrschenden Unglücks, verwarf ich diesen Gedanken ebenso rasch wie er auftauchte.
„Komm“, griff der schmächtige Mann mit seinen Fingern nach meinem Rock und zog mich zum Ende der Dschunke. Dort, erhöht, sah ich ein prachtvoll ausgestattetes Heck, mit einer halbrunden hölzern Bank und einem runden Tisch davor. Alles war mit dicken Teppichen und Kissen belegt und machte einen weitaus wohlgefälligeren Eindruck, als es das Heck der Mirte vermochte, oder gar die besten Kajüten auf ihr.
Ein älterer Mann, bestimmt älter als Herr van Dyck, saß in feinstes Tuch gehüllt auf dieser Bank; neben ihm der Glatzköpfige mit den feinen Gesichtszügen. Eilfertig huschten schmächtige Gestalten an mir vorbei, die Schalen mit Früchten und sonstige Leckereien zu diesen beiden schafften. Mir fiel auf, wie tief sich alle vor diesen beiden Herrn verbeugten. Endlich ließ der schmale Herr meinen Rock los, sagte kurz: „Warte“ zu mir und begab sich ebenfalls zu diesem Tisch.
Während sie, unverständlich für mich, tuschelten, wurde mir bewusst, was für ein Durcheinander im Hafen herrschte. Immer wieder stürzte irgendwo was ein und das Schreien der Menschen nahm kein Ende. Etliche Schiffe versuchten so rasch wie möglich die offene See zu erreichen. Nicht anders die Dschunke, auf welcher ich mich befand; und so sah ich nur kurz die Mirte noch an der Stelle liegen, wo sie festgemacht hatte, dann entschwand langsam aber stetig der Hafen meinen Blicken.
Sollte ich von nun an, an Bord dieser Dschunke mein Dasein fristen, die Decks schrubben müssen oder den feinen Herrschaften die Speisen bringen? Erst jetzt machte sich die Angst in mir richtig breit und meine ohnehin zitternden Beine versagten mir den Dienst. Ich verspürte keinen Schmerz, als ich hart auf die Planken aufschlug, nur den unendlichen Wunsch, dieser Unwirklichkeit zu entfliehen. Wie gerne würde ich aus diesem Traum aufwachen und mich an Bord der Mirte wiederfinden; oder noch besser, daheim, bei meinen Eltern in Xanten.
Dass ich nicht träumte bemerkte ich rasch, als der schmächtige Mann mich beinahe ängstlich rüttelte und mich wieder auf die Beine stellte. Er führte mich zu einer Sitzgelegenheit unterhalb der Empore, auf welcher die Herrschaften saßen, gab mir zu trinken und begann, mich zu befragen.
Als ich bei meinen Schilderungen den Namen unseres Schiffes nannte und dazu noch Herrn van Dyck erwähnte, hellte sich die Miene des Mannes weiter auf und er wechselte eifrig Worte mit den Beiden, die wohl das Sagen an Bord hatten. Der Ältere von ihnen machte eine knappe Bewegung mit der Hand, worauf mich der neben mir stehende Schmächtige abermals am Rock zupfte.
„Komm, Friedrich Weber, wir dürfen uns zu den Herrschaften setzen.“
Dass der Name sich in meinen Ohren wieder wie ein Fliedlich Webel anhörte, versuchte ich zu verdrängen, damit nicht wieder das Lächeln auf meinem Gesicht erschien. Schließlich wollte ich mir keineswegs den Zorn dieses Menschen zuziehen.
Die wenigen Stufen hinauf zu der Empore schaffte ich auf schwachen Beinen. Ich nahm den zugewiesenen Platz auf den überaus weichen Kissen ein. Den schmächtigen Mann an meiner Seite, saßen wir den beiden Herrschaften nun gegenüber.
Der alte Mann bedachte mich nur mit einem kurzen Blick, bevor er weiter mit seinen beiden Holzstäbchen in eine der Schalen stieß und geschickt damit etwas sicherlich Schmackhaftes hervorzog, was von einem ordentlichen Schmatzen begleitet dann in seinem Mund verschwand.
Der junge Kahlköpfige hingegen starrte mich geradezu unverblümt an. Keineswegs furchteinflößend, nein, vielmehr mit einem gutmütigen Zug um den Mund. Aber doch so stetig, als stände in meinem Gesicht etwas geschrieben. Voller Unbehagen senkte ich meinen Blick und mir stieß es äußerst unangenehm auf, dass in diesem Moment mein Magen vernehmlich zu knurren begann. Seit Stunden hatte ich keinen Bissen zu mir genommen. Dieses Geräusch amüsierte die Herren jedoch, wie ihr lautes Lachen anzeigte. Der Schmächtige neben mir deutete auf Stäbchen, die auf dem Tisch lagen und gab mir zu verstehen, damit auch von den Speisen zu nehmen.
Zu Beginn fiel es mir überaus schwer, mit diesem ungewohnten Werkzeug und dazu von stetiger Beobachtung begleitet, auch nur einen Happen zum Mund führen, was wiederum die Beisitzenden belustigte. Darüber hinaus konnte ich mir kaum vorstellen auf diese Weise eine Mahlzeit einzunehmen, die für einen anstrengenden Arbeitstag herhalten sollte. Es dauerte seine Zeit, bis ich mich etwas geschickter anstellte, doch die Herrschaften hatten Ihr Mahl bereits beendet, erhoben sich und machten sich einfach davon. So saß ich mit dem Schmächtigen alleine bei Tisch und der schaute mir weiterhin zu, wie ich mich mühte.
„Mein Name ist Tian Ze Long“, sprach er mich unvermittelt an. „Du kannst mich Long nennen; ich bin der Übersetzer, wie Du wahrscheinlich erkannt haben wirst.“
„Ja, Herr Long und meine Name ist Friedrich Weber“, gab ich überflüssigerweise und im Übereifer zurück.
„Ich weiß; sonst wärest Du schließlich nicht an Bord unseres Schiffes.“
„Ich bin an Bord, weil ich Friedrich Weber heiße?“, fragte ich ungläubig nach.
„Nein, sicher nicht, junger Mann. Du bist an Bord, weil Du mit der Mirte ankamst und zu den Leuten von Herrn van Dyck gehörst.“
„Woher wusstet Ihr dies und weshalb habt Ihr dann nicht auch Herrn van Houten mit an Bord gebracht?“
„Unsere Leute erkannten euren Kapitän, als ihr euch auf dem Weg zu dem Gasthaus befandet und sie folgten euch dorthin und wollten Kontakt zu euch aufnehmen, als das Unglück hereinbrach. Nur zu gerne hätte der erlauchte Herr Tiu Ning Qiang mit eurem Kapitän gesprochen oder Herrn van Dyck kennengelernt. Leider fühlte sich Tiu Ning Qiang gesundheitlich etwas angegriffen, so dass wir vorsahen, euch zu dieser Dschunke führen zu wollen.“
„Aber warum kümmerte sich denn niemand um Herrn van Houten?“
„Wer, verflixt nocheinmal, ist denn dieser Herr van Houten überhaupt?“
„Unser Oberkaufmann an Bord, der Ziehsohn Herrn van Dycks, welcher schwer erkrankt am Kap der Guten Hoffnung zurückblieb. Herr van Houten lag neben mir, als mich eure Männer aufgriffen.“
„Du meinst den Toten, neben dem Du knietest?“
„Herr van Houten ist tot?“
„Er rührte sich nicht, als Wa Dong Dich packte und zu unserer Dschunke brachte. Sollen wir uns vielleicht um die Toten kümmern, statt das eigene Leben zu retten? Schau zurück und sieh, wie es um Batavia bestellt ist. Wir haben keinen Moment zu früh diese schrecklichen Ort verlassen.“
Der Blick zurück verhieß wahrhaftig nichts Gutes. Das Grollen des Berges drang zwar nur noch schwach über das Meer, seine feurige Glut jedoch, die spukte er weithin sichtbar aus. Stärker als je zuvor. Alles erschien mir so unwirklich, zumal wir, vor wenigen Stunden noch, lachend durch die Gassen Batavias gezogen waren. Nun sah es ganz danach aus, als wäre diese so mächtig wirkende Siedlung der Niederländer dem Untergang geweiht.
„Du wirst erschöpft sein, Junge“, sprach mich Herr Long unvermittelt an und holte mich so aus meinen Gedanken. „Komm mit, ich zeige Dir die Kammer, wo Du dich ausruhen kannst; bis Shanghai sind wir noch etliche Tage unterwegs.“
„Nach Shanghai?“, fragte ich ungläubig nach. „Weshalb versuchen wir nicht, auf See zur Mirte
zu stoßen, damit ich bei meinen Leuten sein kann?“
„Du bist ein Träumer, Junge, es ist kaum anzunehmen, dass euer Schiff Batavia unbeschadet verlassen wird. Somit gilt es zunächst, das eigene Leben zu retten.“
Unter Deck führte mich Herr Long zu einer Tür, öffnete diese und zog mich dabei in den kleinen Raum, der sich vor uns auftat. Eine Liegestätte, mit zahlreichen Kissen darauf, nahm den meisten Platz ein. Ein kleiner Tisch und einige Haken an den Wänden, um Rock oder Hut aufhängen zu können, bildeten das spärliche Mobiliar. Dabei sah doch alles viel ordentlicher und gepflegter aus, als ich es bislang von unserer Galeone her kannte. Der schwere, aber überaus angenehme Duft, musste von den zahlreichen Blüten stammen, die auf dem Tisch wild durcheinander lagen. Kaum, dass ich so meinen ersten Eindruck gewonnen hatte, hörte ich, wie die Tür sich schloss und ich stand allein in dem Raum. Nun merkte ich auch, wie die Müdigkeit in mir hochkroch und ich machte mich flugs daran, die Kissen derart zu platzieren, dass ich bequem darauf liegen konnte. Mit einem tiefen Atemzug schloss ich meine Augen und dachte zunächst an Herrn Juncker, unseren Botaniker, der mir von derart duftenden Blumen erzählt hatte. Ich meinte, er hätte dafür den Namen Orchideen verwendet. Dann kreisten meine Gedanken darum, wie es wohl mit mir weitergehen sollte. Glücklich konnte ich darüber sein, eben nicht in die Hände von Piraten gelangt zu sein, auch wenn die beiden Männer mit den breiten Schwerten am Gürtel durchaus so aussahen. Aber, abgesehen davon, dass es sich ja um die Geschäftspartner Herrn van Dycks handelte, sprach auch das ganze sonstige Getue an Bord dagegen. Die schon übertriebene Höflichkeit, mit den ständigen Verbeugungen voreinander, passte überhaupt nicht zu dem rüden Umgangston, welcher den Erzählungen nach an Bord der Piratenschiffe herrschen sollte. Dennoch war ich nicht frei von Furcht. Wozu sollte ich von Nutzen sein, weshalb wurde ausgerechnet ich gerettet? Sollte ich zukünftig nun doch die Decks schrubben oder in der Kombüse arbeiten müssen? Nicht, dass ich mir dazu zu fein wäre, doch ein Leben als solch ein Sklave, der ungewollt in der Fremde Frondienste leisten muss, wollte ich nicht führen. Der betörende Duft der Pflanzen, welchen ich mit jedem weiteren Atemzug aufnahm, ließ mich schließlich in einen tiefen Schlaf fallen.
Die auf See über Monate hinweg zur Normalität gewordenen Geräusche weckten mich irgendwann auf. Ich spürte das Schlingern des Schiffes, vernahm das Plätschern des Wassers, wenn es an die Bordwände schlug und hörte das Tippeln eilfertiger Füße, die über das Deck huschten. Benommen erhob ich mich von meiner Schlafstätte und fühlte mich dabei, als hätte ich tags zuvor einen Krug Wein alleine geleert. Ich musste dringend an die frische Luft gelangen, denn der zunächst angenehme Duft der Pflanzen lag schwer im Raum. Tief sog ich die frische Seeluft ein, als ich das Deck erreichte und schaute mich um. Die Sonne stand schon hoch, es musste bereits gegen Mittag sein. Von einigen verstohlenen Blicken der Seeleute abgesehen, beachtete mich niemand. Eifrig und dienstbeflissen gingen alle ihren Arbeiten nach. Dann erblickte ich die Herren, die auch gestern auf der Empore ihren Platz eingenommen hatten. Sie entdeckten mich ebenfalls und winkten mich zu sich heran. Der sorgsam gekleidete ältere Herr gab mir zu verstehen, dass ich neben ihm meinen Platz einnehmen sollte und mit einem „Guten Tag, meine Herren“, kam ich dieser Aufforderung schnell nach.
Sie alle schienen den Tag, fernab von Batavia, zu genießen, die See war glatt und blau wie der Himmel, der kräftige Wind füllte die Segel und die Sonne strahlte auf uns herab.
Auf dem Tisch standen wiederum zahlreiche gutgefüllte Schalen und Töpfe, an denen sich die Herren bedienten. Bei mir entstand der Eindruck, dass sie einen großen Teil des Tages ausschließlich mit dem Zusichnehmen von Speisen verbrachten, wenngleich niemand von ihnen einen derartigen Wanst vor sich herschob, wie es zum Beispiel unserem Kapitän Snijder Freude bereitete. Auch mir wurde angedeutet, mich an dem gemeinsamen Mahl zu beteiligen. Dieser Aufforderung folgte ich ebenfalls sehr gerne und sehr rasch.
Gerade machte mich daran, mit den mir gereichten Holzstäbchen umständlich nach den fremdartigen Speisen zu fischen, da stieß mich der ältere feine Herr an, deutete mit den zusammengefügten Fingerspitzen auf sich und sprach „Tiu Ning Qiang“, was er nochmals widerholte. Danach zeigte er auf den gegenübersitzenden jüngeren Glatzkopf und meinte „Tiu Gang Bao“ und wiederholte auch dies.
War Herr van Houten auch stets von meiner raschen Auffassungsgabe begeistert, so muss ich in diesem Moment jedoch sehr dumm dreigeschaut haben. Deutlich lauter, als er sonst sprach, wandte sich der alte Herr nun an den ebenfalls gegenübersitzenden Herrn Long. Der wandte sich mir zu und meinte: „Die Herren haben sich Dir vorgestellt, neben Dir sitzt unser allseits verehrter Herr Tiu Ning Qiang und Dir gegenüber sein Sohn Tiu Gang Bao.“
„Friedrich Weber, sehr angenehm meine Herren“, erwiderte ich daraufhin höflich aber völlig unnötig, was auch zu einem Lachen bei den Männern führte. Ein ums andere Mal piekte ich mit den Stäbchen nach Essbarem, was mir, wie am Vortage, mehr schlecht als recht gelang. Währenddessen unterhielten sich die drei Herren. Von dem Gesagten verstand ich natürlich kein Wort, nur gelegentlich konnte ich das Fliedlich Webel heraushören.
Herr Tiu Ning Qiang und dessen Sohn machten Anstalten, ihren Platz zu verlassen. Herr Long indes verblieb mir gegenüber auf seinem Platz und schaute kopfschüttelnd zu, wie ich mehr Speisen auf dem Tisch verteilte, als dass sie in meinen Mund gelangten. Nein, ein Sklave war ich mit Sicherheit nicht auf diesem Schiff, aber dennoch fühlte ich mich nicht wohl unter diesen durchaus freundlichen, wie fremdartigen Menschen. Herr Long war anscheinend der Einzige, mit dem ich unterhalten konnte, und so kam Wehmut in mir auf. Wie sollte es nun weitergehen? Ich sehnte mich nach meiner Mirte; auf der es nach dem Brandsäubern sicherlich nicht mehr so stank, wie zuvor. Ich vermisste die sonore Stimme des langen Herrn Wachtendoonks, die klugen Worte Herrn Junckers und die freundschaftliche Art von Herrn van Houten. Wie gerne wäre ich nun in Xanten, würde dort Vater zur Hand gehen oder mit meiner kleinen Schwester Kieselsteine in den Rhein werfen. Vor nur zwei Tagen war die Welt noch in Ordnung. Wann nur erwachte ich aus diesem Traum?
„Friedrich Weber“, holte mich Herr Longs Stimme schneller in die Wirklichkeit zurück, als mir lieb war; „Du wirst einige Zeit bei uns verbringen müssen, bevor Du zurück in Deine Heimat kannst“, schien er meine Gedanken lesen zu können. „Du tust gut daran, wenn du versuchst, unsere Sprache zu erlernen, damit ich nicht der Einzige bleibe, mit dem Du sprechen kannst. Wir werden uns viel unterhalten, so dass ich mehr über Dein Land erfahre und noch besser Deine Sprache sprechen kann, und ebenso werden wir in umgekehrter Weise verfahren.“
„Sehr gerne, Herr Long“, gab ich mit etwas Zweifel in der Stimme zurück.
„Dann lass uns gleich damit beginnen“, sagte Herr Long und fing an mir zu erklären, wie man sich in China begrüßt. Weiterhin fragte er Dies und sagte Jenes und so gingen die Stunden dahin, während ich stets mit den Essstäbchen in der Hand, meinen Umgang mit diesen Utensilien übte. Ebenso, wie auf diese Weise Stunde um Stunde verann, schwand auch meine Scheu. Ich war gewillt, mich meinem Schicksal zu ergeben, zumal mir ohnehin keine andere Möglichkeit blieb. Böses, dies war mir nun vollkommen klar, würde mir von diesen Menschen nicht widerfahren.
Es war bereits spät am Nachmittag, als mich Herr Long aufforderte, ihm unter Deck zu folgen. Was hatte mich der Mann während der zurückliegenden Stunden mit seinen Fragen gelöchert; wobei mir nur die Worte in seiner Sprache in Erinnerung geblieben waren, die er mir zu Beginn unseres Gesprächs nannte. Ni Hao hieß es, wenn ich eine Person begrüßen wollte und Nimen Hao, wenn ich auf gleiche Weise mehrere Leute ansprechen wollte. Was ich mir ebenfalls merkte war, dass die Aussprache dieser Worte auch noch in einer besonderen Art erfolgen musste, da sie sonst womöglich einen völlig anderen Sinn bekämen. Als wir unter Deck die Messe erreichten, saßen Herr Tiu Ning Qiang und der stets in seiner Nähe befindliche Sohn bereits wieder vor dampfenden Köstlichkeiten. Herr Long führte mich an den Tisch und mit klopfendem Herzen sprach ich die erlernten Worte; „Nimen Hao.“
Mit wohlgefälligem Lachen, welches von einem langen Ah und Oh begleitet wurde, und der Erwiderung meines Grußes, wandten sich die beiden Männer daraufhin Herrn Long zu. Natürlich blieb mir weiterhin der Sinn der Worte verborgen, aber zumindest konnte ich erahnen auch jetzt selbst ein Teil ihres Gesprächsthemas zu sein.
Kaum anders verliefen die folgenden Tage. Zur Untätigkeit verdammt bestand mein Alltag darin, den Worten Herrn Longs zu lauschen. Insofern konnte ich dankbar darüber sein, da er schließlich der Einzige an Bord war, mit dem ich mich austauschen konnte. Nur zu gerne hätte ich mich jetzt der Kartographie zugewandt und die nahe Küstenlinie auf einem Blatt festgehalten. Doch dazu fehlte mir die einst von Herrn Houten erhaltene Karte, zumindest ein Stück Papier und gleichermaßen ein Stift. Obwohl ich mich mittlerweile durchaus sicher an Bord wähnte, wagte ich dennoch nicht danach zu fragen.
So lernte ich täglich einige neue Worte dieser für mich recht sonderbaren Sprache kennen, wogegen Herr Long mich mit seiner Wissbegierigkeit in Bezug auf meine Heimat löcherte. Von Amsterdam, von wo aus wir uns vor Monaten auf den Weg machten, konnte ich ihm nicht viel erzählen, aber Xanten musste ihm mittlerweile dermaßen bekannt sein, als wäre er selbst dort aufgewachsen.
Den Widrigkeiten des Wetters ausgesetzt, mal von kräftigen Regengüssen begleitet oder von starken Winden vorangetrieben, näherten wir uns immer mehr dem angestrebten Ziel. Die Nächte bescherten mir fortan einen erholsameren Schlaf, da die betörende Wirkung der Orchideen von einem Tag auf den Nächsten schwächer und schwächer wurde.
Die lauter werdenden Rufe und eine noch größere Betriebsamkeit, als bislang wahrgenommen, holten mich frühzeitig an Deck. Ich sah, wie wir auf das am Horizont sichtbare Land zuhielten. Herr Long entdeckte mich und winkte mich zu sich heran. „Schau, Friedrich, dort ist Shanghai; endlich wieder in der Heimat“, fügte er hinzu. Nur zu gerne hätte ich dessen Worte wiederholt, aber meine Heimat lag unerreichbar für mich in der Ferne. Für Trübsal blieb jedoch keine Zeit, an Bord liefen die Vorbereitungen für das baldige Anlegen. Ich folgte Herrn Long zu der Empore, an welcher der junge und der alte Herr Tiu in einem angeregten Gespräch versunken, längst Platz gefunden hatten. Meine Begrüßung erwiderten sie nur kurz, um gleich darauf weiter zu diskutieren. Der alte Herr Tiu beachtete mich kaum, wogen ich wie stets den Eindruck hatte, die Blicke des Sohnes würden mich auf Schritt und Tritt begleiten, was mir einiges Unbehagen bereitete.
„Komm hierher“, forderte mich Herr Long auf, „von hier hast du noch einen besseren Blick, wenn wir den Hafen erreichen. Zudem stören wir die Herren nicht in ihrem Gespräch.“
„Ja, Herr Long“, folgte ich der Anweisung, „sie werden sicherlich Wichtiges zu bereden haben.“
„In der Tat, Junge; die Wege von Vater und Sohn werden sich hier für einige Zeit trennen. Herr Tiu Ning Qiang wird für noch etliche Zeit in Shanghai verweilen, während wir uns mit dem Dashi zu dem Anwesen der Familie Tiu aufmachen.“
„Herr Tiu Ning Qiang bleibt alleine zurück?“, wiederholte ich fragend das soeben Erfahrene und hätte nur zugerne gewusst, was Herr Long unter einem Dashi verstand. Dass er damit den Sohn meinte, war unmissverständlich. Doch war es die Bezeichnung für einen Steuermann, obwohl ich ihn nie am Ruder stehen sah? Zu einem späteren Zeitpunkt wollte ich diesbezüglich meine Neugier stillen.
„Tiu Gang Bao interessiert sich nicht zu sehr für die geschäftlichen Dinge seines Vaters, er pflegt einen gänzlich anderen Lebensstil“, ging Herr Long auf meine Frage ein, „was ihn jedoch nicht davon abhält, den Vater gelegentlich zu begleiten, wie es eben bei dieser Reise der Fall ist. Wir werden eine Nacht in Shanghai verweilen, Herr Tiu Ning Qiang besitzt hier ebenfalls ein großes Haus, wo auch das Lager für unsere Waren untergebracht ist. Von Shanghai aus schaffen wir die bei euch so begehrten Waren nach Batavia oder sogar bis hin nach Osmanien. Es kommen durchaus, wenn auch eher selten, Schiffe aus Europa hierher. Morgen werden wir uns dann mit der Kutsche auf den weiteren Weg machen und, sofern die Fahrt gut verläuft, nach zwei Tagen das endgültige Ziel erreichen.“
„Aber, Herr Long, vielleicht liegt ein Schiff im Hafen von Shanghai, welches mich nach Europa bringen kann?“, wagte ich nachzufragen.
„Du bist noch jung, doch bei hellem Verstand, Friedrich. Natürlich haben wir schon selbst darüber nachgedacht, doch bedenke, dass wir uns für dich verantwortlich fühlen und dich nicht einfach auf ein Schiff bringen können ohne sicher zu sein, dass du deine Heimat lebend erreichen wirst. Sieh nur, die Stadtmauern kommen in Sicht; sie bieten uns Schutz vor den Piraten“, wechselte Herr Long das Thema.
Näher und näher kam unsere Dschunke dem Hafen, bis wir schließlich den Liegeplatz erreichten, der allem Anschein nach für dieses Schiff reserviert war.
Während sich die Besatzung noch damit beschäftigte, dass Schiff ordentlich zu vertäuen, die restlichen Segel einzuholen und alles an Bord in Ordnung zu bringen, machten sich Herr Tiu Ning Qiang, dessen Sohn und Herr Long auf, die schwankenden Planken gegen festen Boden zu tauschen. Vornweg, um den Weg zu bereiten, schritten die beiden Kräftigen, welche ihre breiten Schwerter am Gürtel mit sich führten und die ich anfangs für Piraten gehalten hatte.
Das Hafenbild prägten gewaltige Dschunken, die festgezurrt an der Mauer lagen oder im riesigen Hafenbecken ankerten. Dazu kamen Galeonen, Karavellen und so mancher Schiffsbau, den ich nicht einzuordnen wusste. Auf mich wirkte das Treiben wie ein heilloses Durcheinander, welches mich dennoch in seinen Bann zog, weil es so reichlich Neues zu entdecken gab. Zwar konnte ich Kutschen entdecken, wie sie daheim in Xanten oder auch in Amsterdam anzufinden waren, doch gleichfalls gab es etliche kleine, zweirädrige Karren, auf welchen Fahrgäste ihre Plätze einnahmen; diese wurden jedoch nicht von Pferden oder Maultieren gezogen, sondern zumeist ausgemergelte Gestalten spannten sich selbst davor und mühten sich, oftmals Wohlbeleibte von hier nach dort zu ziehen.
Beinahe an jeder Ecke loderten Feuer von Garküchen. Die voluminösen Töpfe darauf glühten selbst dermaßen rot, als wollte ein Schmied sie weiterverarbeiten. Aber Kräuter und Gemüse, wie unzählige andere Dinge verschwanden darin, um nach kurzen Augenblicken als dampfende Mahlzeit in Schalen angeboten zu werden. Bei meinen neugierigen Beobachtungen musste ich allerdings unbedingt darauf Acht geben, Herrn Long nicht aus den Augen zu verlieren. Ohne ihn wäre ich hilflos verloren in dem Trubel. Der Hafen von Shanghai erschien mir weitaus größer und lebhafter zu sein, als der von Amsterdam; aber so schön, geordnet und sauber, wie der in Amsterdam, war er keineswegs.
„Und, gefällt es Dir, Friedrich?“, fragte mich Herr Long.
„Sehr, Herr Long“, erwiderte ich nicht ganz wahrheitsgemäß. „Allerdings gehen wir dermaßen schnell, dass ich kaum Gelegenheit habe mich richtig umzusehen.“
„Wart´s nur ab, Junge. Gleich haben wir das Haus von Herrn Tiu Ning Qiang erreicht; wenn er und sein Sohn dort einkehren, dann machen wir uns mit Wa Dong und Liu Hang, den beiden Kräftigen, auf, werden uns im Hafengebiet weiter umsehen und schauen, ob eine der Galeonen vielleicht den Kurs nach Amsterdam einschlägt.“
Bereits kurze Zeit später war es dann soweit. Die Herren Tiu verschwanden nach kurzem Wortwechsel mit Herrn Long in dem erreichten Gebäude, und wir machten uns anschließend, wie vorhergesagt auf den Weg. Die vielfältigen und fremdartigen Eindrücke faszinierten mich derart, so dass die steten Erklärungen Herrn Longs dazu mich teilweise überhaupt nicht erreichten. Da wir nur langsam vorankamen dauerte somit eine Weile, bis wir schließlich zu einer weithin sichtbaren Galeone gelangten. Nach kurzem Wortwechsel mit einem der an Bord befindlichen Seeleute enterte Herr Long hinauf auf das Deck des Schiffes und ich sah ihn angeregt reden, währenddessen ich mit den beiden Kahlköpfen untätig wartete.
„Ich denke, es ist nicht ratsam, Dich an Bord dieses Schiffes zu bringen“, rief Herr Long und kam die Planken herab auf uns zu. „Es sind Portugiesen. In vier Tagen wollen Sie die Segel setzen und nach Lissabon zurückkehren. Dir wäre damit nicht gedient, Friedrich; Du wärst der Heimat nur scheinbar näher und dennoch bliebe sie unerreichbar für Dich.“
„Ja“, stimmte ich enttäuscht zu und sah erst jetzt die Flagge wehen, welche das Schiff deutlich als auswies. „Aber, Herr Long“, wagte ich eine Nachfrage, „wäre es denn nicht besser, wir würden ebenfalls in Shanghai verweilen, wo doch ständig neue Schiffe ankommen.“
„Dass hier ein Schiff der VOC anlegt, Friedrich, ist eher selten. Batavia ist nuneinmal deren Umschlagplatz. Außerdem, wer sollte sich hier in Shanghai um Dich kümmern? Herr Tiu Ning Qiang ist alt und mit seinen Geschäften befasst. Nein, Du bist unser, wenn auch nicht ganz freiwilliger Gast und wir fühlen uns verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass Dir kein Leid zustößt.“
„Und, wie lange werde ich Euer Gast sein, Herr Long?“
„Du darfst nicht ungeduldig werden, junger Mann. Wer wüsste besser als Du, wie lange so eine Überfahrt dauert. Komm, lass uns eine Kleinigkeit essen, bevor zum Haus zurückgehen“, strebte Herr Long auf eine der Garküchen zu. Herr Long und ich nahmen die dargereichten Schalen mit dem dampfenden Inhalt entgegen und ich tat es Herrn Long gleich, hielt die Schale dicht an meinen Mund und schob mit den ebenfalls erhaltenen Stäbchen den Inhalt nach und nach in meinen Mund. Selbst das geräuschvolle Schlurfen und Schmatzen ahmte ich eher unbewusst nach, um keinen Fehler zu begehen. Gelangweilt standen indes Wa Dong und der ihm wie ein Zwilling gleichende Liu Hang wenige Schritte entfernt und schauten dem Hafentreiben zu. Kaum das die Schalen geleert waren, drängte Herr Long nun darauf, rasch zum Haus des Herrn Tiu zurückzukehren.
„Es ist gut, wenn Du morgen ausgeschlafen bist, denn vor uns liegt noch eine anstrengende Kutschfahrt“, kommentierte er seine Eile. Im Haus angekommen, war es wiederum Herr Long, der mir sogleich meine Kammer zuwies. Ich hörte viele Stimmen und nicht minder wenige Schritte im Haus umherhasten, doch zu Gesicht bekam ich niemanden. So legte ich gleich zum Schlafen nieder, um für die von Herrn Long beschriebene Anstrengung gewappnet zu sein.
„Aufwachen, Friedrich!“, vernahm ich die mir bekannte Stimme und schreckte aus dem Tiefschlaf hoch. Ich gähnte mir weit aufgerissenem Mund, streckte mich dabei und brachte nur ein undeutliches „ni hao, Herr Long“, hervor.
„Beeile Dich, wenn Du noch etwas zum Frühstück haben möchtest, bevor wir uns auf den Weg machen“, gab Herr Long daraufhin zurück und verließ den Raum.
Rasch sprang ich von der Liegestätte auf, ging zu der bereitstehenden Schüssel mit Wasser und fuhr mir mit den nassen Händen über das Gesicht. Schnell zog ich meine Hosen, die Bluse und den Rock über, schlüpfte in meine Stiefel und verließ das Zimmer. Doch, wo sollte ich hin. Außer dem Raum, welchen ich eben erst verlassen hatte, kannte ich nichts in diesem Gebäude. So folgte ich den Geräuschen, die auf eine lautstarke Unterhaltung hinwiesen. Ich folgte der richtigen Spur und sah die beiden stets mir ihren Schwertern bewaffneten Männer, Herrn Long und Herrn Tiu Gang Bao, die sich an einem reichbestückten Tisch bedienten. Mit Beklemmung brachte ich mein „nimen hao“ hervor und erntete dafür ein wohlwollendes Lachen der anwesenden Männer.
„Komm, setzt dich zu mir“, forderte mich Herr Long auf und deutete bei dem weiteren „nimm“ auf die vielfältigen Speisen und Früchte. Dieser Aufforderung kam ich gerne nach, und da ich den Gesprächen nicht folgen konnte, widmete ich mich ganz dem leiblichen Wohl. Wenn mir auch vieles von dem Angebotenen weiterhin mehr als fremd vorkam, so hatte ich mich durch die vorangegangene Zeit an Bord der Dschunke schon an so Manches gewöhnt. Was ich bei aller Vielfalt dennoch wahrhaftig vermisste, war ein ordentlicher Kanten Brot, wie ich ihn von der Heimat her kannte. Selbst bei dem Gedanken an ein Stück Schiffszwieback lief mir das Wasser im Munde zusammen. Andererseits musste ich mir eingestehen, selbst im Hause des vermögenden Herrn van Dyck, nie eine derartige Auswahl gesehen zu haben.
„Nimm auch hiervon, dies sind Melonen, dort sind die Litschis“, wies mich Herr Long ein.
Bei aller vorangegangenen aufgesetzten Eile schien es den Herren wohl nur darum zu gehen, mehr Zeit an der Tafel verbringen zu können. Doch, kaum dass ich diesen Gedanken zu Ende dachte, stand Herr Long auf und die anderen Männer, und so auch ich, folgten seinem Beispiel.
Die von mir fälschlicherweise als Piraten gedeuteten Männer machten sich daran, Gepäckstücke auf die bereitstehende Kutsche zu laden, und schwangen sich danach gleich hinauf auf den Kutschbock. Tiu Gang Bao, Herr Long und ich, nahmen derweil im Inneren die Plätze ein. Den alten Herrn Tiu bekam ich nicht mehr zu Gesicht. Mit einem Ruck setzte sich kurzdarauf unser von zwei Pferden gezogenes Gefährt in Bewegung.
Der mir gegenübersitzende Tiu Gang Bao zog eine Schriftrolle hervor, der er seine ganze Aufmerksamkeit widmete. Neben ihm hatte sich Herr Long niedergelassen. Er faltete seine Hände und schloss die Augen, als müsste er sich von den Mühen eines umfangreichen Frühstücks erholen. So blieb mir nicht mehr zu tun, als an dem flatternden Tuch vorbei, welches die Öffnung in der Tür der Kutsche verschloss, um Staub und Sonne fernzuhalten, die vorbeiziehende Landschaft zu beobachten. Das Hafengelände verlassend fuhren wir nun durch die Stadt, in der ein reges Treiben herrschte. Ein Handwerksbetrieb lag neben dem Nächsten; Marktstände mit einem riesigen Angebot an frischen Früchten; Kräutern und Gewürzen wechselten einander ab. Das Meckern von Ziegen, das Gackern von Hühnern und die lauten Rufe der Händler erfüllten die zahllosen Gassen. Langsam, sehr langsam, ebneten auch diese Geräusche ab und das Rumpeln unserer Kutsche, das Klappern der Hufe und das Mahlen der Räder auf sandigem Untergrund, bildeten eine monotone Begleitung. Das stete Schwanken der Kutsche verfehlte seine einschläfernde Wirkung nicht.
„Friedrich? Friedrich“, stieß mich Herr Long bei seinen leise gesprochen Worten leicht an und holte mich damit aus dem Halbschlaf. Nun sah ich Tiu Gang Bao zurückgelehnt sitzen, die Augen fest geschlossen, bewegte sich dessen Körper im schwankenden Rhythmus des Gefährts. Seine Schriftrolle hielt er dabei jedoch mit einer Hand fest umklammert.
Nur der Stand der Sonne zeigte mir an, dass wir schon reichlich Zeit unterwegs waren, deshalb fragte ich nach: „Herr Long, wie weit ist es denn noch?“
„Wir sind noch lange nicht am Ziel, Junge. In einer Stunde etwa werden wir den Pferden und uns eine Rast gönnen. Dann werden wir weiterfahren und uns vor Einbruch der Dämmerung eine Bleibe für die Nacht suchen. Aber, schau hinaus; die Landschaft, ist sie nicht wunderschön? Ich kann nicht aufzählen, wie oft ich diese Strecke schon gefahren bin, dennoch bin ich immer wieder davon begeistert.“
„Ja, Herr Long“, pflichtete ich zunächst ohne großes Interesse bei, um gleich darauf doch faszinierter hinauszublicken. Endlose Felder säumten zur Linken wie zur Rechten den Weg. Im knietiefen Wasser standen dort Bauern und gingen der Arbeit nach; mächtige Büffel zogen die Pflüge. Bäume und Sträucher, wie ich sie nie zuvor gesehen hatte, konnte ich entdecken. Unwillkürlich musste ich an Herr Juncker, unseren Botaniker denken, der mir sicher zu jeder dieser Pflanzen einen lateinischen Namen hätte nennen können.
„Es ist wirklich sehr schön“, sprach ich unvermittelt Herrn Long an, der jedoch bereits seine Augen wieder verschlossen hatte. Warum eigentlich hatte er mich geweckt? Ich schob das Tuch etwas mehr beiseite, um besser hinausblicken zu können und sah, wie aus den uns umgebenden sanften Hügeln in der Ferne Berge wuchsen. Die Pferde liefen nun langsamer als zuvor, bis sie schließlich nur daherschritten und die Kutsche letztlich anhielt.
Sofort waren Herr Long und Tiu Gang Bao hellwach. Stimmen drangen von draußen an mein Ohr.
„Endlich“, sagte Herr Long und verließ die Kutsche. Tiu Gang Bao deutete mir mit einer Kopfbewegung an ebenfalls auszusteigen und folgte mir. Wa Dong und Liu Hang sprangen behende vom Kutschbock hinab und reckten und streckten ihre Arme und Beine.
Wir standen vor einem Gasthaus. Etliche Tische standen davor im Freien, die gut besetzt waren, wo Männer aßen und tranken. Als sie mich erblickten, verstummten für einen kurzen Moment die Gespräche, um danach lautstärkerund wild durcheinander schnatternd fortgesetzt zu werden. Ich musste für die Leute ein eigentümliches Bild abgeben. Meine Kopfbedeckung, der Dreispitz, ging mir auf der Flucht vor dem Schrecklichen in Batavia verloren. So wehten nun meine schulterlangen blonden Haare im schwachen Wind. Herr Long sprach zu den Dasitzenden, worauf das wilde Geschnatter merklich ruhiger wurde, doch die Blicken waren weiterhin auf mich gerichtet. Ein unangenehmes Gefühl kam in mir auf und für einen Moment fühlte ich mich, als wäre ich einer der Sklaven, die auf dem Markt von Ouidah zum Verkauf angeboten wurden. Wa Dong legte beinahe freundschaftlich den Arm um meine Schultern und führte mich so zu einem freien Tisch, an welchem sich unsere Gruppe niederließ. Dass ich dennoch weiterhin Thema ihrer Gespräche blieb, konnte ich den unverhohlenen Blicken der um uns herumsitzenden Männer durchaus entnehmen.
Herr Long rief einige Worte, wonach uns eine kleine Mahlzeit und eine Kanne mit Tee auf den Tisch gestellt wurde; und während Tiu Gang Bao, Herr Long und dich uns daran bedienten, kümmerten sich Wa Dong und Liu Hang zunächst um die Pferde.
Die Rast währte eine gute Stunde, dann setzten wir unsere Fahrt fort.
„Noch etwa zwei Stunden, Friedrich, dann können wir uns zur Nachtruhe begeben. Wir übernachten dort stets, wenn wir diese Strecke fahren“, wandte sich mir Herr Long kurz zu, um gleich darauf wieder die Augen zu schließen. Tiu Gang Bao nahm sich wiederum seiner Schriftrolle an und ich saß ihnen gegenüber und konnte, von Langeweile geplagt, ein Gähnen nicht unterdrücken. Nur zu gerne hätte ich in diesem Moment hoch oben auf dem Kutschbock gesessen, damit ich mehr gesehen und auf dieser Weise der Eintönigkeit begegnet wäre. Hatte ich bislang stets den Eindruck, von Herr Tiu Gang Bao in besonderer Weise gemustert zu werden, so nutzte ich nun die Zeit des aufgezwungenen Müßiggangs, um ihn verstohlen zu betrachten. Er musste, sofern ich dies richtig einschätzen konnte, inetwa im gleichen Alter sein wie Herr van Houten. Trotzdem empfand ich diese beiden Männer derart unterschiedlich, was nicht nur auf das Äußere zurückzuführen war. Nein, ich meinte, den mir doch sehr vertrauten Herr van Houten als sehr mitteilsam, stets das Gespräch oder eine Tätigkeit suchend, einschätzen zu können. Wogegen Tiu Gang Bao zumeist selbst schweigsam den Worten lauschte und sich zumeist so benahm, als würde ihn alles um ihn herum nichts angehen. Vielleicht lag es aber auch einfach daran, dass ich mich mit ihm nicht, wie mit Herrn van Houten, unterhalten konnte. Derart in meine Gedanken vertieft und mein Gegenüber mit den Augen abtastend, überraschte mich der Blick, den Tiu Gang Bao an seiner Schriftrolle vorbei auf mich warf und sich somit unsere Blicke trafen. Wie bei einem unrechtmäßigen Tun ertappt errötete ich und blickte rasch wieder hinaus auf die vorbeiziehende Landschaft.
Nach der von Herrn Long vorhergesagten Zeit erreichten wir endlich das Gasthaus, in welchem wir eine Nacht verbringen wollten. Mitgenommen von der Untätigkeit und Langeweile, die mich während der Kutschfahrt übermannte, warf ich mich sogleich auf das bereitstehende Bett, in dem mir zur Verfügung gestellten kleinen Zimmer. Dermaßen ausgeruht verwunderte es nicht, dass ich bereits mit dem ersten Zwitschern der Vögel hellwach war, obwohl sich draußen die Sonne noch mühte, die Dunkelheit der Nacht zu vertreiben. Rasch kleidete ich mich an und schaute anschließend weiterhin aus dem kleinen Fester hinaus und beobachtete, wie mit dem beginnenden Morgen der kleine Ort zum Leben erwachte.
„Du bist schon wach?“, sprach mich Herr Long an, der unvermittelt die Tür zu meinem Zimmer öffnete.
„Ni hao, schon seit geraumer Zeit, Herr Long“, erwiderte ich erschrocken, wegen des unerwarteten Besuchs.
„Dann lass uns rasch frühstücken, damit wir uns weiter auf den Weg machen können. Wenn nichts Unvorhergesehenes eintritt, sollten wir am frühen Nachmittag das Anwesen erreichen.“
„Was soll denn hier schon Großartiges geschehen, Herr Long?“, fragte ich, während ich ihm folgte.
„Räuberbanden sind hier mehr als genug unterwegs, Friedrich. Nicht umsonst haben wir Wa Dong und Liu Hang auf dem Kutschbock sitzen.“
„Ni Hao, Herr Tiu Gang Bao“, begrüßte ich den Mann, der bereits am Tisch saß und sich dem dampfenden Gemüse widmete. Mit einem Nicken und wohlgefälligem Lächeln erwiderte dieser meinen Gruß. Dann ging es auch ziemlich rasch vonstatten; kaum dass ich den letzten Bissen zu mir genommen hatte und noch schnell einen Schluck des sonderbar schmeckenden Tees zu mir nahm, ging es hinaus zur bereitstehenden Kutsche.
Die Pferde schnaubten in freudiger Erwartung, als wüssten sie, dass sie in einigen Stunden den heimatlichen Stall erreichen würden. - Zügig begann die Fahrt, die sich im Wesentlichen nicht von der des Vortages unterschied. Dem Himmel sei es gedankt, blieben wir von Überfällen verschont.
Von draußen vernahm ich die typischen Geräusche, wie sie von einer Schmiede stammen, hörte Klopfen und Hämmern, wie es mir vom Zimmermann her bekannt war und vielfältiges Stimmengewirr dazu. Neugierig lugte ich hinaus und sah das große Dorf, durch welches wir gemächlich fuhren.
„Gleich haben wir es geschafft, Friedrich; schneller als erwartet“, freute sich Herr Long. Nach etwa einer weiteren halben Meile hielt die Kutsche kurz an, um gleich darauf eine große Pforte zu passieren. Wir hatten das Anwesen der Familie Tiu erreicht.
Sogleich kamen Männer heran gelaufen, die sich des auf der Kutsche befindlichen Gepäcks annahmen. Tiu Gang Bao und Herr Long wurden mit sichtbarer Freude begrüßt, ebenso Wa Dong und Liu Hang. Als mich die Umherstehenden erblickten, machte sich jedoch großes Erstaunen breit; in etwa so, wie ich schaute, als ich meinen ersten Wal erblickte.
„Natürlich haben wir häufig davon erzählt, was für Leute das sind, die unsere Waren kaufen, Friedrich; aber Du bist die erste Langnase, die einen Fuß in das Haus von Herrn Tiu setzt“, brachte Herr Long wie zur Entschuldigung hervor. Komm, lass uns zunächst einmal hineingehen, später werde ich Dich herumführen und Dir alles zeigen.“
Nachdem sich die erste Aufregung gelegt hatte und man sich im Inneren des Hauses daranmachte Speisen und Getränke bereitzustellen, wollte Herr Long seine Ankündigung in die Tat umsetzen.
„Zunächst zeige ich Dir dein Zimmer, Friedrich, danach werde ich Dich mit dem gesamten Anwesen vertraut machen, das schließlich für einige Zeit Dein neues Zuhause sein wird.“
Beim Betreten des Raumes, welches Herr Long mir als mein Zimmer zuwies, verschlug es mir die Sprache. Nie zuvor hatte ich in ein schöneres und größeres Zimmer mein Eigen nennen dürfen; wenn auch nur für eine hoffentlich begrenzte Zeit. Der Schrank, das Bett, sowie Tisch und Stühle waren aus dunklem Holz kunstvoll gefertigt. Ein dicker Teppich auf dem Holzboden gehörte ebenso dazu, wie zahlreiche Kissen auf der Liegestätte.
„Ich hoffe, Du bist mit Deiner Unterbringung zufrieden?“, wandte sich mir Herr Long zu.
„Natürlich, Herr Long“, brachte ich äußerst angenehm überrascht lediglich hervor. Anschließend führte mich der Übersetzer weiter durch das Haus, machte mich mit den verschiedenen Räumen vertraut, um daraufhin mit mir das Gebäude zu verlassen.
„Dort, links, sind die Gebäude der Bediensteten, daneben die Stallungen, wo die Pferde untergebracht sind und da hinten, rechts, da ist der Garten, wo wir bei schönem Wetter unseren Unterricht fortsetzen werden“, klärte mich Herr Long auf, während er mit mir über das Anwesen schritt.
Wir brauchten lange, um uns alles anzusehen, denn das von einer mehr als mannshohen Mauer umgebende Anwesen glich mehr einem kleinen Dorf, als einem Gehöft, wie ich es von Xanten her kannte. Wer hier seinen Fuß hineinstellen wollte, der musste zunächst an den beiden Männern vorbei, die an der breiten Pforte Wache standen. Wobei, wenn ich es mir recht überlegte, rein garnichts von dem was ich hier vorfand, mit dem in Xanten zu vergleichen war.
Bei seinen Erklärungen spürte ich stets den prüfenden Blick Herrn Longs auf mich gerichtet, und so ließ seine Frage auch nicht lange auf sich warten: „Und, gefällt es Dir hier, Junge?“, fragte mich Herr Long zum wiederholten Male.
„Selbstverständlich, Herr Long“, beeilte ich mich mit meiner Antwort, „es ist nur alles so anders und so fremd.“
„Natürlich, Friedrich, mir würde es wohl kaum anders ergehen, würde es mich in Deine Heimat verschlagen; aber Du hast schließlich ausreichend Zeit, Dich einzugewöhnen.“
Dabei hatte ich mich während der zurückliegenden Tage schon an so manches gewöhnt, vor allen Dingen an die ungewohnten Speisen, die durchaus schmackhaft, mir zu Beginn dennoch reichliches Zwacken im Bauch verursachten.
Tief und fest schlief ich, bis mich das „Ni Hao“ von Herrn Long aus dem traumlosen Schlaf holte. Gleich nach dem Frühstück ging es dann wie angekündigt in den wunderschön angelegten Garten, den wir uns am Vortag nicht weiter angesehen hatten. Wie alles, wie ich den Anschein hatte, war auch dieser Garten überaus groß. In der Mitte befand sich ein Teich, über den sich ein kunstvoll verzierter Steg spannte. Im Schatten einiger knorriger Bäume standen hölzerne Tische und Bänke, auf die Herr Long zusteuerte. Er stellte die beiden mitgeführten Becher auf einen der Tische und mit der ebenfalls getragenen Kanne in einer Hand, ging er zu einem kleinen Ziehbrunnen, um diese mit Wasser zu füllen.
„So, Friedrich, hier werde ich Dich bei schönem Wetter unterrichten“, stellte Herr Long bei seinen Worten die Kanne auf den Tisch. „Ich werde Dich unsere Sprache ebenso lehren, wie unsere Schriftzeichen; zumindest einen Teil davon“, berichtigte er sich rasch, „denn dies sind weitmehr, als eure Sprache an Buchstaben aufweist. Sollte uns darüber hinaus noch Zeit bleiben, werde ich Dich auch gerne in der Kalligraphie unterrichten.“
„Kalligraphie? Was ist das, Herr Long?“
„Das ist eine Kunst des schönen Schreibens, die bei uns hohes Ansehen genießt. Doch, lassen wir uns zunächst mit der Sprache beginnen. Mit den paar Worten, die Dir bislang geläufig sind, wirst Du dich mit niemandem unterhalten können. Im Gegenzug möchte ich allerdings auch noch mehr Worte aus Deiner Sprache hören, damit ich bei späteren Gesprächen mit euren Händlern nicht über den Tisch gezogen werde“, lachte Herr Long schelmisch.
Wir verbrachten bereits einige Zeit in der Weise, dass mir Herr Long Wörter vorsprach, mir deren Bedeutung kundtat und mich berichtigte, wenn ich ein Wort nicht langgezogen genug aussprach oder der Tonfall nicht stimmte; denn dies konnte, wie bereits geschildert, einen völlig anderen Sinn ergeben.
„Friedrich, wo bist Du mit Deinen Gedanken?“, rief mich Herr Long zur Ordnung, als ich an ihm vorbeischaute und eine seiner Fragen unbeantwortet ließ.
„Dort hinten ist Tiu Gang Bao, Herr Long; was macht er dort?“, fragte ich neugierig, und schaute ebenso interessiert wie auch belustigt dorthin, wo sich der Sohn des Hausherrn bewegte. Der gute Mann reckte und streckte seinen Körper und verbog ihn derart, wie ich es bislang nur auf dem Jahrmarkt in Xanten gesehen hatte, wo Gaukler sich als Schlangenmenschen anpriesen. Dann, wie aus dem Nichts heraus, trat und schlug er in die Leere, als wollte er den sanften Wind dafür bestrafen, dass er die drückende Hitze nicht erträglicher machte.
„Ach, der Dashi geht nur seinen Übungen nach, das macht er täglich, bei Wind und Wetter“, schaute nun auch Herr Long in diese Richtung. „Er beginnt zumeist damit, wenn die anderen sich im Bett noch einmal herumdrehen.“
„Dann ist er ja schon lange damit beschäftigt, Herr Long. Doch wozu soll das gut sein?“
„Zur Gesunderhaltung und Kräftigung des Körpers, Junge, und für einen klaren Verstand. Für Dich könnten diese Übungen auch von Nutzen sein, so schmächtig, wie Du gebaut bist“, belehrte mich der nicht weniger schmächtige Herr Long. „Zudem wäre es ein guter Ausgleich zu den Stunden, die wir hier herumsitzen. Ich werde den Dashi bei Gelegenheit fragen, ob er bereit ist, Dich zu unterrichten. Allerdings darf unser Unterricht nicht darunter leiden. Dein Vater wird schließlich stolz auf Dich sein, wenn Du zurückkehrst und Du ihn mit einer erlernten fremden Sprache überraschst.“
„Ja“, bestätigte ich das Gehörte, und sogleich fuhr Herr Long auch wieder mit seinen Lehren fort.
Aber die Ablenkung durch die sonderbaren Bewegungen Tiu Gang Baos war dermaßen groß, dass ich nun häufiger Fehler machte.
„Ja, ich denke es wird besser sein, wenn wir zukünftig später mit unserem Unterricht beginnen, wenn der Dashi seine Übungen beendet hat“, schlussfolgerte Herr Long daraus.
Nun schauten wir beide dem munteren Treiben des Mannes zu.
„Herr Long, darf ich Euch etwas fragen?“, durchbrach ich die Stille.
„Nur zu, junger Mann“, forderte mich Herr Long dazu auf.
„Sind diese Übungen für einen Dashi denn wichtig an Bord einer Dschunke?“
„Ich verstehe Deine Frage nicht, Friedrich. Der Dashi ist ein Dashi, eben weil er diese Übungen so gut kann, wie sonst nur Wenige. Deswegen muss er sich nicht an Bord einer Dschunke oder eines anderen Schiffes damit beweisen.“
„Herr Ruben van Schrieck, der Steuermann der Mirte, hat aber nie derartige Übungen gemacht, Herr Long.“
Nach kurzem Überlegen ging ein breites Lachen über das schmale Gesicht des Übersetzers und er meinte: „Jetzt verstehe ich, was Du meinst, und ich war im Glauben, Dir wäre es schon bewusst gewesen. Der Dashi hat wahrscheinlich von der Schifffahrt nicht mehr Ahnung als Du oder ich, Friedrich, und er ist keineswegs ein Steuermann. Mit Dashi bezeichnen wir das, was ihr in eurer Sprache als Großmeister bezeichnen würdet. Der Dashi ist ein Großmeister der Kampfkünste und genießt hohes Ansehen dafür.“
„Tiu Gang Bao ist ein Krieger, ein Soldat?“, fragte ich ungläubig nach.
„Nein, Friedrich, Tiu Gang Bao ist ein friedliebender Mensch, der keiner Fliege etwas zu Leide tun würde; aber er ist ein Mensch, der zu kämpfen versteht. Er erlernte das Kämpfen, um nicht kämpfen zu müssen.“
„Das verstehe ich nicht, Herr Long“, gab ich unumwunden zu.
„Dies würde auch zu weit führen, junger Mann und Dich im Moment nur ablenken. Vielleicht reicht die Zeit aus, die Du bei uns verbringst aus, um Dir den Weg von Tiu Gang Bao näherzubringen.“
Der Mann, über den wir sprachen, beendete derweil seine Übungen und näherte sich uns, hielt jedoch zielstrebig auf den kleinen Ziehbrunnen zu und hob, als er uns erblickte, nur kurz die Hand zum Gruß. Sichtbar rann ihm der Schweiß über das Gesicht. Am Brunnen angekommen, entledigte er sich seines weiten Oberteils und ich verfiel in blankes Staunen.
Was die sorgsam verknüpfte Bluse bislang verbarg, offenbarte sich nun als ein Berg von Muskeln und Sehnen, die wohl niemand bei diesem Mann vermutet hätte. Diesen Anblick kannte ich nur von den Seeleuten, die an Bord unseres Schiffes einst die schwersten Lasten, die größten Kisten schleppten. Aber dieser Dashi, wie ihn Herr Long bezeichnete, besaß Muskeln von derart ausgeprägter Natur, dass man annehmen konnte, er würde die größten Fässer an Bord der Mirte alleine bewältigen können. Als wären es nicht mehr als einer handvoll Federn, zog er nun den schweren Kübel mit dem kühlen Nass aus dem Brunnen hervor, wusch sein Gesicht und goss den Rest des Inhalts über seinen von Schweiß glänzenden Körper. Dann schlupfte er sich das Oberteil wieder über und machte sich auf den Weg zum Haus.
„Wenn ich Deine Blicke richtig deute, Friedrich, dann liegt im Moment das Interesse wohl mehr bei dem, was der Dashi so treibt, als dass Du an einer Fortsetzung des Unterrichts denkst. Für heute wollen wir es darum dabei belassen. Im Laufe des Tages werde ich nachfragen, ob Tiu Gang Bao gewillt ist, Dich an seinen Lehren teilhaben zu lassen. Ist dies in Deinem Sinne, Friedrich; auch wenn sich der Unterricht mit mir daran anschließend wird?“, vergewisserte sich Herr Long.
„Nur zu gerne, Herr Long, wenn ich dadurch ebenfalls so kräftig werde“, gab ich voll freudiger Erwartung zur Antwort.
„Die Bewegung wird Dir sicherlich nicht schaden, Junge. Aber die Zeit, die Du bei uns verbringen wirst, wird nicht ausreichen, um Tiu Gang Bao auch nur annähernd ähnlich zu werden. Dazu müsstest Du viele Jahre bei uns verbringen und den Übungen täglich nachgehen.“
Wie hätte ich diesem Moment auch nur erahnen können, welche Vorhersage Herr Long mit seinen Worten sehr treffend beschrieb.
„Friedrich“, fuhr Herr Long fort, bis das Essen auf dem Tisch steht, dauert es noch eine Weile. Ich habe im Haus noch Einiges zu erledigen; möchtest Du mitkommen oder hier im Garten bleiben?“
„Wenn es recht ist, Herr Long, würde ich mich gerne noch etwas im Garten umschauen.“
Herr Long machte sich daraufhin auf den Weg zum Haus und ich ging mit neugierigen Blicken zu der Stelle, wo Tiu Gang Boa bis eben noch seinen sonderbaren Übungen nachging. So sehr ich den stoppeligen Grasboden auch in Augenschein nahm, es gab nichts Ungewöhnliches zu entdecken. Darum schlenderte ich gemächlich zu dem Teich, ging auf die kleine hölzerne Brücke, die das Gewässer überspannte, ließ mich darauf nieder und sah dem quirligen Treiben der im Wasser befindlichen Fische zu.