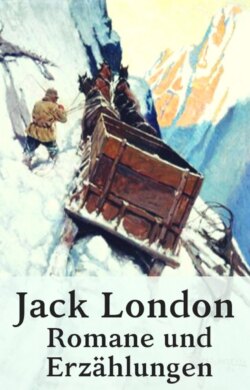Читать книгу Jack London - Romane und Erzählungen - Jack London - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Dritter Teil 1. Kapitel. Die Feuermacher
ОглавлениеGanz plötzlich machte das Wölflein eine neue Entdeckung. Es war einst ganz sorglos aus der Höhle zum Bach hinuntergelaufen, um zu trinken, vielleicht war es noch schlaftrunken, denn es war die ganze Nacht auf Raub aus gewesen und eben erst aufgewacht; auch hatte es den Weg zum Bache so oft gemacht, daß es denselben genau kannte, und niemals war ihm dort irgend etwas passiert. So war es an der umgefallenen Tanne vorbeigekommen, dann quer über den freien Platz und unter die Bäume getrabt. Dann witterte und erblickte es das Neue im nämlichen Augenblick. Vor ihm auf der Erde saßen fünf lebende Wesen, wie es ähnliche nie im Leben gesehen hatte. Es waren die ersten Menschen, die es erblickte. Die Fünfe sprangen jedoch bei seiner Annäherung nicht auf, auch wiesen sie nicht knurrend die Zähne; unbeweglich, schweigend, unheimlich saßen sie da.
Auch das Wölflein regte sich nicht. Alle Instinkte seiner Natur trieben es an, fortzurennen, doch zum erstenmal regte sich in ihm ein anderer, entgegengesetzter Trieb. Eine Art geheimnisvoller Ehrfurcht überkam es; ein Gefühl der eigenen Schwäche und Unbedeutsamkeit drückte es nieder. Hier, fühlte es, war Herrschaft und Macht, etwas viel, viel Größeres als es selber.
Das Wölflein hatte zwar nie Menschen gesehen, aber dem Instinkt nach kannte es sie. Unklar erkannte es in ihnen das Tier, das über alle andern herrscht. Nicht bloß mit eigenen Augen, sondern auch mit denen seiner Vorfahren blickte es jetzt auf den Menschen – mit Augen, die in der Dunkelheit sich um zahllose Lagerfeuer gedrängt, die aus dem Dickicht aus sicherer Entfernung auf das seltsame, zweibeinige Geschöpf geschaut hatten, das Herr über die lebenden Wesen war. Der Bann seines Erbteils lag auf ihm, die Furcht, der Respekt, den ein jahrhundertelanger Kampf und die gesammelte Erfahrung ganzer Generationen erzeugt hatten. Dies Erbteil war für einen so jungen Wolf zu mächtig. Wäre er erwachsen gewesen, so wäre er weggelaufen; jetzt kauerte er in lähmender Furcht nieder und brachte ihnen die Unterwerfung dar, die sein Geschlecht zum erstenmal den Menschen dargebracht hatte, als ein Wolf herangekommen war, um sich an ihrem Feuer zu wärmen.
Einer der Indianer stand auf, ging zu ihm hin und bückte sich zu ihm herab. Das Wölflein duckte sich tiefer. Das Unbekannte, das Wirklichkeit, ja, Fleisch und Blut geworden war, beugte sich über es und wollte es packen. Unwillkürlich richtete sich sein Haar empor, seine Lippen zogen sich zurück und entblößten die kleinen Zähne. Die Hand, die wie das Verhängnis über ihm schwebte, zögerte, und der Mann sagte lachend: »Seht doch die weißen Zähne!«
Die andern Indianer lachten laut und drängten den Mann, das Wölflein emporzuheben. Wie die Hand ihm näher kam, stritten sich widerstrebende Empfindungen in ihm. Es hatte das Verlangen, nachzugeben, und den Wunsch, sich zu wehren, und das Resultat war, daß es beides tat. Es ließ es geschehen, daß die Hand es fast berührte, dann schnappte es blitzschnell danach. Im nächsten Augenblick bekam es eine Ohrfeige, die es umwarf. Nun war ihm die Streitlust vergangen. Seine große Jugend und der Instinkt der Unterwerfung gewannen die Oberhand, es setzte sich aufrecht und winselte kläglich. Allein der Mann, den es in die Hand gebissen hatte, war ärgerlich. Das Wölflein erhielt noch eine Ohrfeige auf die andere Seite, worauf es noch kläglicher schrie.
Die andern Indianer lachten laut, und selbst der Gebissene stimmte ein. Sie standen rings um das Wölflein und lachten, während es in seinem Jammer und in seiner Angst laut winselte. Da hörte es einen wohlbekannten Ton. Auch die Indianer lauschten, aber das Wölflein wußte, was das war, und nachdem es noch einmal laut aufgejammert hatte, schwieg es und wartete auf die Ankunft der Mutter, seiner wilden, unbezwinglichen Mutter, die mit allem kämpfte, was da lebte, und es tötete und Furcht nicht kannte.
Sie kam knurrend herangestürmt. Sie hatte den Ruf ihres Jungen gehört und stürzte herbei, um es zu retten. Sie sprang mitten unter die Männer, und ihre mütterliche Angst und ihre wilde Kampfbereitschaft machten sie furchtbar. Aber dem Wölflein gefiel ihr rasender Zorn; das verhieß ihm Schutz. Es stieß einen schwachen Freudenschrei aus und sprang ihr entgegen, während die Männer eiligst ein paar Schritte zurückwichen. Die Wölfin stellte sich mit gesträubtem Haar vor ihr Junges, und ein tiefes, grollendes Knurren stieg aus ihrer Brust empor. Ihre Züge waren drohend verzerrt, die Nase von der Spitze bis zu den Augen voller Falten, und ihr Knurren klang boshaft.
Auf einmal schrie einer der Indianer: »Kische!« Es lag Erstaunen in dem Ruf. Das Wölflein fühlte, wie die Mutter bei dem Ruf zusammenzuckte.
»Kische!« rief der Mann noch einmal, diesmal scharf und gebietend, und nun sah das Wölflein, wie seine sonst so unbändige Mutter sich duckte, bis sie fast den Boden berührte, und winselnd und schweifwedelnd um Frieden bat. Es konnte sie nicht verstehen, und es war entsetzt. Angst und Grauen vor den Menschen übermannte es. Sein Instinkt hatte also recht gehabt, auch die Mutter bestätigte es, denn auch sie unterwarf sich den Menschen.
Der Mann, der so gesprochen hatte, näherte sich ihr. Er legte ihr die Hand auf den Kopf, und sie duckte sich noch tiefer. Sie schnappte nicht zu oder drohte, es zu tun. Auch die andern kamen näher, stellten sich um sie, betasteten und streichelten sie, was sie sich geduldig gefallen ließ. Sie waren alle sehr aufgeregt und machten seltsame Töne mit dem Munde. Diese Töne bekundeten jedoch keine Gefahr, das sah das Wölflein ein, als es zur Mutter herankroch, und wenn auch sein Haar sich emporrichtete, doch so gut es konnte, seine Unterwerfung bezeigte.
»Es ist nicht zu verwundern,« sagte einer der Indianer. »Ihr Vater war ein Wolf, wenn auch die Mutter eine Hündin war. Allein mein Bruder band diese in der Paarungszeit oft nachts im Walde an. Darum war Kisches Vater ein Wolf.«
»Ist es nicht ein Jahr her, Grauer Biber,« sagte ein anderer Indianer, »seitdem sie weglief?«
»Das ist kein Wunder,« antwortete der Graue Biber. »Es war eine knappe Zeit, und es gab kein Fleisch für die Hunde.«
»Sie hat bei den Wölfen gelebt,« sagte ein dritter.
»So scheint es, Drei Adler,« antwortete der Graue Biber und legte die Hand auf den jungen Wolf, »und das ist das Resultat davon.«
Das Wölflein knurrte ein bißchen bei der Berührung. Sofort wurde die Hand zurückgezogen, um ihm eine Ohrfeige zu geben. Darauf wies es nicht mehr die Zähne, sondern legte sich unterwürfig nieder, während die Hand ihm am Kopfe kraute und ihm den Rücken streichelte.
»Ja, das ist das Resultat davon,« fuhr der Graue Biber fort. »Es ist klar, daß Kische seine Mutter ist. Aber der Vater ist ein Wolf. Darum ist wenig vom Hunde und viel vom Wolfe in ihm, und ›Wolfsblut‹ soll sein Name sein. Ich habe gesprochen. Es ist mein Hund. War nicht Kische meines Bruders Hund? Und ist nicht mein Bruder tot?!«
Das junge Tier, das so einen Namen erhalten hatte, lag wartend da. Eine Weile noch machten die Männer ihren Lärm mit dem Munde, dann nahm der Graue Biber ein Messer aus der Scheide, die er am Halse trug, ging in das Dickicht und schnitt einen Stock ab. Wolf beobachtete ihn. Er kerbte den Stock oben und unten ein und befestigte Riemen von ungegerbtem Leder in die Kerbschnitte. Den einen Riemen band er um Kisches Hals, dann führte er sie zu einer jungen Tanne, um welche er den andern Riemen befestigte.
Wolfsblut folgte und legte sich neben ihr nieder. Lachszunge streckte die Hand aus und rollte ihn auf den Rücken. Kische sah ängstlich zu. Wolfsblut fühlte, wie die Angst wieder in ihm emporstieg. Er konnte ein Knurren nicht ganz unterdrücken, aber er machte nicht Miene zu beißen. Die Hand mit den gespreizten und gekrümmten Fingern rieb ihm spielend den Bauch und rollte ihn von einer Seite auf die andere. Es war lächerlich und häßlich, so auf dem Rücken zu liegen und die Beine in die Luft zu strecken. Auch war es eine so äußerst hilflose Stellung, daß Wolfsbluts Natur sich dagegen empörte. Er konnte nichts tun, um sich zu verteidigen. Wenn der Mann Böses im Schilde führte, so wußte er, daß er dem nicht entrinnen würde. Wie konnte er, wenn er seine vier Beine in die Luft streckte, aufspringen? Doch bezwang er unterwürfig seine Furcht und knurrte nur leise. Dies konnte er nicht unterdrücken, und der Mann nahm es auch nicht übel und gab ihm keinen Schlag an den Kopf. Allein das Seltsamste war, daß Wolfsblut, wie die Hand ihn hin und her rollte, ein unerklärliches Vergnügen empfand. Wurde er zur Seite gerollt, so hörte er zu knurren auf, und wenn die Finger ihn am Kopfe krauten, so wuchs die angenehme Empfindung, und als der Mann nach einem letzten Streicheln und Krauen ihn losließ, war die Furcht in ihm verschwunden. Zwar sollte er noch oftmals in seinem Umgang mit den Menschen vor ihnen Furcht empfinden, doch bereitete sich schon jetzt der furchtlose Verkehr mit ihnen vor. Nach einer Weile hörte Wolfsblut den Ton fremder Stimmen, die näher kamen. Er erkannte sogleich, daß es der Lärm sei, den die Menschen mit dem Munde machten. Einige Minuten später erschien der Rest des Stammes in langer Marschlinie. Es gab noch mehr Männer und viele Frauen und Kinder, im ganzen etwa vierzig Personen, alle mit Lager- und Hausgerät schwer beladen. Auch viele Hunde waren dabei, und diese waren mit Ausnahme der noch nicht erwachsenen ebenfalls beladen. Sie trugen auf dem Rücken in Säcken, die ihnen umgeschnallt waren, ein Gewicht von zwanzig bis fünfzig Pfund.
Wolfsblut hatte noch nie zuvor Hunde gesehen, aber bei ihrem Anblick wußte er, daß sie, wenn auch ein wenig verschieden, doch zu seiner Gattung gehörten; sie unterschieden sich nicht sehr von Wölfen. Als sie Wolfsblut und seine Mutter erblickten, stürzten sie auf die beiden los. Wolfsbluts Haar richtete sich empor, und er knurrte und schnappte zu, als die Schar Hunde mit offenem Maule herankam. Doch er wurde um und um geworfen, kam unter ihre Füße und fühlte ihre scharfen Zähne an seinem Körper, während er selber ihnen in die Beine und in den Bauch biß. Es war ein großer Spektakel. Er hörte Kisches Knurren, sah, wie sie für ihn kämpfte, hörte die Rufe der Menschen, den Ton der Knüttel, wenn die Hunde geschlagen wurden, und das klägliche Geschrei der also Geschlagenen.
Ein paar Minuten später stand er wieder auf den Beinen. Er sah nun die Menschen, wie sie die Hunde mit Knütteln und Steinwürfen verjagten, wie sie ihn verteidigten und vor den wilden Zähnen seiner Gattung erretteten, die doch auch wieder nicht ganz seinesgleichen war. Wenn auch in seinem Hirn keine ganz klare Vorstellung von der Idee der Gerechtigkeit vorhanden war, so fühlte er in seiner Weise doch den Gerechtigkeitssinn der Menschen, und er lernte sie als das kennen, was sie allein waren, nämlich Gesetzgeber und Wächter des Gesetzes. Auch lernte er die Macht, womit sie das Gesetz handhabten, schätzen. Ungleich allen andern Geschöpfen, die er bisher angetroffen hatte, bissen sie nicht, auch kratzten sie nicht. Sie unterstützten jedoch ihre lebendige Stärke durch leblose Dinge, die ihr Geheiß ausführen mußten. So sprangen Stöcke und Steine von diesen seltsamen Wesen gelenkt, wie lebende Dinge durch die Luft und brachten den Hunden Schmerz und Pein.
Das war eine seiner Meinung nach ungewöhnliche und unbegreifliche Macht, die übernatürlich und darum gottähnlich war. Wolfsblut konnte seiner Natur nach nichts von Göttern wissen, höchstens kannte er Dinge, die unbegreiflich waren, aber die staunende Ehrfurcht, die er vor den Menschen empfand, glich in mancher Beziehung den Empfindungen, die der Mensch beim Anblick eines himmlischen Wesens haben würde, das von einer Bergesspitze Blitz und Donner auf die staunende Welt schleudert.
Der letzte Hund war zurückgetrieben. Der tolle Lärm erstarb, und Wolfsblut leckte sich die Wunden und dachte über seine erste Bekanntschaft mit der Grausamkeit eines Rudels nach. Er hatte sich nicht träumen lassen, daß seine eigene Gattung aus mehr als Einauge, der Mutter und ihm selber bestehen könne. Diese hatten eine Gattung für sich gebildet, und jetzt hatte er plötzlich noch viele ähnliche Geschöpfe erblickt. Er fühlte sich unwillkürlich verletzt, daß diese Verwandten gleich beim ersten Anblick über ihn hergestürzt waren und versucht hatten, ihn zu vernichten. Auch nahm er es übel, daß die Mutter angebunden war, wenn es auch durch die höheren Wesen, die Menschen, geschehen war. Es schmeckte nach einer Falle, nach Knechtschaft, wenn er auch von solchen Dingen noch nichts wußte. Frei umherzuschweifen, herumzulaufen, oder sich hinzulegen, wo und wann er wollte, das war sein Erbteil gewesen, und das war ihm nun verwehrt. Die freie Bewegung der Mutter war durch den Stock, an den sie gebunden war, beschränkt, und so war es auch die seine, denn er bedurfte noch der mütterlichen Nähe. Diese Sache gefiel ihm nicht; es gefiel ihm auch nicht, daß, als die Menschen sich erhoben und den Marsch fortsetzten, ein winziges Menschlein den Stock in die Hand nahm und Kische als Gefangene hinter sich herführte. Wolfsblut folgte ihr, aber durch das neue Abenteuer verstört und geängstigt.
Sie gingen das Flußtal entlang und weiter, als er sich je gewagt hatte, und kamen an die Stelle, wo das Flüßchen in den großen Mackenziefluß mündete. Hier waren Boote hoch in der Luft an Stangen befestigt und Vorrichtungen zum Trocknen der Fische aufgestellt, und hier wurde das Lager aufgeschlagen, und Wolfsblut schaute verwunderten Auges zu. Die Überlegenheit der Menschen flößte ihm von Augenblick zu Augenblick größere Ehrfurcht ein. Welche Macht übten sie nicht über die bissigen Hunde aus! Aber noch größer war seiner Meinung nach ihre Macht über die leblosen Dinge, denen sie Bewegung verliehen, und mit denen sie das Aussehen der Welt veränderten. Dies besonders setzte ihn in Erstaunen. Hatten schon die hohen Gerüste aus Latten und Staunen seine Blicks auf sich gezogen, so war das noch nicht das Merkwürdigste, was diese Geschöpfe, die Stöcke und Steine in große Entfernungen schleuderten, machen konnten. Erst als diese Gerüste, indem sie mit Fellen und Geweben bekleidet wurden, sich in Zelte verwandelten, da kannte Wolfsbluts Erstaunen keine Grenzen. Vor allem machte der ungeheure Umfang der Zelte Eindruck auf ihn. Sie stiegen auf allen Seiten um ihn herum empor, wie mächtige, schnell wachsende Formen des Lebens. Sie erstreckten sich, soweit er sehen konnte, und er fürchtete sich davor. Sie sahen unheimlich auf ihn herab, und wenn der Wind sie schaukelnd hin und her bewegte, so duckte er sich und ließ sie nicht aus den Augen, immer bereit, fortzuspringen, sollten sie versuchen, sich auf ihn zu stürzen.
Bald jedoch schwand seine Furcht vor den Zelten. Er sah, wie Hunde es oft versuchten, einzudringen, und mit scharfen Worten und fliegenden Steinen fortgejagt wurden. Er verließ Kisches Seite und kroch vorsichtig an die Wand des nächsten Zeltes. Die Neugier trieb ihn, der Drang zu lernen und Erfahrungen zu sammeln. Die letzten Schritte wurden sehr langsam und vorsichtig zurückgelegt. Die Ereignisse des Tages hatten ihn gelehrt, daß das Unbekannte sich in höchst wunderlicher und überraschender Weise offenbart. Er wartete, aber es geschah nichts. Endlich berührte seine Nase die Zeltleinwand. Er beroch das seltsame Gewebe, das voll von den Gerüchen der Menschen war. Er biß hinein und zerrte daran. Es geschah nichts weiter, als daß die Zeltleinwand sich ein wenig bewegte. Er riß stärker, und die Bewegung wurde gleichfalls heftiger. Das amüsierte ihn, und so zerrte und riß er immer tüchtiger, bis der ganze Bau in Bewegung geriet, worauf die scharfe Stimme einer Indianerin drinnen ihn zu Kische zurücktrieb. Hiernach fürchtete er sich gar nicht mehr vor den unheimlich hohen und breiten Dingen.
Einige Minuten später wanderte er wieder von der Mutter fort. Der Stock, womit sie an den Pflock im Boden gebunden war, erlaubte ihr nicht, ihm zu folgen. Ein junger Hund, etwas größer und älter als er, kam langsam mit sichtlich feindseligen Absichten auf ihn los. Sein Name war, wie Wolfsblut später herausfand, Liplip. Er war in Kämpfen mit jungen Hunden schon erfahren und hatte etwas vom Raufbold an sich. Da Liplip zu Wolfsbluts Gattung gehörte und noch jung war, so erschien er ihm nicht gefährlich, und er schickte sich an, ihm freundlich zu begegnen. Als aber der Fremde mit steifen Beinen auf ihn zukam und ihm die Zähne wies, da wurde auch sein Gang steif, und seine Lippen kräuselten sich. Prüfend drehten sich die beiden im Halbkreis umeinander herum, knurrend und mit gesträubtem Haar. Das dauerte einige Minuten, so daß Wolfsblut anfing, es vergnügt als eine Art Spiel anzusehen. Doch plötzlich sprang Liplip mit staunenswerter Geschwindigkeit zu, biß den Gegner und sprang wieder zurück. Der Biß hatte Wolfsblut in die Schulter getroffen, die durch die Luchsin bis auf den Knochen verwundet worden war. Überraschung und Schmerz erpreßten ihm ein gellendes Geheul, und im nächsten Augenblick sprang er ärgerlich auf Liplip los und biß ihn tüchtig. Allein dieser hatte sein Lebenlang im Lager gelebt und viele Kämpfe mit seinesgleichen gehabt. Dreimal, viermal, ja, ein halbes dutzendmal trafen seine scharfen Zähne den neuen Ankömmling, bis Wolfsblut heulend zur Mutter floh. Dies war der erste der vielen Kämpfe, die er mit Liplip bestehen sollte, denn sie waren die geborenen Feinde, deren Naturen sich stets feindlich bleiben sollten.
Kische leckte Wolfsblut beruhigend mit der Zunge und versuchte, ihn bei sich zu behalten. Aber die Neugier drängte ihn fort, und einige Minuten später wagte er sich auf ein neues Abenteuer. Er traf auf den Grauen Biber, der am Boden saß und mit Reisig und trockenem Moose, das vor ihm lag, herumhantierte. Wolfsblut ging nahe an ihn heran und schaute zu. Der Graue Biber machte mit dem Munde ein Geräusch, doch da es nicht drohend klang, kam jener immer näher.
Die Frauen und Kinder trugen immer mehr Stöckchen und Zweige für den Grauen Biber herbei. Es war augenscheinlich eine wichtige Sache. Wolfsblut kam so dicht heran, daß er das Knie des Grauen Biber berührte, so neugierig war er, so wenig dachte er daran, daß dieser eines der furchtbaren menschlichen Wesen sei. Plötzlich sah er unter den Händen des Grauen Biber aus den Stöckchen und dem Moose etwas Sonderbares emporsteigen, das wie ein Nebel aussah. Dann erschien zwischen den Holzstückchen etwas Lebendiges, das sich wendete und drehte und eine Farbe wie die Sonne am Himmel hatte. Wolfsblut wußte nichts vom Feuer, aber es zog ihn an, wie das Licht am Eingang der Höhle in seinen ersten Lebenstagen es getan hatte. Er kroch die wenigen Schritte bis zur Flamme hin. Er hörte über sich den Grauen Biber kichern, doch der Ton klang nicht feindselig. Dann berührte er mit der Nase die Flamme, und im selben Augenblick streckte er sein Zünglein aus.
Einen Augenblick war er wie gelähmt. Das Unbekannte, das in den Holzstückchen und im Moose gelauert hatte, zwickte ihn derb an der Nase. Er krabbelte zurück und brach in ein klägliches Geheul aus. Bei dem Ton sprang Kische knurrend, soweit der Stock es erlaubte, vorwärts und raste, weil sie ihm nicht zu Hilfe kommen konnte. Allein der Graue Biber lachte laut, schlug sich vor Vergnügen auf die Schenkel und erzählte dem ganzen Lager, was sich zugetragen hatte, bis alle laut lachten. Wolfsblut saß jedoch da und heulte kläglich – ein armes, verlassenes Geschöpfchen mitten unter den Menschen.
Es war der ärgste Schmerz, den er ja gefühlt hatte. Nase und Zunge waren von dem sonnenfarbigen Wesen, das unter den Händen des Grauen Biber aufgesprungen war, versengt. Er heulte unausgesetzt, und jeder neue Klagelaut wurde von den Menschen mit lautem Gelächter begrüßt. Er versuchte, den Schmerz in der Nase mit der Zunge zu lindern, aber auch diese schmerzte, und er war hilfloser und heute hoffnungsloser als je. Dann aber begann er sich zu schämen. Er wußte, was das Gelächter bedeutete. Wie manche Tiere wissen, daß man über sie lacht, das können wir Menschen allerdings nicht begreifen; aber Wolfsblut wußte es, er fühlte sich beschämt, daß die Menschen über ihn lachten. Darum machte er kehrt und lief weg, nicht weil das Feuer ihn verbrannt hatte, sondern weil das Gelächter ihn tief verletzte. Er floh zu Kische, die am Ende ihres Stockes sich wie toll gebärdete, zu Kische, dem einzigen Wesen in der Welt, das mit ihm Mitleid fühlte.
Die Dämmerung brach herein und dann die Nacht, und Wolfsblut lag dicht neben der Mutter. Seine Nase und Zunge taten ihm noch wehe, aber ein noch größerer Kummer peinigte ihn. Er hatte Heimweh. Er fühlte in sich eine Leere, ein Bedürfnis nach der Ruhe, nach der Stille in der Höhle am Flußufer. Das Leben war zu geräuschvoll geworden, es waren zu viele Menschen, zu viele Männer, Frauen und Kinder da, die alle lärmten und ihn störten. Auch zankten die Hunde unaufhörlich und stritten sich und machten tollen Lärm. Die ruhige Einsamkeit seines bisherigen Lebens war dahin; hier war sogar die Luft mit Lärm erfüllt. Es summte und lärmte beständig, die Töne wechselten fortwährend in Höhe und Tiefe, in Stärke und Schwäche, das regte ihm die Nerven und Sinne auf, machte ihn ruhelos und ängstlich und quälte ihn durch die fortdauernde Erwartung dessen, was alles geschehen könnte.
Er beobachtete die Menschen, wie sie gingen und kamen und sich im Lager herumbewegten. So ungefähr würden Menschen die Götter anschauen, die sie sich geschaffen hatten, wie Wolfsblut jetzt auf die Menschen blickte, die sich vor seinen Augen bewegten. Für ihn waren sie wirklich höhere Wesen, für seine unklaren Begriffe verrichteten sie ebenso viele Wunder, wie die Götter es für die Menschen tun würden. Sie waren mächtige Wesen, die allerlei unbekannte, geheimnisvolle Kräfte besaßen, die das Lebendige und das Leblose beherrschten, die das Bewegliche zum Gehorsam zwangen, die dem Regungslosen Bewegung erteilten, und die Leben schufen, sonnenfarbiges Leben, das biß, und das aus dürrem Moos und totem Reisig emporsprang. Sie zündeten Feuer an, und darum waren sie für ihn Götter!