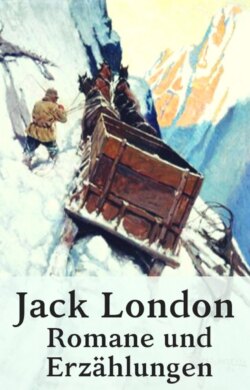Читать книгу Jack London - Romane und Erzählungen - Jack London - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6. Kapitel. Die Hungersnot
ОглавлениеDer Frühling war ganz nahegekommen, als der Graue Biber seine lange Fahrt beendet hatte. Es war wieder April und Wolfsblut ein Jahr alt, als er in das heimische Dorf einzog und Mitsah ihn ausspannte. Obgleich noch nicht völlig ausgewachsen, war er neben Liplip der größte Hund seines Alters. Schon jetzt konnte er sich mit erwachsenen Hunden messen, denn von beiden Eltern hatte er Wucht und Stärke geerbt, und es fehlte ihm nur noch an Breite. Sein Körper war hager und eckig und seine Stärke mehr ausdauernd als gewichtig. Sein graues Fell zeigte die echte Wolfsfarbe, und dem Anschein nach war er ein echter Wolf. Was vom Hunde er von Kische geerbt, hatte ihm körperlich keinen Stempel aufgedrückt, wenn es auch in seiner geistigen Begabung eine Rolle spielte.
Er wanderte durch das Dorf und sah mit ruhiger Befriedigung die Personen wieder, die er vor der langen Fahrt gekannt hatte. Auch die Hunde besah er sich, junge, die, wie er, herangewachsen waren, und erwachsene, die nicht so groß und so schrecklich aussahen wie das Bild, das er von ihnen im Gedächtnis trug. Darum hatte er jetzt weniger Angst vor ihnen und schritt mit einer sorglosen Sicherheit unter ihnen umher, die ihm ebenso neu wie angenehm war. Unter ihnen gab es einen alten, grauen Burschen, Besik, der in früheren Tagen ihm nur die Zähne zu zeigen brauchte, um Wolfsblut die eigene Unbedeutendheit fühlen zu lassen, und durch den er nun erfahren sollte, welche Veränderung mit ihm vorgegangen war.
Beim Zerlegen eines frischerlegten Elches sollte Wolfsblut einsehen lernen, wie verändert seine Beziehungen zu den Hunden jetzt waren. Er hatte einen Huf und einen Teil des Schienbeins bekommen, an dem noch ein gut Stück Fleisch hing. Er hatte sich aus der unmittelbaren Nähe der Hunde entfernt und verzehrte seinen Anteil hinter einem Gebüsch, als Besik auf ihn loskam. Ohne sich lange zu besinnen, hatte Wolfsblut den mutmaßlichen Angreifer zweimal gebissen und war dann zur Seite gesprungen. Dieser war über die Verwegenheit und Schnelligkeit des Angriffs verblüfft und stand und starrte Wolfsblut an, während der blutige Knochen zwischen ihnen lag. Der Alte hatte schon bei den Hunden, die er früher anzuschnauzen pflegte, bittere Erfahrungen gemacht und die Klugheit zu Hilfe rufen müssen, um mit ihnen zu wetteifern. Früher wäre er in angebrachtem Zorn auf Wolfsblut losgesprungen, aber die mangelnden Kräfte erlaubten ihm kein solches Vorgehen mehr. Er sträubte nur wild die Haare und blickte finster nach dem Knochen hinüber. In Wolfsblut erwachte ein gut Teil der früheren Ehrfurcht, er zögerte, ob er nicht doch zurückweichen und einen nicht allzu schimpflichen Rückzug antreten sollte.
Hätte Besik sich damit begnügt, noch weiter drohend und finster zu blicken, so hätte Wolfsblut ihm am Ende den streitigen Knochen überlassen. Allein jener beging den Fehler, nicht zu warten. Er betrachtete den Sieg schon als errungen und machte einen Schritt auf die Beute zu. Als er sorglos den Kopf hinabbog, um diese zu beschnuppern, sträubten sich auch Wolfsbluts Haare. Selbst dann wäre es noch nicht zu spät gewesen, und Wolfsblut wäre endlich weggeschlichen, wäre der andere mit erhobenem Haupte und finsteren Blicken stehen geblieben. Allein der Geruch frischen Fleisches stieg Besik in die Nase, und er fing an, davon zu kosten. Dies war für Wolfsblut zu viel. All die monatelange Herrschaft über die Genossen des Gespanns war ihm zu frisch im Gedächtnis, um müßig dabei stehen zu sollen, wenn ein anderer das ihm zukommende Fleisch verzehrte. Ohne Warnung schnappte er seiner Gewohnheit gemäß zu, und Besiks rechtes Ohr hing in Fetzen herab. Die Plötzlichkeit des Angriffs verblüffte jenen, doch schlimmeres noch sollte mit ebensolcher Plötzlichkeit kommen. Er wurde umgeworfen, am Halse gebissen, und als er sich endlich auf die Füße stellte, brachte ihm der junge Hund noch zwei tiefe Wunden in die Schulter bei. Die Schnelligkeit, womit dies alles vor sich ging, war erstaunlich, Besik leistete zwar Gegenwehr, aber nur schwach, denn seine Zähne schlugen in der leeren Luft zusammen, und einen Augenblick später war ihm die Nase aufgeschlitzt, und er taumelte von dem Knochen zurück.
Das Blatt hatte sich gewendet, und Wolfsblut stand drohend und mit gesträubtem Haar über dem Knochen, während Besik sich zum Rückzug anschickte. Er wagte keinen weitern Kampf mit einem so blitzschnellen Feinde, und von neuem fühlte er mit erhöhter Bitterkeit die Schwäche des herannahenden Alters. Er machte einen Versuch, seine Würde zu behaupten, kehrte ruhig dem jungen Hunde und dem Knochen den Rücken und schritt stolz davon. Erst als er eine Strecke entfernt war, blieb er stehen, um sich die blutenden Wunden zu lecken.
Dies Abenteuer erhöhte Wolfsbluts Selbstvertrauen und seinen Stolz. Festeren Schrittes ging er fortan unter den großen Hunden umher, seine ganze Haltung war nicht mehr demütig. Nicht daß er Streit suchte, aber er verlangte Achtung. Er wollte unbelästigt seines Weges gehen und vor keinem Hunde beiseite treten, kurz, man sollte Rücksicht auf ihn nehmen. Er wollte nicht mehr übersehen werden, wie es den jungen Hunden, selbst den Genossen seines Gespannes, erging. Sie drückten sich vor den großen zur Seite und gaben auch wohl notgedrungen ihren Anteil am Fleisch hin. Aber Wolfsblut, der ungesellig, einsam und verdrossen kaum nach rechts und links blickte, wurde, fremd und zurückhaltend wie er war, von den erwachsenen Hunden als ihresgleichen behandelt. Nach wenigen erbitterten Zusammenstößen fanden sie es wünschenswert, ihn in Ruhe zu lassen und wagten weder feindselige Angriffe noch freundliche Annäherungen, und so tat er dasselbe.
Um die Sommersonnenwende erlebte Wolfsblut etwas Merkwürdiges. Als er lautlos um einen neuen Wigwam strich, der am Ende des Dorfes aufgerichtet worden war, während er mit den Jägern auf der Elchjagd gewesen, stieß er plötzlich auf Kische. Er blieb stehen und blickte sie an. Er erinnerte sich ihrer, wenn auch dunkel, doch das war mehr, als man von ihr sagen konnte. Drohend wies sie mit dem wohlbekannten Knurren ihm die Zähne, und damit wurde die Erinnerung noch deutlicher. Seine vergessene Kindheit, alles was mit diesem Knurren zusammenhing, kam ihm wieder in den Sinn. Bevor er die Menschen gekannt hatte, war sie für ihn der Mittelpunkt der Welt gewesen. Die alten, vertrauten Gefühle jener Zeit stiegen in ihm auf. Er sprang freudig auf sie zu, aber sie empfing ihn mit blitzenden Zähnen und schlitzte ihm die Wange bis auf den Knochen auf. Er verstand das nicht und zog sich verwirrt zurück.
Allein Kische war nicht zu tadeln. Eine Wölfin ist nicht so beschaffen, daß sie sich ihrer früheren Kinder erinnern sollte. Also war Wolfsblut für sie ein Fremder, ein Eindringling, und ihre jetzigen Jungen gaben ihr das Recht, seine Zudringlichkeit übel zu vermerken. Eines der Kleinen kam auf Wolfsblut zugewackelt. Sie waren ja, ohne es zu wissen, Halbbrüder. Wolfsblut beroch das Hündchen neugierig, worauf Kische auf ihn lossprang und ihn abermals biß. Er wich weiter zurück. Die alten Erinnerungen kehrten wieder in die Gruft zurück, aus der sie erstanden waren. Er sah zu, wie Kische das Junge leckte und dann und wann inne hielt, um ihn anzuknurren. Sie war ihm nichts mehr, er hatte auch ohne sie fertig werden müssen. Was sie ihm gewesen, war dahin; in seinem Leben hatte sie keine Stelle mehr, noch er in dem ihrigen.
Er stand noch immer verblüfft da und wunderte sich, was das alles eigentlich bedeutete, als sie ihn zum drittenmale forttrieb. Er ließ es geschehen, war sie ja eine Hündin, die er nicht angreifen durfte. Er wußte nicht aus Erfahrung, daß es Gesetz sei, daß die Geschlechter sich nicht bekämpfen dürfen, aber ein geheimer Trieb sagte es ihm, ein Instinkt wie der, welcher ihn zwang, nachts den Mond und die Sterne anzuheulen und den Tod und das Unbekannte zu fürchten.
Die Monate vergingen. Wolfsblut nahm an Stärke, Gewicht und Breite zu, und sein Charakter entwickelte sich nach dem Gesetz der Vererbung und dem der Umgebung. Was ihm angeboren, war gleichsam der Lehm, aus dem er geformt war, und dieser konnte in verschiedenen Formen geknetet werden, ihm aber besondere Gestalt zu geben, dazu diente die Umgebung. Wäre Wolfsblut nie zum Feuer der Menschen gekommen, so hätte die Wildnis einen echten Wolf aus ihm gemacht. Nun hatten die Menschen ihm eine andere Umgebung gegeben, und er war zum Hunde geworden, der zwar etwas Wölfisches hatte, aber immerhin mehr Hund als Wolf war.
Also nahm durch die Beschaffenheit seiner Natur und durch den Drang der Umstände sein Charakter immer bestimmtere Formen an. Dem war nicht abzuhelfen. Er wurde immer mürrischer, ungeselliger, einsamer, jähzorniger, und die Hunde sahen bald ein, daß es besser war, mit ihm im Frieden als im Streit zu leben, während der Graue Biber anfing, ihn von Tag zu Tag höher zu schätzen.
Nur eine Schwäche konnte er nicht loswerden; er konnte es nicht vertragen, von den Menschen ausgelacht zu werden. Mochten sie unter sich über alles mögliche lachen, das war ihm gleichgültig, nur nicht über ihn. Das machte ihn wütend. Ernst, würdevoll und düster wie er war, brachte das Gelächter ihn bis an den Rand der Tollheit. Es beleidigte und regte ihn so sehr auf, daß er noch stundenlang nachher sich wie ein Besessener gebärdete. Wehe dem Hunde, der ihm alsdann in die Quere kam! An dem Grauen Biber, das wußte er, durfte er sich nicht rächen, der hatte einen Knüttel und eine höhere Macht hinter sich. Aber die Hunde hatten das nicht, und so flohen sie, wenn Wolfsblut, durch das Gelächter toll gemacht, auf der Bildfläche erschien.
Im dritten Jahr seines Lebens brach über die Indianer am Mackenzie eine Hungersnot herein. Im Sommer waren die Fische knapp gewesen, und im Winter verließen die Renntiere ihr gewöhnliches Standquartier. Die Elche wurden selten, die Kaninchen verschwanden fast ganz, und die Raubtiere starben oder fielen übereinander her. Nur die Starken blieben am Leben. Die Indianer waren von jeher nur Jäger gewesen, also starben die Alten und Schwachen vor Hunger. Es war viel Jammer und Wehklagen im Dorfe, denn die Frauen und Kinder hungerten, damit das Wenige, was noch da war, den hagern, hohläugigen Männern zugute käme, die vergeblich in die Wälder auf Jagd auszogen. So groß war die Not, daß die Menschen das weiche Leder ihrer Mokassins und Handschuhe verzehrten, während die Hunde sich über die Riemen und selbst über die Peitschenschnüre hermachten. Auch fraßen die Hunde einander auf und die Menschen aßen die Hunde. Die Schwächsten und Wertlosesten von ihnen wurden dann zuerst verzehrt. Die übriggebliebenen Hunde sahen das und verstanden es. Einige der kühnsten und klügsten verließen die Feuer des Lagers, das zur Schlachtbank geworden war, und flohen in den Wald, wo sie jedoch entweder verhungerten oder von den Wölfen zerrissen wurden.
In dieser Zeit des Elends schlich auch Wolfsblut fort in die Wälder. Er war durch seine erste Kindheit besser als die andern Hunde für dies Leben vorbereitet. Er war besonders geschickt, die kleinen Lebewesen zu überfallen. Er pflegte stundenlang im Verborgenen zu liegen, um jede Bewegung eines argwöhnischen Eichhörnchens mit einer Geduld zu verfolgen, die nur mit dem ihn peinigenden Hunger sich messen konnte. Selbst wenn das Eichhörnchen sich auf den Boden wagte, war Wolfsblut noch nicht voreilig, sondern wartete, bis jenem der Rückzug auf den Baum abgeschnitten war. Dann erst sprang er wie ein Blitz aus seinem Versteck hervor und verfehlte auch nie das Ziel.
So viel Erfolg er auch mit diesen Tierchen hatte, so war es doch nicht zum Sattwerden, denn es waren ihrer zu wenige da. Also stellte er noch kleineren Tieren nach. Sein Hunger war so groß, daß er es nicht verschmähte, die Waldmäuse aus ihren Löchern im Boden auszugraben, ebenso wie er es auch nicht für unter seiner Würde hielt, mit irgend einem hungrigen Wiesel, das noch blutdürstiger als er selber war, zu kämpfen.
Wenn der Hunger ihn gar zu sehr quälte, schlich er zum Lager der Indianer zurück, aber er näherte sich demselben nicht zu sehr. Er lauerte im Walde und beraubte die Schlingen und Fallen in den seltenen Fällen, wenn ein Wild sich darin gefangen hatte. Er stahl sogar dem Grauen Biber ein Kaninchen, als dieser vor Schwäche taumelnd und durch Atemmangel oftmals genötigt sich hinzusetzen, durch den Wald daherkam.
Eines Tages traf Wolfsblut einen jungen Bruder, der schwach und matt vor Hunger und so mager wie ein Gerippe war. Wäre er nicht selber hungrig gewesen, so wäre er vielleicht mitgelaufen und hätte den Weg zu den Brüdern gefunden, nun aber warf er den Wolf zu Boden, tötete und verzehrte ihn.
Das Glück war ihm hold. Immer wenn er am schlimmsten daran war, fand er Beute, auch wollte es der Zufall, daß er dann auf kein größeres Raubtier stieß. Einstmals kam ein Rudel hungriger Wölfe auf ihn losgestürzt, und sie verfolgten ihn lange und grausam; da er aber besser genährt war wie sie – denn er hatte in den Tagen vorher einen Luchs verzehrt –, so gewann er ihnen einen Vorsprung ab. Ja, mehr noch, als er in weitem Bogen um sie herumlief, überfiel er einen seiner erschöpften Verfolger. Darauf verließ er die Gegend und wanderte nach dem Tal, wo er geboren war. Hier traf er in der alten Höhle Kische, die wie er die ungastlichen Feuerstätten der Menschen verlassen hatte und in den alten Schlupfwinkel gekommen war, um für ihre Jungen Schutz zu suchen. Allein nur eines davon war am Leben geblieben, und auch dieses hatte bei der Hungersnot wenig Aussicht leben zu bleiben.
Kisches Begrüßung des nun erwachsenen Sohnes war durchaus nicht liebevoll. Aber Wolfsblut machte sich nichts daraus; er bedurfte der Mutter nicht mehr. Also kehrte er ihr bedächtig den Rücken und trabte das Flüßchen hinauf. An der Gabelung schlug er den Weg zur Linken ein und kam an das Lager der Luchsin, mit der die Mutter und er einst auf Leben und Tod gekämpft hatten. Hier an verlassener Stätte ließ er sich nieder und ruhte einen Tag aus.
Am Anfang des Sommers, als die Not zu Ende ging, traf er auf Liplip, der ebenfalls in die Wälder geflohen war und ein elendes Dasein geführt hatte. Es geschah ganz unerwartet. Sie kamen in entgegengesetzter Richtung um den Fuß eines steilen Bergabhanges getrabt, und als sie um eine Felsenecke bogen, standen sie sich plötzlich Angesicht zu Angesicht gegenüber. Einen Augenblick hielten sie erschrocken inne und blickten sich mißtrauisch an. Wolfsbluts Jagd war in den letzten acht Tagen sehr erfolgreich gewesen, und er war wohlgenährt. Sobald er jedoch Liplip erblickte, richtete sich unwillkürlich sein Haar am Rücken empor. Das war der körperliche Ausdruck des geistigen Zustands, in den in früheren Tagen ihn Liplips Rauflust und Verfolgungssucht versetzt hatte. Der andere versuchte auszuweichen, doch Wolfsblut stieß ihn so kräftig mit der Schulter, daß jener das Gleichgewicht verlor und auf den Rücken rollte. Ein Biß in den mageren Hals und Liplip rang mit dem Tode, während Wolfsblut mit steifen Beinen und gespanntem Blick rund um den Feind herum ging. Darauf setzte er seine Wanderung fort, indem er den Bergabhang entlang weiter trabte.
Einige Tage später kam er an den Rand des Waldes, wo ein schmaler Streifen freien Landes sich nach dem Mackenzie hinabzog. Früher war es dort kahl gewesen, jetzt stand ein Dorf da. Unter den Bäumen verborgen blieb er stehen und überschaute die Gegend. Der Anblick, die Töne, die Gerüche waren ihm wohlbekannt. Es war sein altes Dorf, nur an einem anderen Platze. Doch war jetzt alles anders als damals, als er daraus geflohen war. Es gab kein Jammern, kein Wehklagen mehr. Töne behaglicher Zufriedenheit begrüßten sein Ohr. Zwar vernahm er die scheltende Stimme einer Frau, allein dieser Ärger kam aus einem vollen Magen, das wußte er. Auch roch es in der Luft nach Fischen. Es war also wieder Speise da, die Not war vorüber. Wolfsblut kam dreist aus dem Walde heraus und trabte ins Lager gerade auf den Wigwam des Grauen Biber los. Dieser war nicht da, aber Klukutsch begrüßte ihn mit einem Freudengeschrei und gab ihm einen ganzen Fisch, und er legte sich nieder, um die Rückkehr des Herrn zu erwarten.