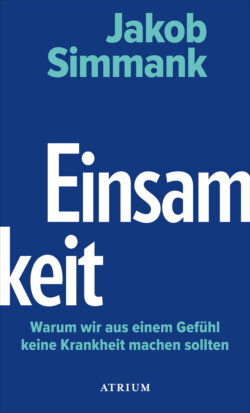Читать книгу Einsamkeit - Jakob Simmank - Страница 3
Kapitel 1 Wie Einsamkeit zur »Krankheit« wurde
ОглавлениеWer einmal Paviane im Zoo oder in der Savanne Ostafrikas beobachtet hat, dem ist vielleicht aufgefallen: Die Primaten haben nicht nur klare Hierarchien, sondern sind auch soziale und liebevolle Wesen. Mütter nehmen ihre Kinder in den Arm, Väter spielen mit ihnen. Bis sie ein Jahr alt sind, sitzen die Pavianjungen auf dem Rücken der Mutter. Sie krallen sich mit ihren Händen im Fell fest oder umschlingen den Bauch der Mutter mit ihren Beinen, um nicht herunterzufallen. Es sind dabei aber nicht allein die biologischen Eltern, die sich um die Jungtiere kümmern. Schwestern und nichtverwandte Weibchen helfen sich gegenseitig dabei, ihre Kinder großzuziehen, und Männchen helfen, Essen zu besorgen. Das zeigt Wirkung. Je besser ein Weibchen es schafft, Beziehungen zu anderen Weibchen aufzubauen, je mehr Vertraute es gewissermaßen hat, desto größer ist die Chance, dass seine Kinder am Leben bleiben, erwachsen werden und selbst Nachwuchs bekommen[8].
Das Beispiel der Paviane ist deshalb so interessant, weil es uns etwas zeigt, das für die mit Pavianen eng verwandten Menschen genauso gilt, wahrscheinlich sogar noch stärker: Soziale Bindungen können für das Überleben elementar sein[9].
Und das hat Folgen: Wenn mehr Kinder aus Familien überleben, die besonders gut sozial integriert sind, setzen sich Gene durch, die Menschen sozialer machen. Das dürfte die Kultur des menschlichen Zusammenlebens geprägt haben, was sich wiederum auf unseren Genpool ausgewirkt haben wird. Diese Ko-Evolution von Kultur und Genen[10] hat den Menschen »ultrasozial« gemacht, sagen Biologen. Wenn der Mensch eines besonders gut kann, dann ist es, mit anderen zu kooperieren. Was abstrakt klingt, ist für das Verständnis der menschlichen Einsamkeit und ihrer möglichen Folgen essenziell.
Aber bleiben wir zunächst bei der »Ultrasozialität«. Noch stärker als Primaten sind wir Menschen auf Hilfe angewiesen, um unseren Nachwuchs (und damit unsere Gene) durchzubringen. Menschliche Kinder bedürfen besonders viel Zuneigung und Pflege, denn sie werden so unreif geboren wie die Jungen keiner anderen Säugetierspezies: Babys können zu Beginn des Lebens kaum sehen, sich nicht fortbewegen und kaum kommunizieren. Das Gehirn menschlicher Neugeborener hat einen Gutteil seiner Wachstumsschübe noch vor sich. Seine Größe wird sich im Laufe des Lebens vervierfachen[11]. Zum Vergleich: Ein Schimpansengehirn wächst gerade einmal auf die doppelte Größe an. Dass Menschen ihren Nachwuchs so unreif gebären, hat wohl einen ganz praktischen Grund. Hätte das Gehirn des Kindes seine endgültige Größe schon vor der Geburt erreicht, würde der Kopf niemals durch das Becken der Gebärenden passen.
Dass wir Menschen auch im Verhältnis zu unserer Körpergröße so große Gehirne haben, vor allem eine sehr dicke und ausgedehnte Hirnrinde, liegt daran, dass Menschen ein äußerst »soziales Gehirn« haben, glaubt der bekannte Anthropologe Robin Dunbar. Einen Großteil unserer Hirnkapazitäten brauchen wir, um die vielen komplizierten sozialen Interaktionen zu managen, die unser Überleben sichern[12]: um den genervten Unterton des Kassierers an der Kasse herauszuhören, die drohende Körperhaltung der Chefin, die einen Bericht erwartet, zu erkennen und die richtigen Worte zu finden, um dem eigenen Sohn zu erklären, warum seine vermeintlich beste Freundin ihn nicht zum Kindergeburtstag eingeladen hat.
Dunbar betont, dass für den Menschen eine Art der sozialen Beziehung besonders wichtig ist: »intensive Formen der Paarbindungen«. Er dürfte damit enge Familienbande meinen, bedeutsame Freundschaften und von Liebe und Verständnis getragene Partnerschaften. Sich Menschen zugehörig fühlen zu wollen sei ein evolutionär geformtes Bedürfnis, schreiben auch die Evolutionspsychologen Roy Baumeister und Mark Leary[13]. Alles in uns Menschen, glauben sie, strebt darauf hin, eng in soziale Netze integriert zu sein. Kein Wunder also, dass es vielen Menschen in Pandemiezeiten so schwerfällt, Distanz zueinander zu halten.
Der inzwischen verstorbene Einsamkeitsforscher John Cacioppo verglich das Bedürfnis, sich sozial aufgehoben zu fühlen, mit dem Drang, genügend zu essen und zu trinken zu haben und Kinder zu bekommen. Genau wie Hunger und Durst, schreibt Cacioppo in seinem Buch Loneliness, sei auch Einsamkeit ein evolutionär altes Alarmsignal. Sie signalisiere uns, dass wir in die Gruppe zurückkehren sollen, die uns Schutz bietet – ursprünglich, das heißt zu Beginn der Menschheitsgeschichte, vor Raubtieren und vor dem Verhungern.
Viele Psychologen wie Cacioppo halten Gefühlszustände primär für etwas, das in der Evolution entstanden ist, um unser Verhalten zu lenken. Ekel hält uns von verfaulten Speisen fern und schützt uns damit vor Infektionen mit Durchfallkeimen. Die Angst vor Blut lässt uns besonders vorsichtig auf einen Baum klettern, damit wir uns ja nicht den Arm aufratschen[14]. Und Freude oder Euphorie motiviert uns, angenehme Dinge wie Sex zu wiederholen. Einsamkeit – für Cacioppo vor allem das Gefühl, von anderen Menschen isoliert zu sein – erzeuge das Bedürfnis, in den Schoß der Gemeinschaft zurückzukehren. Er schreibt:
»Das Gehirn hat sich dahingehend entwickelt, den Zustand des sozialen Körpers genauso zu überwachen wie den Zustand des physischen Körpers. So wie Schmerz als Signal dient, das uns auf Gefahren oder Schäden am physischen Körper hinweist und darauf reagieren lässt, dient Einsamkeit förmlich als Signal, das uns auf Gefahren oder Schäden am sozialen Körper hinweist und eine Antwort auf sie provoziert. […] Das unangenehme Gefühl der Einsamkeit veranlasst uns, den Anschluss [an die Gruppe] zu erneuern, und fördert Vertrauen, Gruppenzugehörigkeit und kollektives Handeln.«[15]
Im Optimalfall passiert also Folgendes: Das Alarmsignal Einsamkeit triggert ein Verhalten, der Mensch kehrt in die Gruppe zurück, das Bedürfnis nach Verbundenheit ist befriedigt, die Einsamkeit erlischt.
Nur was, wenn das nicht geschieht, wenn die Einsamkeit chronisch wird?
Dann beginnt ein Teufelskreis, der die Wahrnehmung von Menschen verändert, sie unter Dauerstress setzt und sie im schlimmsten Falle krank macht. Denn Einsamkeit führt noch zu etwas anderem, schreibt Cacioppo. Durch ihre Funktion als Gefahrensignal schärft sie unsere Aufmerksamkeit gegenüber jedwedem Risiko – auch in sozialen Situationen. Einsame Menschen sehen die Welt wie durch einen Schleier der Negativität. Sie hören in Gesprächen jeden noch so kleinen Fetzen Kritik und messen ihm mehr Bedeutung zu als nichteinsame Menschen. Sehen sie glückliche Menschen, macht ihnen das keine Freude, es kann ihnen sogar wehtun. Einsame Menschen sehen in den kleinen Nickligkeiten des Alltags – einer Steuernachzahlung, die höher ausfällt als erwartet, oder einer Absage eines Bekannten, mit dem sie essen gehen wollten – viel schneller große Probleme: den finanziellen Ruin oder das Ende der Freundschaft. Chronisch einsame Menschen können durchaus Freunde oder einen Partner haben. Aber sie lassen sich schlechter durch deren Unterstützung trösten[16]. Wer einsam ist, verliert sein Selbstwertgefühl. Das Gefühl, mit anderen verbunden zu sein, so Cacioppo, sei wie ein Gerüst für unser Selbst: »Beschädige das Gerüst, und der Rest des Selbst beginnt zu bröckeln.«[17]
Diese verzerrte Wahrnehmung wiederum führt in eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Einsame Menschen schieben die Menschen von sich weg, denen sie eigentlich nah sein wollen. Weil einsame Menschen im Schnitt weniger von einem Treffen mit anderen Menschen erwarten und ihre Wahrnehmung der anderen Person negativer gefärbt ist, kommt es regelmäßig dazu, dass sie Zurückweisung erfahren. Wer einen Bekannten kritisiert oder bei einem Treffen wortkarg herummault, wird dafür natürlich keine Zuneigung bekommen[18].
Gefühlte Einsamkeit – das zu zeigen, ist Cacioppos große wissenschaftliche Errungenschaft – kann in einen Teufelskreis führen, der Menschen nur noch einsamer macht. Aber was für einen Sinn soll das Ganze evolutionär gehabt haben? Darauf hat die Wissenschaft noch keine schlüssige Antwort gefunden. Cacioppo vergleicht – einmal mehr, hier allerdings kaum überzeugend, finde ich – Einsamkeit mit Hunger. Zwar würden Menschen, die Hunger haben, Essen suchen. Ihr Geschmackssinn aber reagiere viel sensibler auf Bitterkeit als auf Süße. Ein bitterer Geschmack zeigt, dass etwas giftig sein könnte. Auch Interaktionen mit Menschen könnten buchstäblich giftig oder nahrhaft sein. Und für die Giftigkeit hätten wir nun einmal sensiblere Antennen.
Interessanter als die Frage, warum Einsamkeit in einen Teufelskreis führt, ist aber ohnehin die Frage, welche Folgen dieser Teufelskreis hat. Eine Frage, die uns zurück zu Cacioppos TED Talk führt, in dem er zeigt, dass Einsamkeit – der rote Balken – für die Gesundheit gefährlicher sei, als ein Alkoholproblem zu haben. Wir erinnern uns: Chronisch einsam zu sein, sei so gefährlich, wie jeden Tag fünfzehn Zigaretten zu rauchen. Nur wie kann das sein?
Um die Effekte der Einsamkeit auf die Gesundheit und unser Erleben zeigen zu können, entwickelten Wissenschaftler um John Cacioppo eine einfache Skala[19]. Die drei wichtigsten Fragen, auf die man mit »so gut wie nie«, »manchmal« oder »häufig« antworten kann, lauten:
1. Wie oft empfinden Sie, dass Ihnen ein anderer Mensch fehlt?
2. Wie oft fühlen Sie sich verlassen?
3. Wie oft fühlen Sie sich von anderen isoliert?
Die Skala setzten die Forscher Hunderten von Probanden vor, Studierenden und älteren Menschen, und fragten in Telefoninterviews Tausende Menschen danach[20]. Dann untersuchten sie, was einsame von nichteinsamen Menschen unterschied. Im Laufe der Jahre trugen sie dabei allerlei zusammen. Die Ergebnisse überraschen noch heute. Einsamkeit hat ganz offensichtlich einen Einfluss auf unterschiedlichste Funktionen des menschlichen Körpers und der menschlichen Psyche, von der Impulskontrolle bis hin zum Immunsystem. Dieser Einfluss war in vielen Bereichen deutlicher, als man hätte vermuten können.
Einer der Haupteffekte der Einsamkeit ist Stress[21]. Menschen, die einsam sind, haben morgens eine deutlich größere Menge des Stresshormons Cortisol im Urin. Einsamkeit scheint die Stressachse zu aktivieren, die vom Gehirn abwärts zur Nebenniere verläuft. Der Hypothalamus, die Schaltstelle des autonomen Nervensystems im Gehirn, gibt Signale an die Hirnanhangsdrüse weiter. Die wiederum aktiviert die Nebennierenrinde, die Cortisol ins Blut freisetzt. Das hat Verschiedenes zur Folge: Der Blutzucker steigt, denn der Körper braucht in einer Gefahrensituation viel Energie; das Immunsystem wird gebremst; und viele Dinge, die der Körper normalerweise konstant tut, neues Knochengewebe aufbauen etwa, werden auf später verschoben. Auch vom Stresshormon Adrenalin[22] haben Einsame mehr im Blut. Und Studien zeigen, dass der Gefäßwiderstand steigt, ein wichtiger Marker für den Blutdruck.
Nun hat Stress per se keinen Krankheitswert, sondern ist eine normale Anpassungsreaktion auf das, was Menschen geschieht. Der Mensch, genau wie viele Tierarten, hätte sich ohne Stress auf der Erde niemals behaupten können. Immer wenn der Mensch Gefahren ausgesetzt ist, braucht er einen Tunnelblick und einen Organismus, der alle nicht lebenswichtigen Funktionen pausiert und möglichst viel Energie zur Verfügung stellt.
Erst wenn Stress chronisch wird, wird er zum Problem. Sinken die Blutspiegel der Stresshormone nicht mehr ab und bleiben Blutdruck und Blutzucker deshalb erhöht, greift das die Gefäße an. Normalerweise führt ein hoher Cortisolspiegel im Blut dazu, dass weniger Cortisol ausgeschüttet wird. Es gibt eine Art negative Rückkopplung, die verhindern soll, dass die Cortisolspiegel ins Unermessliche steigen. In einem Telefonat erklärte mir Martin Keck, ehemaliger Direktor der Klinik des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, vor Kurzem, dass das bei chronischem Stress irgendwann nicht mehr funktioniert: »Das Gehirn verliert die Kontrolle über die Stresshormonachse.« Es werde einfach immer mehr Cortisol ausgeschüttet. Eine mögliche Folge: Der andauernde Stress begünstigt psychische Erkrankungen wie Depressionen[23].
Studien zeigen in der Tat, dass Einsamkeit und Depression eng zusammenhängen, Einsamkeit könnte auch bei Suiziden eine bedeutende Rolle spielen[24]. Einsamkeit und depressive Störungen korrelieren statistisch so stark miteinander, dass einzelne Psychologen und Psychiater immer wieder vorbrachten, es müsse sich schlicht um ein und dasselbe Phänomen handeln. Inzwischen widersprechen viele Wissenschaftler, darunter Cacioppo, dieser Einschätzung jedoch: Zwar empfinden sowohl einsame als auch depressive Menschen Schmerzen und Hoffnungslosigkeit, schreibt Cacioppo, aber Einsamkeit zeichne sich durch »die Hoffnung aus, dass alles perfekt sei, wenn nur die einsame Person mit einer anderen Person vereint sein könne«[25]. Der einsame Mensch sucht laut Cacioppo vor allem nach einem: einer tiefen Verbundenheit mit anderen Menschen.
Studien versuchten zu verstehen, ob Depression Einsamkeit vorausgeht oder andersherum. Das Ergebnis: Einiges deutet darauf hin, dass es Einsamkeit ist, die zu Depressionen führt – auch wenn umgekehrt eine depressive Stimmung Einsamkeit verschlimmern kann. Wie genau Einsamkeit und Depression zusammenhängen – ob über den Weg des chronischen Stresses und eine freidrehende Stresshormonachse oder über den Schleier der negativen Erwartungen und ein angegriffenes Selbstbild –, ist jedoch nicht abschließend geklärt.
Das Immunsystem einsamer Menschen kann durch einen chronisch hohen Cortisolspiegel geschwächt werden[26]. Die Zahl ihrer natürlichen Killerzellen, die Viren und Krebszellen angreifen, ist tendenziell niedrig, die Konzentration gewisser Bestandteile des Blutgerinnungssystems hingegen hoch[27]. Und besonders eindrücklich greift Einsamkeit den Schlaf von Menschen an (was wiederum ebenfalls das Immunsystem schwächt). Einsame Menschen fühlen sich, obwohl sie nicht weniger schlafen, oft weniger ausgeruht. Sie schleppen sich müde durch den Tag. Einer der Gründe könnte sein, dass einsame Menschen des Nachts oft kurz aus dem Schlaf hochschrecken. Schlafforscher sagen, ihr Schlaf sei fragmentiert[28]. Aus evolutionärer Sicht ergibt das natürlich Sinn. Denn unsere Vorfahren, wenn sie allein übernachteten, liefen Gefahr, im Schlaf von Raubtieren oder rivalisierenden Gruppen überrascht zu werden. Ein leichter Schlaf, aus dem man schnell wieder erwacht, konnte überlebenswichtig sein.
Natürlich gibt es noch andere, ganz praktische Wege, auf denen Einsamkeit die Gesundheit beeinflusst. Diese werden wir uns später noch einmal genauer ansehen. Bleiben wir aber erst einmal bei der vorherrschenden These, die Cacioppo geprägt hat und die besagt, dass Einsamkeit sich vor allem über veränderte Körperfunktionen auf die Gesundheit von Menschen auswirkt. Eine gestörte Immunfunktion, ein erhöhter Blutdruck und Dauerstress, so stellen es sich Mediziner vor, könnten handfeste Krankheiten verursachen[29]. Und zwar nicht nur psychische wie Depressionen, sondern auch körperliche: Inzwischen zeigen Studien mit Hunderttausenden Probanden, dass einsame Menschen im Schnitt häufiger eine Alzheimer-Demenz entwickeln, häufiger schwer übergewichtig sind und erhöhte Blutfettwerte haben, häufiger Herzkreislauferkrankungen bekommen und unter Umständen sogar häufiger Krebs. Studien, die Daten aus verschiedenen Untersuchungen zusammennehmen und Millionen von Menschen über Jahre beobachtet haben, legen nahe: Einsame Menschen sterben viel früher als Menschen, die sich nicht einsam fühlen[30].
Dass John Cacioppo in seinem TED Talk den Einsamkeitsbalken rot einfärbte, scheint also berechtigt. Einiges deutet darauf hin, dass Einsamkeit schwerwiegende Folgen haben kann – zumindest, wenn man die Einsamkeit so versteht wie Cacioppo. Wichtig ist: Man muss sein Einsamkeitsverständnis nicht teilen. Warum, werden wir im nächsten Kapitel sehen.
Es ist trotzdem interessant, dass Cacioppos Arbeit so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Denn dass es einen Zusammenhang zwischen sozialen Beziehungen und der Gefahr, frühzeitig zu sterben, gibt, vermuteten US-amerikanische Soziologen schon Ende der Achtzigerjahre[31]. Die Debatte ist keineswegs neu. Was neu ist, ist die Einengung auf das Gefühl der Einsamkeit. Inzwischen gibt es Tausende von Studien und Zeitungsartikeln, die sich vor allem mit dem emotionalen Begriff der Einsamkeit auseinandersetzen. Es scheint so, als musste ein wichtiges gesellschaftliches Thema erst emotionalisiert werden, bevor es die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient.
Mittlerweile wird seit Jahren in den USA und in England über die vermeintlichen Gefahren des Gefühls gesprochen. In Deutschland nahm die Debatte an Fahrt auf, als der Bestsellerautor Manfred Spitzer sich der Einsamkeit widmete. Spitzer ist Professor für Psychiatrie in Ulm und bekannt für angsteinflößende Bücher wie Digitale Demenz und Cyberkrank, in denen er versucht zu zeigen, dass Internet, Smartphones und Computer Kinder süchtig und dumm machen. Dass er es mit der Wissenschaft dabei nicht immer ganz so ernst nimmt, wurde vielfach kritisiert[32].
In einer Spitzer-typischen Zuspitzung heißt es auch gleich auf der ersten Seite seines 2018 erschienenen Buches Einsamkeit: »Einfach gesagt: Einsamkeit ist nicht ›nur‹ ein Symptom«, d.h. ein Krankheitszeichen, »sondern sie ist eine Krankheit selbst!« Bei Spitzer wird die Einsamkeit zur »Todesursache Nummer eins«, zur »ansteckenden« und »unerkannten« Epidemie.
Spätestens hier wirkt es so, als habe eine wichtige Debatte so lange an Fahrt aufgenommen, bis sie wie ein zu schnell fahrender Zug entgleist ist. Deswegen ist es an dieser Stelle wichtig, einen Schritt zurückzutreten. Was wird da propagiert? Einsamkeit, eben noch ein Gefühl, soll eine Krankheit sein? Die gefühlte Einsamkeit ist ein »Killer«? Auf den ersten Blick mögen diese Thesen richtig erscheinen. Die evolutionspsychologischen Erklärungen der Rolle der Einsamkeit sind schlüssig, und die Ergebnisse großer Studien mahnen, dass sich etwas ändern muss, wollen wir als Gesellschaft Menschen Leid ersparen. Aber wer genauer hinschaut, wird sehen, dass es so einfach nicht ist. In den nächsten beiden Kapiteln will ich genau das tun: näher hinschauen. Zunächst werden wir in Kapitel zwei nach Antworten auf die Frage suchen, die Manfred Spitzers Buch, aber auch Medienberichte aufwerfen, nämlich: Was ist Einsamkeit eigentlich genau? Dann wird es in Kapitel drei noch einmal darum gehen, was die Studien wirklich über Einsamkeit als Risikofaktor für Krankheiten aussagen – und was das mit der Gesellschaft zu tun hat.