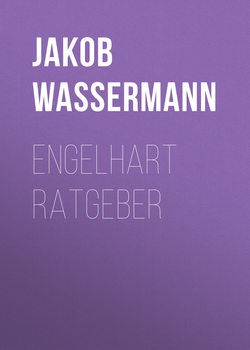Читать книгу Engelhart Ratgeber - Jakob Wassermann - Страница 5
Fünftes Kapitel
ОглавлениеAdele Spanheims Herrlichkeit nahm bald ein Ende. Eines Nachmittags betrat Herr Ratgeber wider seine Gewohnheit die Küche und sah, daß Fräulein Adele mit träumerisch aufgerissenen Augen vor einem Topf mit eingemachten Preiselbeeren saß und von Zeit zu Zeit einen Kaffeelöffel voll in den Mund steckte. Gerda und Abel kauerten lüstern dabei, man spürte, wie ihnen der Mund wässerte. Da Herr Ratgeber auch sonst unzufrieden war mit der Leitung des Haushalts, sagte er: jetzt ist es genug, und gab der naschhaften Dame den Laufpaß. Damit gewann die Sorge um die führerlosen Kinder neue Macht.
Herr Ratgeber hatte sich inzwischen mit seinem Bruder Hermann endgültig entzweit. Er war im Begriff, aus dem gemeinsamen Geschäft zu scheiden und eine Fabrik zu gründen; Produzent sein, die Ware gleichsam aus dem Nichts erschaffen, die Hände des Arbeiters unmittelbar in seinen Dienst nehmen, Maschinen in Betrieb setzen und im großen Stil wirtschaften, das war sein Traum. Er hatte es satt, Bänder und Pfeifenspitzen zu verkaufen, wie er sich verächtlich ausdrückte, und um jeden Groschen Verdienst mühevoll schwatzen zu müssen. Nach langen Erwägungen entschloß er sich für die Holzwarenbranche, und da er vorerst nicht viel von der Sache verstand, suchte er sich durch nächtelanges Studieren zu helfen. Aber so stolz seine Pläne waren, es fehlte Herrn Ratgeber an Kapital. Er wandte sich an den reichen Bruder seiner verstorbenen Frau, und da er eine wunderbar überzeugende Art zu schreiben hatte, ließ sich Michael Herz bestimmen, zehntausend Mark herzugeben. Aber damit hatte Herr Ratgeber nicht genug. Er war leidenschaftlich bemüht, seiner Idee unter den bisherigen Geschäftsfreunden geldkräftige Anhänger zu gewinnen, und phantasievoll und tatgierig, wie er war, versprach er einem jeden goldne Berge. Mit weithinaus gerichtetem Blick ging er in dieser Zeit umher, beständig ein Lächeln zwischen den Lippen verhüllend, welches sagen sollte: Laßt mich nur gewähren, laßt mich nur ans Ruder kommen. Er glaubte, die Stunde sei reif, wo er die nacheilenden Schatten seiner bedrückten Jugend in die Flucht schlagen könne, und sagte sich mit stürmischer Entschlossenheit: Es muß sein, muß gelingen. Dieses Muß trieb ihn zeit seines Lebens von Mühsal zu Mühsal und von Mißlingen zu Mißlingen.
Nun gab es einen Mann in der Stadt, der das Treiben des Herrn Ratgeber mit der größten Neugierde verfolgte. Er hieß Teilheimer, hatte brandrote Haare, ein mit Sommersprossen bedecktes Gesicht, und sein Beruf war, über die Angelegenheiten seiner Mitbürger aufs genaueste unterrichtet zu sein. Er saß zum Beispiel im Wirtshaus und summte scheinbar achtlos vor sich hin. Da ging der Weinhändler Strunz am Fenster vorüber. Teilheimer zwinkerte listig mit den Augen und sagte: »Schau, schau, da geht der Strunz zum Bezirksarzt, um seinen fälligen Wechsel einzukassieren; wird ihm aber nichts nutzen, der Mann hat selbst kein Geld und der Schwiegervater gibt nichts mehr her; böse Geschichte.« Oder man redete in einer Gesellschaft über das gesunde Aussehen und die Frische einer schönen Frau, was den roten Teilheimer zu der beiläufigen Bemerkung veranlaßte, daß diese Frau den Krebs in der Leber sitzen habe und daß ihr nur noch ein Jahr und etliche Tage zu leben vergönnt sei.
Dieser magische Seher machte sich auf, um Herrn Ratgeber beizustehen. Eines Tages kam Engelhart von der Schule und stürmte ins Zimmer. Da sah er den Vater am Ofen stehen, den Kopf gebückt, in unbewegliches Nachdenken versunken. Am Tisch ihm gegenüber saß der rote Teilheimer, ein Bein übers andre geschlagen, einen Zigarrenstummel mit vergnüglicher Miene über die Lippen wälzend und einen Bleistift auf ein mit Zahlen beschriebenes Blatt bohrend, als ob er den Speer in die Brust eines Besiegten tauche. Sein Auge blitzte feldherrnhaft, als er dem Knaben mit einer Handbewegung das Zimmer verwies. Am darauffolgenden Nachmittag war es wieder so, nur daß noch Iduna Hopf dabei war; Herr Ratgeber stand wieder vor dem Ofen und schien qualvoll unentschieden, der rote Teilheimer spießte wieder den Bleistift kühn in die Zahlenleiber. Iduna Hopf machte dem Knaben ein Zeichen, er aber wollte es nicht verstehen und blieb in ahnungsvollem Trotz. Da sagte Iduna Hopf, gegen Herrn Ratgeber gewendet: »Da sieh mal, Joseph, wie vernachlässigt der Junge herumgeht.« Herr Ratgeber blickte zerstreut und unruhig in des Knaben Gesicht.
Eine Woche später kam Herr Ratgeber zu früherer Stunde als sonst nach Haus, schritt erregt im Zimmer auf und ab, befahl der Magd, sogleich sein Essen zu bereiten, er fahre über den Abend nach Nürnberg. Dann kleidete er sich sonntäglich an, kam wieder zu den Kindern heraus, pfiff leise vor sich hin, öffnete, als sei ihm zu heiß, das Fenster und beugte sich eine Weile hinaus. Inzwischen war der Braten aufgetragen worden, er setzte sich zu Tisch, und da ihn die Kinder andächtig umstanden und jedem Bissen nachschauten, der in seinem Munde verschwand, schnitt er drei gleich große Stücke Brotes ab, legte auf jedes eine Scheibe Fleisch und teilte aus. Während sie alle drei schmausten, gab er sich einen Ruck und sagte: »Ihr werdet jetzt eine neue Mutter bekommen, damit wieder Ordnung unter euch ist. Seid anständig und macht mir Ehre.« Er vermied es bei diesen Worten, seine Augen vom Teller zu erheben, doch bevor er aufstand, richtete er den Blick mit plötzlicher Strenge auf Engelhart, der den Vater atemlos anstarrte.
Am folgenden Tag, noch vor Tisch, traten zwei fremde Frauen ins Zimmer. Die eine von ihnen sagte: »Guten Tag, Kinder, gebt mir die Hand, ich bin eure neue Mutter.« Sie hatte ein süßliches Wesen. »Sehr schöne Kinder,« sagte die andre Frau, die eine helle kalte Stimme hatte. Darauf begaben sich beide an die Besichtigung der Wohnung und unterwarfen jedes Möbelstück und jedes Porzellanfigürchen einer eingehenden Beurteilung.
Engelhart verhielt sich stille, an manchen Tagen aber kam es über ihn und trieb ihn umher wie einen Ball, der von unsichtbaren Händen von einem Eck ins andre geworfen wird. Da fand er die Kleider zu eng, das Haus zu klein, den Himmel zu niedrig, und er lief ohne Sinn und Ziel durch die Gassen, bis er in einem Winkel Halt machte und in die Luft starrte. Er hatte in einem Buch die Geschichte gelesen von dem der auszog, das Gruseln zu lernen, und diese Geschichte machte Eindruck auf ihn durch etwas, das hinter den erzählten Vorgängen steckte, wie in einem Nebel des Grauens hin und her wogend. Er spürte die Kluft, die ihn von jenem trennte, der das Gruseln nicht lernen konnte, denn im Anfang seines Denkens war die Furcht, Furcht vor dem Ungewissen, Unsichtbaren, Unnennbaren, Furcht mitten in der Freude und im Spiel. Zagend stand er einem dämonenhaften Wesen gegenüber, dessen Wille es ist, zu zerstören und irrezuführen, den freifliegenden Wunsch aufzufangen und an die Erde zu fesseln.
Im sogenannten Feldschlößchen, eine halbe Stunde von Nürnberg entfernt, feierte Herr Ratgeber seine zweite Hochzeit. Die Kinder saßen an diesem Tag in dumpfer Spannung zu Hause. Gegen Abend brachte jemand von der Hochzeitsgesellschaft eine Torte und Grüße vom Vater, der mit seiner neuen Frau schon abgereist war. Die Botschaft wurde kaum gehört, alle machten sie sich über die Torte her, auch die Magd erhielt ein Stück, und um sich erkenntlich zu zeigen, verschwand sie dann und überließ die Kinder für den ganzen Abend sich selber. Sie befanden sich im großen Wohnzimmer, und Engelhart beschäftigte sich, die Aufsichtslosigkeit nutzend, mit der großen Wanduhr. Er liebte diese Uhr und die lautlosen Schwingungen des gelbfunkelnden Perpendikels; er suchte eine Seele in ihr. Zu diesem Zweck stellte er einen Schemel auf einen Stuhl, kletterte hinauf, öffnete den Glasdeckel und lauschte dem heimlichen Rädergesurr; bisweilen gab es ein Geräusch, das einem Seufzer glich. Nach einer Weile begann er an dem Zifferblatt zu hantieren, es gelang ihm, eine Schraube zu lockern, und auf einmal hatte er beide Zeiger in der Hand. Er erschrak, ihm war zumute, als seien einem lebenden Wesen die Arme abgefallen; umsonst probierte er, das Übel wieder gut zu machen, plötzlich stieg er herunter und legte die Zeiger kleinlaut auf die Kommode. Es war ein ziemlich stürmischer Abend, das Feuer im Ofen war erloschen, die Kinder froren. Zudem ging auch das Öl in der Lampe auf die Neige. Auf der Straße und im Haus war es totenstill, Abel war am Tische sitzend über seiner Schiefertafel eingeschlummert, Gerda schlich eine Weile in dem düster werdenden Zimmer hin und her, dann drückte sie sich in die Ofenecke und fing an, leise vor sich hinzuweinen. Engelhart verbarg seine Gefühle, so gut es möglich war, er stellte sich gegen die Tür und horchte und wagte endlich zu öffnen. Draußen war’s finster. Er überredete sich zur Tapferkeit und schritt hinaus, um nach der Magd zu rufen. Doch war die Finsternis so groß, daß ihm das Geräusch des eignen Herzens Angst einflößte. Nie hatte er etwas so Teuflisches in der Nacht geahnt, er machte eine betende Bewegung mit den Armen, sein Auge fand aber keinen Aufblick. Dies machte die Finsternis doppelt schwer und öde, und da Gerda ängstlich seinen Namen rief, kehrte er zurück. Er schaute zur Uhr, um zu sehen, wie spät es sei, und das Grauen überlief seine Haut, als er ihr zeigerloses Blatt gewahrte und darunter den Perpendikel, ernsthaft schwingend, wie wenn nichts geschehen wäre. Es schien, als ob die Zeit ihr Maß verloren habe und die Nacht kein Ende nehmen würde.
Acht Tage später spielten die Kinder im Flur neben der Stiege, Engelhart hatte aus Stühlen eine Kutsche gebaut, Abel war Postillon, Gerda, in einem unermeßlich langen, weit über die Dielen schweifenden Mantel der Mutter und einen großen Federhut auf dem Kopf, machte die vornehme Passagierin, und Engelhart war der Räuber, der die Kutsche im Wald zu überfallen hatte. Mitten im größten Getöse tauchten Herr Ratgeber und die fremde Frau, die neue Mutter, auf und blieben auf der halben Höhe der Treppe stehen. Herr Ratgeber, das Reiseköfferchen tragend, winkte den Kindern lachend zu, innezuhalten, die Frau schüttelte verdrossen lächelnd den Kopf, und ihre Blicke blieben auf Gerda haften, die vergeblich bemüht war, sich aus dem Reisemantel zu befreien.
Von Stund an ging alles einen andern Gang im Hause. Früh, mit dem Glockenschlag sieben hieß es aufstehen; es war keine Minute der Besinnung erlaubt, kein Sichdehnen, kein Zurückdenken an die Träume, ein Rütteln an der Schulter und: heraus. Besonders für den kleinen krummbeinigen Abel war es hart, oft, wenn er schon gewaschen und angekleidet war, fielen ihm am Frühstückstisch die Augen wieder zu. Es gab keine Pfennige mehr zum Vesperbrot, und damit war eine der schönsten Vergnügungen zerstört: den Schulhof verlassen, über die Straße zum Bäcker laufen und so mit einigen andern, welche die gleiche Schicksalsgunst genossen, eine scheinhafte kurze Freiheit erobern. Nach der Schule mußte man in gemessener Zeit zu Hause sein, Frau Ratgeber haßte das Streunen. Am Abend, kaum war das Brot gegessen, hieß es wieder: ins Bett, ins Bett; kein Einwand galt, alles war Befehl und Regel geworden. Die neue Frau Ratgeber meinte es nicht schlecht mit den Kindern, sie glaubte das Rechte zu wollen und zu tun, auch wenn sie das Brot, bis auf den Millimeter berechnet, vorschnitt, Fleisch nur in den winzigsten Portionen verteilte, den Zucker zum Kaffee abschaffte, so daß das wasserdünne graubraune Getränk kaum hinunterzubringen war. Engelhart wußte natürlich nichts von dem Zwang, zu sparen, unter dem sie stand, und daß sie nur durch die scharfsinnigste Strategie in den Ausgaben mit dem zugewiesenen Wochengeld den Haushalt bestreiten konnte. Er spürte nur die haßartige Lieblosigkeit, die ihm vorenthielt, was er bis jetzt genossen hatte; er bäumte sich auf unter tyrannischen Verboten, er wurde hinterlistig, wenn er sich hinterlistig angeklagt sah, feig oder rasend den aufgebauschten Beschuldigungen gegenüber, die stets vor das Tribunal des Vaters gebracht wurden, und er blieb bei großen Versehungen reuelos, weil auch die kleinsten ungroßmütig verdammt wurden. Bald griff er zur Lüge aus Furcht, aus Diplomatie, zur gedankenlosen Lüge, ja zur Lüge, die er nur erfand, um sich in einer dumpfen Weise an der Frau zu rächen. Nicht selten gebrauchte er langwierige Ausreden, um sich eines erbärmlichen Vorteils zu versichern, und war einmal ein auskömmlicher Tag mit der Stiefmutter, so tat er freundlicher gegen sie, als ihm zumute war, schmeichelte ihrem Bedürfnis nach Klatsch durch allerhand Geschichten und suchte sie möglichst lang bei guter Laune zu erhalten. Zweimal in der Woche ging sie des Abends zum Fleischer, da begleitete er sie, schleppte den schweren Korb nach Hause, saß am Tisch bei ihr, wenn sie Linsen klaubte oder Äpfel schälte, und wenn er im Plaudern war und sie bisweilen zum Lachen brachte, dann übersah sie es, daß er die Butzen der Äpfel aß oder das in den Streifschalen verbliebene Fruchtfleisch mit den Zähnen herausschabte; dann durfte er auch noch eine halbe Stunde in seinem geliebten Don Quichotte lesen oder aus Zwirn, Gläsern und allerlei Schachteln sonderbare Paläste bauen. Wies sie ihn aber zu Bett, so durfte kein Widerspruch fallen. Das freie, arglose Wort fand kein Echo in ihr, die rückhaltlose Heiterkeit erweckte ihr Verdruß und Mißtrauen, der offene Blick erschien ihr frech. In ihr selbst war nichts als tartüffisches Ducken gegen gesellschaftlich Höherstehende, auch wenn sie nachgewiesenermaßen nur hundert Mark mehr Einkommen besaßen. In den engsten und dunkelsten Verhältnissen eines fränkischen Judendorfs aufgewachsen, war sie von einer dämonischen Liebe zum Geld besessen. Im Geld suchte sie die Quellen des Lebens. Sie war aufs genaueste mit den Verhältnissen aller Familien der Stadt bekannt und richtete auf der Straße ihren Gruß nach eines jeden Besitz. Wenn ein reicher Mann starb, war sie immer ein wenig erstaunt darüber, daß Gott seine Hand auch nach einem solchen Inbegriff irdischer Macht ausstreckte. Ihr ganzes Tun und Lassen war von rätselhaftem Neid durchflutet. Ihre Züge waren zerrissen von Unruhe, Unmut, Ungenügsamkeit und Ehrgeiz, ihr Blick war stechend, ihr Mund bitter und ärgerlich zusammengepreßt. Sie war eine Natur, alles Wohlwollens bar, ohne sanftes Verweilen im Augenblick, ohne frauenhaftes Träumen. Wenn andre Tausende auf Tausende häuften, wollte sie wenigstens Pfennig um Pfennig sammeln, und weil sie darin kein Ende sah und alle Geister des Behagens auf immer von der Schwelle verscheucht wurden, an der sie begehrlich lechzend stand, so entsprang Fried- und Lichtlosigkeit aus allem, woran sie die Hände rührte. Ihr war es nicht gegeben, Zutrauen zu erwecken, die früheren Freunde der Familie blieben fern. Kein gemütliches Bild, keine anziehende Vorstellung belebte die Räume, wenn Engelhart, fern vom Hause, sie sich gegenwärtig hielt. Einsam sparte und haderte die Frau und füllte ihre Tage mit erschöpfender Arbeit.
Einmal kam Engelhart hungrig aus der Schule, und als er durch die Küche ging, wo sich gerade niemand aufhielt, sah er einen Korb voll kleiner Äpfel auf dem Anricht stehen. Unbedenklich nahm er zwei Äpfel, verzehrte sie im Zimmer, entledigte sich des Schulgeräts und schickte sich an, möglichst schnell zu entkommen, denn es war der erste schöne Tag nach regnerischen Wochen. Plötzlich stand die Stiefmutter vor ihm und fragte atemlos: »Wer hat von den Äpfeln gestohlen?«
Der Knabe starrte sie an; er war im Begriff, es ruhig zu bekennen, doch das Wort »gestohlen« machte ihn stutzig. »Ich habe nichts gestohlen,« antwortete er. Das Zittern seiner Stimme und besonders das Erröten strafte ihn Lügen.
»Leugne nicht,« sagte die Frau, »ich habe die Äpfel gezählt; du wirst ja feuerrot, du schlechter Mensch.« Damit schlug sie ihn vor den Kopf, daß er zurücktaumelte; noch einmal erhob sie den Arm, Engelhart fing ihn auf und hielt ihn krampfhaft fest, darauf wurde sie von Wut und Bosheit übermannt und schlug aus aller Kraft mit beiden Fäusten los. Der Knabe schrie; je mehr er schrie, je wilder wurde die Frau; die Leute vom Haus liefen zusammen, die Magd rannte von der Waschküche herauf. Endlich gelang es Engelhart zu entkommen, er taumelte in den Flur, tastete sich am Gitter entlang und verkroch sich im finsteren Ende des Korridors zwischen zwei Schränken. Er blieb unbeweglich dort, um zu warten, bis der Vater kam. Endlich vernahm er seine kurzen hastigen Schritte und atmete auf. Es verfloß geraume Zeit, bevor Herr Ratgeber das Zimmer wieder verließ. Schon bedrückte den Knaben die Einsamkeit und Halbdunkelheit, er glaubte es aber so lang ertragen zu müssen, bis er mit Güte ins Licht zurückgeführt würde. Da rief die Stimme des Vaters seinen Namen, doch mit so hartem Klang, daß er erschrak und sich nicht rührte. Noch einmal tönte der Ruf, lauter, gereizter, ungeduldiger.
»Dort hinten steckt er,« sagte Abel, der herangeschlichen war und den Bruder verlegen zwinkernd betrachtete.
Herr Ratgeber packte Engelhart am Arm und zerrte ihn hinein. »Zum Lügner bist du geworden, zum Dieb? Du willst mir Kummer machen, ich weiß es schon lang, fort aus meinen Augen, ich kann dich nicht mehr sehen!« Damit wandte sich Herr Ratgeber ab, ging in das nächste Zimmer und schlug die Tür zu. Die Sprache, die er geführt, raubte Engelhart beinahe das Gefühl des Lebens. Besonders der Umstand, daß er gar nicht gefragt worden, daß kein Fünkchen Recht auf seiner Seite gelten sollte, daß der Vater den Worten seiner Frau ohne weiteres Glauben schenkte, das umkrampfte seine Brust, und er hatte eine solche Verzweiflung bisher noch nicht kennen gelernt.
Nicht mehr ganz derselbe wie vorher verließ er das Haus und ging über den Bahndamm bis auf den Dambacher Weg. Der schöne Tag, die vollkommene Ruhe der Felder und Wiesen, der lautlos dahinfließende Rednitzfluß mit seinen Wasserrädern, die alte Schwedenfeste in der Ferne und der Wald rings um sie wie ein blauer Kranz: dies alles zog ihn empor aus dem Abgrund seines Schmerzes. Er setzte sich unter einen Weidenbaum dicht am Ufer und verfolgte das Treiben der Krähen, die sich in seiner Nachbarschaft furchtlos niederließen. Das Flußbett war vom langen Regen hoch angeschwollen, das Wasser trug auf seinem Rücken Hunderte von Baumzweigen dahin. Hätte ihn nicht der Hunger gequält, so wäre Engelhart bis in die Nacht hier geblieben; er umfaßte Land, Wald, Wasser und Himmel mit einer neuen, ernsten Empfindung, er fühlte mit dunkler Genugtuung, was ihm beschieden sein könnte, wenn er in sich wirken lassen würde, was so groß, so feierlich sich als Welt, als Natur vor ihm hinbreitete. Als er heimwärts wanderte, sank die Sonne hinter den Waldrändern, der Himmel sah aus, wie wenn aus verborgenen Quellen rotglühendes Eisen über ihn hingeströmt wäre. Darüber streckten sich, aus einem Mittelpunkt hervorlaufend, grüne Strahlenbüschel, einzelne Wolken hingen gleich ruhig brennenden Schiffen im Zenit und die Ebene zitterte im rötlichen Dunst.
Fremd und fremder fand sich Engelhart dem Vater gegenüber, und auch dieser vergaß seinen Groll diesmal lange nicht, vielleicht um die Ahnung von eigner Schuld zu ersticken. An einem Sonntagabend holte Herr Ratgeber die Gitarre von der Wand. In früheren Zeiten hatte er oft und gern darauf gespielt und Lieder gesungen, die er noch aus seiner Knabenzeit kannte. Er pflegte damals unbestimmt, doch glücklich vor sich hin zu lächeln, und seine Augen füllten sich mit einem Ausdruck schamhafter Schwärmerei. Heute schlug er wie suchend ein paar Akkorde an; Engelhart bat, er möge doch singen, aber Herr Ratgeber zog die Stirn in Falten, legte das Instrument beiseite, machte eine abwehrende Bewegung mit der Hand und sagte rauh: »Du kannst schlafen gehen.« Die Gitarre wanderte bald darauf in die Rumpelkammer. Herr Ratgeber zeigte nie mehr Verlangen nach ihr.
Die Fabrik war im Gang, sechsundzwanzig Arbeiter waren an den Hobelbänken, an der Kreissäge, am Gasmotor tätig. Herr Ratgeber war tagelang beschäftigt, die fertiggestellten Holzschachteln mit Bildern zu bekleben und diese dann zu lackieren. Er hatte aus Sparsamkeitsrücksichten nur einen einzigen Kommis aufgenommen, einen gewissen Lechner, der an Epilepsie litt. Oft schien es, als lausche Herr Ratgeber mit Befriedigung auf das furchtbar jauchzende Kreischen der Säge, das von den Fabrikräumen hereindrang, lauter und wilder, wenn eine Tür geöffnet wurde; meist aber war er traurig und verstimmt. An den Zahltagen kamen die Arbeiter zur Kasse, es gab nicht selten Streit, die Leute nahmen eine drohende Haltung an. Wenn Herr Ratgeber dann wieder allein war, rechnete er stundenlang, stellte den Umsatz fest, überschlug die Herstellungskosten eines neuen Artikels und beriet mit dem Werkführer über Löhne und Holzsorten. Spät am Abend schrieb er Briefe und Fakturen, zeichnete Muster und Pläne oder lackierte abermals die einfältigen Bilder auf den Schachteln. Oft kam Engelhart und erinnerte den Vater an das Nachtessen, dann löschte Herr Ratgeber mit einem letzten Blick und Seufzen die Lichter, versperrte Laden, Geldschrank und Türen und ging schweigend mit dem Knaben nach Hause. Unbewußt schnitt es Engelhart ins Herz, wenn der Vater einmal wieder vergnügt war, etwa wenn Fremde da waren – wenn er mit seinen funkelnden Augen an harmlosen Gesprächen teilnahm, wenn er sich selbst wieder spürte und die Zeitläufte vergaß. Es wohnten ungelenkte Kräfte in seiner Brust, aber Kräfte waren es; mit beiden Fäusten hielt er sich grimmig an der Lebensleiter fest und konnte nicht empor, vielleicht weil ein brutaler Vorgänger die Sprossen zerbrochen hatte.
Die Kinder sahen nur noch die richterliche Gewalt in ihm, er schien nicht mehr Teilnahme für sie zu hegen als der Drahtziehende im Puppentheater an den gehorchenmüssenden Marionetten. Bei Tisch durfte nicht gesprochen werden, anständige Kinder sprechen nicht bei Tisch, hieß es. Ein Verbot wurde ausgesprochen, die Kinder wollten den Grund wissen, dies setzte oft in Verlegenheit, und jede Erörterung wurde mit dem Satz abgeschnitten: Genug, ein Kind fragt nicht warum. Der Vater verlor das Licht in Engelharts Augen, es kam vor, daß er beim Schall seiner Schritte zitterte. Er lernte in den Blicken und zwischen den Lippen der Menschen lesen, erfüllt von Mißtrauen und allgemeiner Angst. Gerade in dieser Zeit fand er einen Kameraden. Sein Name war Philipp Raimund, es war ein aufgeweckter Knabe von graziösem Wesen; er hatte etwas Beschwingtes, Beherztes, das in seinem Gang und in seiner Art, den Kopf zu tragen, zur Geltung kam, seine Stimmung war durchsichtig wie Glas, alles an ihm war hell, seine Äußerungen hatten eine famose angeborene Kräftigkeit. An einem Mittwochnachmittag marschierten sie zusammen in den Burgfarnbacher Wald, bis sie an eine tiefeinsame Stelle kamen. Dort rasteten sie. Raimund teilte sein Butterbrot mit Engelhart, sie sprachen über die Schule, dann über ihre Eltern, und Raimund fragte beiläufig, ob es Engelhart nicht gut zu Hause habe.
»Wir haben jetzt eine Stiefmutter,« entgegnete dieser in einem Ton, als ob es sich um eine kleine vorübergehende Unannehmlichkeit handle.
»Autsch!« rief Raimund teilnehmend und patschte sich auf die Schenkel. Von da an wurde sein Benehmen noch zarter und freundlicher; er berührte diesen Umstand niemals wieder. Immer mehr nahm die Philosophie von ihren Unterhaltungen Besitz, und sie stritten mit Eifer über die Existenz Gottes. Engelhart leugnete Gott; das bekümmerte Raimund, und er hatte viele Gründe dagegen. »Können denn die Blumen und die Bäume von selbst entstehen?« fragte er eindringlich, »und die Sonne, sie ist doch da, folglich muß sie geschaffen worden sein.«
»Sie ist ewig,« antwortete Engelhart.
»Ewig? Was heißt das?« warf Raimund nachdenklich entgegen. »Ewig ist nichts, das ist doch nur ein Wort.«
Dieser Einwand machte Engelhart stutzig, er hätte nichts zu sagen gewußt, wenn Raimund nicht hinzugefügt hätte: »Und der Mensch, so schön und lebendig, glaubst du, durch Zauberei ist er gekommen?«
»Die Menschen entstehen aus sich selbst,« sagte Engelhart.
»Wie, aus sich selbst?« fragte der andre erstaunt.
»Ich weiß es,« behauptete Engelhart finster, dennoch sank in diesem Augenblick seine Wissenschaft in Nichts zusammen, und aus Groll darüber ward er störrisch. »Wie ist denn Gott?« warf er dem Freunde grimmig ein. »Was ist denn Gott? wie denkst du ihn? wie sieht er aus?«
Raimund lächelte sonderbar liebenswürdig und sagte ruhig: »Er ist ein Wesen.« Dazu machte er eine getragene Handbewegung und sein Gesicht hatte den Ausdruck der Verehrung.
Dies geistige Einander- und Sichselbstsuchen im kindischen Wortgefecht, dies warme Emporsehnen und Hinausfühlen war genug des Glücks, was konnte ein Ja oder Nein daran vermehren oder davon rauben? Ihre Worte glichen leerem Fliegengesurr in sommerlicher Luft, was Engelhart dachte, teilte er dem Freunde mit, aber was sie empfanden, verbargen sie einander sorgsam, so wurde ihr Beisammensein reich an unterirdischen Quellen. Raimund zuerst fand Engelharts Herz voll von Freundschaft, er bereitete es zu für die Freundschaft, er machte ihm das Gespräch mit einem vertrauten Genossen unentbehrlich.
Eines Tages durfte Gerda an einem Spaziergang der Freunde teilnehmen, und das kam so: Engelhart hatte Raimund abgeholt, und sie gingen an dem Haus vorbei, wo Ratgebers wohnten. Da sahen sie Gerda auf der Steintreppe des Spenglerladens sitzen und weinen. Die Knaben fragten sie aus, und sie erzählte, sie habe ein Glas zerbrochen und sei geschlagen worden. Der mitleidige Raimund lud sie ein, mitzukommen, und sie besann sich nicht lang. Sie wanderten in den Vestnerwald, Gerdas blasses Gesicht färbte sich in der belebenden Luft, und ihre Augen, deren Ausdruck stets zwischen Pfiffigkeit und Träumerei wechselte, blickten freier. Sie gab nur Angst vor neuer Züchtigung zu erkennen, weil sie so weit vom Hause war, aber Raimund lachte und meinte, das wolle er schon richten. In der Tat hatte Frau Ratgeber eine Schwäche für den Knaben, weil er angesehener Leute Kind war und ihr sein Verkehr mit Engelhart schmeichelhaft vorkam; er war der Sohn eines Landgerichtsrats.
Die drei zogen tiefer in den Wald und beachteten kaum, daß die Dämmerung einbrach. Bisweilen blieb Raimund stehen und hielt mit scharfen Augen Umschau. Ein Uhu schrie in der Ferne, es wurde schnell dunkel, gerade daß sie noch den Waldrand und die Landstraße erreichten, ohne in die Irre gegangen zu sein. Gerda war plötzlich todmüde, sie war nicht gewohnt zu marschieren, sie sank nieder in das feuchte Gras und schüttelte auf Raimunds scherzhaften Vorschlag, daß er und Engelhart sie tragen könnten, matt lächelnd den Kopf. Gleich darauf war sie eingeschlafen.
»Lassen wir sie ein wenig schlafen,« murmelte Engelhart, »jetzt ist alles eins, Prügel gibt’s sowieso.« Vor ihnen im Osten stieg der Vollmond auf; zur Mulde vertieft, lagen die Äcker, und auf dem Kamm des langgestreckten Hügels standen drei Pappelbäume, scharf in den Himmel gezeichnet. Raimund machte sich lustig über Engelharts Schweigsamkeit, auch später, als sie schon auf dem Heimweg waren, das verschlafene Mädchen in ihrer Mitte führend. Aber er konnte nicht anders, es war ihm bang ums Herz, und er vermochte nicht Rechenschaft zu geben warum, er fand kein Wort, keinen Gedanken dafür. Es war, als verursache die Schönheit der Nacht ihm Schmerz, er spürte eine Kraft in sich, die er nicht anzuwenden wußte, es beunruhigte ihn eine Fülle, welche die Brust zu sprengen drohte.
Raimund begleitete die Geschwister bis nach Hause und machte einen so geschickten Fürsprecher, daß man Gnade walten ließ. Das war der letzte schöne Tag mit Raimund, bald darauf verließen seine Eltern die Stadt, sein Vater war nach Bamberg versetzt worden.