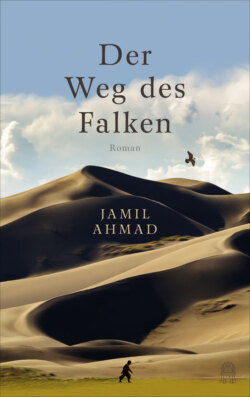Читать книгу Der Weg des Falken - Jamil Ahmad - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Eine Frage der Ehre
ОглавлениеDas Wasserloch lag auf dem Gebiet der Mengals – eines Brahui-Stammes in Belutschistan.
Eine Gruppe von sieben Männern und vier Kamelen war zu dieser Oase aufgebrochen, als die Sterne noch am Himmel leuchteten. Von ihrem letzten Rastplatz, eingebettet zwischen den kargen Sandsteingraten, waren sie bei Tagesanbruch hinaus auf die Ebene getreten. Seitdem waren die Belutschen auf ihren Kamelen Meile um Meile durch das flache, trostlose Gelände geritten, dessen Eintönigkeit nur von gelegentlichen Dünen unterbrochen wurde. Geduldig hatten sie Strecken von öligem ockerfarbenem Treibsand umgangen und hatten ihre Tiere kühn durch kratzende Dickichte von Kameldorn und glühende Salzpfannen getrieben.
Der Sandsturm war über sie hereingebrochen, als die Kamele gerade begannen, Wasser zu wittern. Stundenlang lagen sie im Lee einer sichelförmigen Düne. Sie vermummten sich und drückten sich gegen ihre Tiere, während die Winde sie umkreischten und die Welt sich verfinsterte.
Der Sturm endete so plötzlich, wie er angefangen hatte. Die Männer enthüllten ihre Gesichter und sogen dankbar die frische, reine Luft ein, die dem Sturm folgte, und nahmen ihren mühsamen Marsch wieder auf.
Diesmal gingen die Männer zu Fuß. Bis zum Wasserloch war es nicht mehr weit, und die Tiere waren müde. Ging ein Kamel verloren, würde ein Mann – wenn nicht sogar zwei – ausfallen. Unter solchen Umständen war ein Kamel nicht nur kostbar, es bedeutete buchstäblich das Leben.
Trotz ihres quälenden Durstes beeilten sich die Männer nicht. Je näher sie ihrem Ziel kamen, desto geduldiger wurden sie. Alle paar Schritte suchten sie den Horizont ab. Der Sturm, der gerade vorübergezogen war, hatte ihre Spuren mit Sicherheit restlos verweht, dennoch versuchten sie beim Gehen den Boden nach etwaigen Hinweisen auf Gefahr zu lesen. Es waren genau diese Situationen – wenn man müde ist, wenn der Rastplatz nahe ist –, da man sich vor dem Tod am meisten vorsehen musste.
Seit Monaten als Rebellen gejagt, hatten sie ihre Lektion teuer bezahlt. Brauchte ein Belutsche auf der Flucht schon wenig Wasser und Nahrung, so hatten sie gelernt, mit noch weniger auszukommen. Nachdem sie einmal von den blitzenden Spiegelchen an ihren bestickten Kappen verraten worden waren, hatten sie jeden Zierrat und Schmuck von ihren Kopfbedeckungen entfernt. Das traditionelle Schwarz, Rot und Weiß ihrer Kleidung war mittlerweile durch Schweiß und Schmutz zu neutralen Tönen übergegangen. Darüber hinaus hatten sie gelernt, ohne Frauen zu leben.
Doch das Land – ihr Land – hatte dafür gesorgt, dass ihr Leben nicht gänzlich jeder Schönheit und Farbe beraubt wurde. Es bot ihnen tausend Schattierungen von Grau und Braun, mit denen es seine Hügel, seinen Sand und sein Erdreich tönte. Behutsame Farbveränderungen fanden sich in der Schwärze der Nächte und der Helligkeit der Tage und in den kräftigen Farben der winzigen Wüstenblumen, die sich in den staubigen Sträuchern versteckten, sowie den gleitenden Schlangen und huschenden Echsen, wenn sie sich im Sand eingruben. Auch wenn jede Farbe gnadenlos aus ihrer Kleidung verbannt worden war, für die Männer erblühten Schönheit und Farbe allerorten.
Sie waren noch ein Stück entfernt, als sie die zwei Steintürme entdeckten. Ein paar Monate zuvor, als sie das Wasserloch zuletzt besucht hatten, waren sie noch nicht da gewesen. Der Anblick bereitete ihnen ein unbehagliches Gefühl.
Sie näherten sich vorsichtig, zwei von ihnen als Späher dem Rest der Gruppe ein gutes Stück voraus. Als sie näher kamen, sahen sie das tote Kamel mit dem schlaff auf dem Boden ausgestreckten langen Hals. Beim Anblick dieses staubfarbenen Haufens toten Fleisches zog sich die Gruppe eilig zurück und begann, einen weiten Kreis um das Wasserloch zu reiten, das gerade eben noch in Sichtweite blieb. Sie beobachteten und lauschten nach wie vor aufmerksam, und zuletzt, nachdem sie sich vergewissert hatten, dass sich Kilometer ringsum nichts Lebendiges regte und kein fremdartiges Geräusch das Land störte, beschlossen sie, auf die Quelle zuzuhalten.
Mit Ausnahme ihres Anführers Roza Khan waren alle Männer bewaffnet. Sie trugen Vorderlader mit sichelförmigen Kolben. Zwei von ihnen hatten zusätzlich Krummschwerter, die ohne Scheide in ihren Gürteln aus gezwirnter Wolle steckten.
Roza Khan war ein alter Mann. Die breitknochige und hohe Gestalt war alles, was von der Kraft und der Stärke seiner Jugend verblieben war; dies und seine Erinnerungen.
Der graue Star hatte ihn auf beiden Augen praktisch blind gemacht. Selbst bei hellstem Licht sah er nur unbestimmte, verschwommene Schatten. Hätten die Ereignisse ihn nicht gezwungen, seine Pflichten dem Stamm gegenüber wahrzunehmen, wäre er gern zur Augenklinik gegangen, die jeden Winter in einer Stadt fünfhundert Kilometer weiter südlich zur Versorgung der Wüstenbewohner eingerichtet wurde, und hätte sich behandeln lassen. Er wünschte sich, wieder Formen, Farben, Gesichter zu sehen, bevor er starb. Wenn sich die Dinge regelten, würde er sich nächsten Winter die Augen operieren lassen. Bis dahin würde er sich behelfen müssen, so gut es eben ging.
Er war kein Kämpfer und behinderte den Rest der Gruppe mit Sicherheit in ihrer Bewegungsfreiheit. Vielleicht würden seinetwegen Männer sterben müssen. Vielleicht würden sie seine Fehlentscheidungen mit ihrem Leben bezahlen müssen.
Dennoch war ihm durchaus klar, dass sie ihn brauchten. Sie brauchten ein Symbol, und wie alt oder in welchem Zustand es war, kümmerte sie nicht. Er würde bei ihnen bleiben, obwohl er ihnen keine besonderen Weisheiten zu bieten hatte, weder was die Wege der Wüste noch was die Listen der Menschen anbelangte. Er wusste, dass seine Männer aus Ehrgefühl und Höflichkeit alle Heldentaten ihm und alle Misserfolge sich selbst zuschreiben würden. Ebenso würden sie vor keinem Mann zugeben, dass er – ihr Häuptling – in Wirklichkeit ein bemitleidenswerter Mensch war; dass der Mann, der sie anführte, es ohne geflüsterte Hinweise von seinen Gefährten nicht einmal vermochte, sein Kamel zu lenken.
Drei Kamele waren schlanke Reittiere mit anmutigem Hals und schlanken Beinen. Das vierte war ein Lasttier. Hässlich, stämmig und großfüßig, bekundete es seine momentane Übellaunigkeit durch grollende Knurrlaute, die seinem Magen entstiegen.
So wie die Männer waren auch die Kamele auf die Reise vorbereitet worden. Aller Schmuck und Zierrat war entfernt, jedes unnötige Metallteil, das hätte blinken oder klimpern können, zurückgelassen worden, ihre Satteltaschen enthielten nur das Nötigste.
Da es rund um das Wasserloch keinerlei Deckung gab, konnten sie sich ihm nähern, ohne einen Überfall befürchten zu müssen.
Sie hielten in einiger Entfernung und luden die Wasserschläuche ab. Dann wurde ein Tier ans Wasser geführt und durfte ein paar Schlucke saufen, bevor man es wieder wegzog. Es ging das Gerücht um, alle Wasserlöcher seien vergiftet worden, damit die Rebellen sich nicht daraus versorgen könnten. Erst wenn die Tiere keine Beschwerden zeigten, schlugen die Reisenden das Lager auf.
Es war eine althergebrachte Routine. Die Kamele mussten abgesattelt, getränkt und gehobbelt werden. Die jämmerlich mageren Proviantbeutel wurden geöffnet und schmale Rationen entnommen. Ein Mann erhielt den Auftrag, Strauchwerk zu sammeln, ein anderer, mit Hilfe von Zunder Feuer zu machen. Essen musste gekocht und eilig verzehrt werden, ehe die Sonne unterging.
Während all dessen ging einer der Männer zum gegenüberliegenden Rand des Wasserlochs, um das tote Kamel näher in Augenschein zu nehmen. Dort entdeckte er den kleinen Jungen, der, an den Bauch des Kamels gepresst, schlief.
Von der Hand des Mannes an der Schulter berührt, wachte der Junge sofort auf. Als er die Augen öffnete und einen Fremden sah, der ihn musterte, kniff er sie sofort wieder zu und schrie auf. Die anderen Männer kamen angerannt. Der Junge schrie, sich sträubend und windend, weiter, als sie ihn hochhoben und zum alten Häuptling trugen, der am Feuer saß.
Nachdem der Junge vor ihm abgesetzt worden war, wandte der Alte die blinden blicklosen Augen in seine Richtung. »Hör auf zu weinen, mein Sohn«, sagte er. »Es ist nicht gut, einen Belutschen – und wenn’s auch nur ein Kind ist – weinen zu hören.«
Der Junge verstummte augenblicklich, und Roza Khan fügte in so gütigem wie strengem Ton hinzu: »Und es gibt noch einen weiteren guten Grund, warum du nicht weinen darfst. Gejammer bei einem Mann ist wie Honig in einem Topf. So, wie Honig Fliegen anzieht, zieht Gejammer Schwierigkeiten an. Jetzt sag mir, wie kommst du hierher?«
Der Junge blieb stumm. Endlich ergriff einer der Männer das Wort. »Er will es nicht sagen, aber die Sache ist völlig klar. Die zwei Türme und das tote Kamel sagen alles. Wir brauchen ihn gar nicht zu fragen.« Der Alte dachte eine Weile nach. »Wir können ihn nicht hierlassen«, sagte er endlich. »Wir werden ihn mitnehmen. Wenn irgendwelche Lebensmittel auf seinem Kamel sind, legt sie zu den unseren.« Während die Männer sich entfernten, murmelte der Häuptling in sich hinein: »Das hat mit Sicherheit etwas zu bedeuten, doch wer kann schon sagen, ob Gutes oder Schlechtes?«
Nachdem sie die Mahlzeit beendet hatten, blieben sie um die schwelende Glut und die von der Hitze des Feuers erwärmten Steine sitzen. Die Sterne waren zu Millionen über den klaren Wüstenhimmel ausgebreitet. Ab und an zog ein Meteor vorüber, glühte hell auf und verschwand nach einem Augenblick wieder.
Während sie darauf warteten, dass Roza Khan das Schweigen brach, das sich über sie gelegt hatte, begannen die Männer, jeder für sich und ohne auf die anderen zu achten, vor sich auf dem Boden kleine seltsame Konstruktionen zu errichten. Auf der Unterlage eines flachen Steins wurden kleine rundliche Kiesel, scharfe Felssplitter, Strohhalme und Ästchen geduldig und mit äußerster Konzentration aufeinandergelegt und ins Gleichgewicht gebracht. Fingerbreit um Fingerbreit nahmen diese winzigen Gebilde Gestalt an und wuchsen vor den sitzenden Männern in die Höhe. In den letzten paar Tagen waren sie zwei Reisenden begegnet, die gehört hatten, dass die Regierung bereit sei, Friedensgespräche mit ihnen zu führen und, solange diese andauerten, alle Kampfhandlungen einzustellen. Untereinander flüsternd, waren sie sich darin einig geworden, dass Jangu, der dem Häuptling am nächsten stand, das Thema an einem Abend seiner Wahl zur Sprache bringen würde.
Sie alle wussten, dass dies der Abend war, an dem sie diese wichtige Entscheidung treffen mussten, über die jeder von ihnen, ohne sich den anderen zu offenbaren, die ganze Zeit nachgedacht hatte.
Roza Khans trockenes, kratzendes Husten fuhr plötzlich in ihre Gedankengänge. Er räusperte sich und spuckte über die Schulter. »Welchen Weg schlagen wir morgen ein?«, fragte er und blickte in die Runde. »Jangu«, sagte er und starrte nach rechts. »Sag du mir, was du denkst.«
Die Antwort kam von dem Mann, der direkt neben ihm saß. »Sardar«, erwiderte Jangu, »es gibt keine einfache Antwort. Sprechen wir über die Dinge, die wir wissen. Dann werde ich euch von den Dingen berichten, die nur ich weiß. Anschließend werden wir eine Entscheidung treffen.«
»Ja, so wollen wir es machen«, erwiderte Roza Khan.
Jangu Khan fuhr fort: »Erstens, wir kennen alle den Samen, aus dem der Zwist erwachsen ist. Die Distriktbeamten entschieden sich dafür, den Häuptling unseres Bruderstammes abzusetzen und zu verhaften. Das Recht, Häuptlinge einzusetzen und abzusetzen, räumen wir nur uns selbst ein. Wir erkennen niemandes Macht an, zu entscheiden, wer unser Häuptling sein oder nicht sein soll. Das ist die Sache, um die es geht, und wir können nicht anders, als für eine solche Sache zu kämpfen. Ja, es ist eine Gewissensfrage.«
»Gewissen!«, fiel die Stimme des alten Mannes ein. »Rede mir nicht davon, Jangu! Was für ein Führer ist das Gewissen schon, wenn es den bösen Mann nicht weniger bereitwillig in seinen Bemühungen ermutigt als einen anderen, der gegen das Unrecht kämpft! Noch nie sah ich einen Mann, dem sein Gewissen zu schaffen gemacht hätte. Das Gewissen ist wie ein armer Verwandter, der in eines reichen Mannes Hause wohnt. Es muss zu allem gute Miene machen. Es muss zu allem gute Miene machen aus Angst, hinausgeworfen zu werden. Unsere Sache ist gerecht, weil wir sie für gerecht halten – aber mache dich nie vom Gewissen abhängig, egal ob von deinem oder wessen auch immer!«
Als er verstummte, meldeten sich zwei Stimmen eifrig zu Wort. »Sardar«, flehten sie, »bitte, lass Jangu weitersprechen!«
Es lag keine Ungeduld, nur Flehen in den Stimmen, aber der alte Mann verspürte hinter seinem Vorhang von Dunkelheit eine unermessliche Trauer und Einsamkeit. Sie begreifen nicht, dachte er. Ich hoffe bei Gott, dass es auf der anderen Seite Menschen gibt, die ebenso voller Zweifel sind wie ich, was Recht und Unrecht sei. »Sprich weiter, Jangu«, sagte er müde.
»Also«, fuhr Jangu fort, »sechs Neumonde haben wir gesehen, seit der Zwist begann. Während dieser Zeit ist vieles geschehen – größtenteils Böses. Unsere Feldfrüchte sind verbrannt worden, unser Getreide gestohlen und unsere Herden verkauft oder geschlachtet worden. Wir haben unsere Gewehre auf sie gerichtet und sie ihre auf uns. Wir haben getötet und ebenso sie. Mittlerweile bergen nicht einmal ihre Flugzeuge noch Schrecken für uns. All das wissen wir, doch jetzt werde ich euch Dinge sagen, die ihr nicht wisst.«
Jetzt hatte er die ungeteilte Aufmerksamkeit seiner Handvoll Zuhörer.
»Ja, sardar. Dies musst du wissen. Letzte Woche traf ich einen Belutschen, der in der Nähe des großen Salzsees im Norden Kohle brennt. Er erzählte mir, dass die Behörden während unserer Abwesenheit von zu Hause unsere Familien gefangen genommen haben. Sie – unsere Frauen und Kinder – und selbst entfernte Verwandte von uns leben jetzt im Gefängnis. In der Wüste geboren und aufgewachsen, wohnen und schlafen sie jetzt in übelriechenden dunklen Räumen in der Stadt.«
Ein Raunen ging durch die Gruppe von Männern.
»Ja«, fuhr Jangu fort. »Unser sardar hat recht mit dem, was er sagte. Die Männer, die das taten, stehen vor ihrem eigenen Gewissen als strahlende Helden da.« Er schwieg kurz und fuhr dann wieder fort.
»Doch ich hörte auch etwas anderes, was ihr nicht wisst. Derselbe Belutsche erzählte mir, dass die Beamten uns sicheres Geleit angeboten haben, damit wir mit ihnen Verhandlungen führen und dadurch unseren Streit beilegen können.«
Jangu zog ein schmutziges bedrucktes Blatt Papier aus seinem Hemd hervor und faltete es vorsichtig auseinander. »Auf diesem Papier steht die Einladung und das sichere Geleit. Kopien davon sind an viele Leute verschickt worden.«
Keiner der Männer konnte lesen oder schreiben, aber jeder betrachtete das Papier gründlich und mit scheinbarer Aufmerksamkeit, bevor er es an seinen Nachbarn weitergab.
Der Junge hatte nach dem Essen unruhig geschlafen. Als das Gespräch sich zum Ende neigte, wachte er auf und hörte noch, wie die Männer beschlossen, zum Hauptquartier der Regierung zu ziehen, um die Bedingungen des sicheren Geleits zu besprechen. Sie waren sich darin einig geworden, dass ihre Bereitschaft zu Gesprächen ihrer Ehre in keiner Weise Abbruch tun würde.
Am Abend des dritten Tages führten die Belutschen ihre Kamele in die Stadt. Der Junge, der keine Schuhe besaß, blieb auf einem der Tiere sitzen. Sie hielten vor dem ersten großen Gebäude, das sie sahen. Was sie für einen Palast hielten, war tatsächlich das örtliche Postamt.
Jangu stieg die Treppe hinauf und zeigte dem Mann, der vor dem Eingang stand, das abgegriffene Flugblatt.
»Lies das – wir sind wegen der Gespräche gekommen.«
Der Postmeister las das Blatt aufmerksam durch. Er sah die Männer mit aufgeregter Miene an. Während er zum Telefon eilte, schaute er zurück und rief: »Wartet auf die Beamten! Sie werden bald hier sein.«
Die sieben Männer, der Junge und die Tiere wurden zu einem großen Haus geführt. Die nächsten zwei Tage lang bekamen sie zwar zu essen, doch niemand kam, um mit ihnen zu sprechen. Sie alle waren ungeduldig wegen dieser Verzögerung, aber jeder achtete darauf, seinen Gemütszustand vor den anderen zu verbergen.
Die allgegenwärtige Stille ihres Landes hatte die Menschen ihres Volkes gelehrt, in ihrem Handeln bedächtig zu sein und langsam in ihren Reaktionen auf innere Regungen. Wohl beobachteten sie, dass ein Trupp Soldaten um das Haus herum postiert worden war. Doch selbst darüber vermieden sie miteinander zu sprechen – und erst recht, Roza Khan davon Mitteilung zu machen. Am fünften Tag erschienen endlich Besucher, die einen Jeep für sie dabeihatten. Die Belutschen wurden aufgefordert, ihre Gewehre und Kamele dazulassen. Sie fuhren eine Zeitlang, bis das Automobil ein von dicken Lehmmauern umgebenes Gelände erreichte. Der Jeep hielt vor einem der Gebäude, die sich dort befanden.
Der Raum, den sie betraten, war voller Menschen. Manche saßen auf Stühlen und manche auf Bänken. Die Leute redeten miteinander, und das Gespräch hörte auch nicht auf, als sie hereinkamen. Die Männer begaben sich in einen Teil des Raumes, der leer war, zogen die Schuhe aus und machten Anstalten, sich auf dem Fußboden niederzulassen.
Sie wurden barsch aufgefordert, stehen zu bleiben. »Es ist eine seltsame Sitte dieser Menschen«, dachten sie bei sich, »dass ein Teil steht und die anderen sitzen.« Sie wurden aufgefordert, auf den Koran zu schwören, dass sie nichts als die Wahrheit sagen würden. Dies machte sie noch perplexer. »Sie schwören bei einem Buch, während wir bei unserem Häuptling schwören – dem sardar unseres Stammes.«
Die ganze Zeit blieb die Luft um sie herum dick von Reden und Gelächter.
Dann wurden ihnen die Anklagepunkte vorgelesen. Sie hätten zwei Armeeoffiziere getötet. »Wenn ihr für schuldig befunden werdet, könntet ihr sterben«, erklärte ihnen ein Mann, der an einem Tisch am anderen Ende des Raumes saß.
»Oh nein!«, protestierte Roza Khan. »Wir sind zu Gesprächen hierhergekommen.« Er schwenkte das Blatt Papier in die Richtung der Stimme, die ihn angesprochen hatte. »Lies das!«, sagte er.
»Ich kenne dieses Schreiben«, sagte der andere Mann. »Es hat keinerlei Wert. Es ist nicht unterschrieben.«
»Sardar, sprich du für uns«, sagte Jangu, der neben ihm stand. Die anderen pflichteten ihm murmelnd bei.
»Nun gut, dann spreche ich also für meine sechs Gefährten.«
»Sieben«, warf der Junge ein.
»Sieben«, sagte Roza Khan. »Ich spreche als deren sardar, und ich sage, dass ein Wort keiner Unterschrift bedarf noch eines Zeichens und schon gar nicht eines Eides. Das Wort wurde angeboten, und wir haben es angenommen.«
»Muss ich alles aufschreiben, was gesagt wird?«, fragte der Gerichtsschreiber verdrießlich.
»Nein«, entgegnete der Richter, »schreib nur auf, was von Belang ist. Bis jetzt ist nichts gesagt worden, was aufgeschrieben werden müsste. Du kannst einfach aufschreiben, dass die Anklage verlesen und erklärt wurde und die Angeklagten sich schuldig bekannt haben.«
»Das habe ich nicht gesagt. Männer wurden getötet. Viele Männer, nicht lediglich die zwei, von denen du sprichst. Von euren und unseren. Als meinem Bruderstamm gesagt wurde, dass er keinen sardar mehr haben sollte, wie hätte ein Mann eine solche Beleidigung hinnehmen können? Hat es je einen Belutschen gegeben, der keinen sardar gehabt hätte?« Roza Khan verstummte.
»Hast du sonst noch etwas zu sagen?«
»Was soll ich ins Protokoll schreiben?«, fragte der Gerichtsschreiber wieder.
»Ich frage mich«, sagte Roza Khan, »wie ich dir erklären kann, was ein sardar ist. Wenn die Leute in diesem Zimmer still sein könnten, fiele es mir leichter, einen Gedanken zu fassen. Wir Belutschen sind an die Stille der Wüste gewöhnt«, entschuldigte er sich vornehm, »und sind nicht so klug wie ihr.«
Der Raum verstummte. Nach einer Weile sprach Roza Khan weiter.
»Ich weiß nicht, ob du mit dieser Geschichte etwas anfangen kannst. Aber es heißt, dass jeder Mann einen sardar braucht, sucht und für sich findet – ein Belutsche mehr als andere. Die Geschichte erzählt, dass Adam der erste Belutsche auf dieser Erde war. Als er feststellte, dass er allein war und es niemanden außer ihm gab, war er so unglücklich, dass er jemanden im Geiste erschuf und ihn Allah nannte, damit er einen sardar habe.«
Als Roza Khan am Ende der Geschichte angelangt war, vertieften sich die Falten um seine milchigen Augen abrupt.
Der Junge sah Roza Khan an. »Das ist eine schöne Geschichte, sardar, aber die Leute schreiben sie nicht auf.«
»Nein, nichts ist bislang aufgeschrieben worden«, bestätigte der Richter. »Für Märchen haben wir hier keine Verwendung. Sie haben keine Beweiskraft. Kann ein Märchen einen Tod erklären? Sag etwas über die Männer, die gestorben sind. Wie sind sie gestorben?«
»Nun gut.« Roza Khans Stimme klang mit einem Mal kräftiger. »Ich werde dir etwas sagen, das du vielleicht aufschreiben möchtest. Es sind Männer getötet worden, nicht nur einige wenige, sondern viele. Ich habe meinen Stamm dabei angeführt. Ich selbst habe Männer getötet. Mein jüngstes Verbrechen bestand darin, dass ich meinen Stamm in diesen letzten Irrsinn geführt habe. Ich forderte sie auf, sich an diesen Verhandlungen zu beteiligen. Dieses schreckliche Unrecht und diese Fehlentscheidung sind ausschließlich mir anzulasten.«
»Nein«, fiel ihm der Richter ins Wort. »Das kann kein Mensch glauben!« Er fügte den krönenden Schimpf hinzu. »Wenn ein Blinder behauptet, getötet zu haben oder der Anführer gewesen zu sein, so ist das nur eine Selbstüberhebung ohne jeden Wahrheitsgehalt.« Er wandte sich zum Schreiber. »Schreib ins Protokoll, dass die Angeklagten die Tötungen eingestanden haben.«
Noch ehe die Abendlampen angezündet wurden, war die Verhandlung vorüber. Die Gerichtsschreiber hatten angefangen, die Akten zu verschnüren und die Schränke zu schließen. Sobald das Urteil verkündet worden wäre, wollten sie sich auf den Heimweg machen.
Der Richter wandte sich zum Schreiber. »Im Protokoll soll stehen, dass nur sieben Männer angeklagt wurden und sie sich schuldig bekannten. Lasst das Kind laufen.« Sodann verkündete er das Todesurteil und wies die Beamten an, den Jungen auf ihrem Heimweg in der Stadt abzusetzen.
Über die Belutschen, ihr Anliegen, ihr Leben und ihren Tod wurde völliges und absolutes Stillschweigen gewahrt. Kein Zeitungsredakteur riskierte, sich ihretwegen eine Strafe einzuhandeln. In aller Regel suchten pakistanische Journalisten ihr Gewissen dadurch zu beschwichtigen, dass sie über das Unrecht schrieben, das den Menschen in Südafrika, in Indonesien, in Palästina und auf den Philippinen widerfuhr – aber nicht ihrem eigenen Volk. Kein Politiker riskierte es, verhaftet zu werden: Sie redeten zwar weiter über die Rechte des Einzelnen, über Menschenwürde, die Ausbeutung der Armen, aber das Unrecht, das gleich vor ihrer Haustür geschah, prangerten sie nicht an. Kein Bürokrat setzte seine Entlassung aufs Spiel. Er schmeichelte weiter seinem Gewissen mit der Macht, die er über seine unbedeutenden Untergebenen ausüben konnte.
Diese Männer starben einen endgültigen und totalen Tod. Sie werden in keinem Lied fortleben; keine Denkmäler wird man für sie errichten. Möglich, dass mit der Zeit selbst ihre engsten Angehörigen sie in ein verschlossenes Abteil ihres Bewusstseins wegsperren werden. Der unerbittliche Kampf ums Überleben gestattet es nicht, dass zu viel Zeit mit dem Gedenken an die Toten vergeudet wird.
Was mit ihnen starb, war ein Teil des Belutschenvolkes selbst. Ein wenig von der Spontaneität, mit der sie Zuneigung anboten, und etwas von ihrer Höflichkeit und ihrem Vertrauen. Auch dies wurde vor Gericht gestellt und abgeurteilt und starb mit diesen sieben Männern.
Als der subedar mit dem großen Schnauzbart am frühen Morgen die Patrouille durch die Stadt führte, erkannte er den kleinen Jungen, der teilnahmslos gegen die Gefängnismauer gelehnt stand. Der Junge war bei der Bande von belutschischen Banditen gewesen, als sie stolz in die Stadt eingezogen waren. Der subedar ließ seine Patrouille halten und näherte sich dem Jungen. »Was willst du jetzt tun?«, fragte er. »Deine Gefährten, sie sind alle tot.«
»Ich weiß es nicht«, sagte der Junge. Plötzlich hob er das Gesicht. In seine Augen kam ein eifriger Blick. »Darf ich in die Festung gehen?«, fragte er und zeigte auf die Gefängnismauern. Der subedar sah den Jungen scharf an, um festzustellen, ob er scherzte. Ghuncha Gul hasste jede Leichtfertigkeit, aber der Junge hatte in völligem Ernst gesprochen.
»Nein«, sagte er leise. »Jetzt jedenfalls noch nicht. Ich verlasse diese Stadt, und du wirst mit mir kommen. Der Ort, zu dem ich gehe, ist weit weg, aber es kann sein, dass es dir und mir dort gefällt.«
Ghuncha Gul befahl der Patrouille, sich in Marsch zu setzen. Er blickte zurück und sah, dass der Junge ihm folgte.