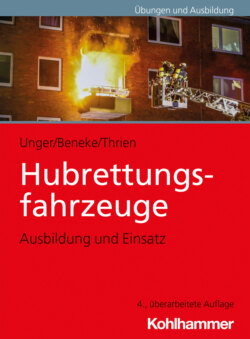Читать книгу Hubrettungsfahrzeuge - Jan Ole Unger - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
[13]2 Entwicklung
ОглавлениеDie ersten Drehleitern wurden zu Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelt. Am 2. Mai 1802 stellte der Konservator des Pariser Artilleriezentraldepots, Edouard Regnier, eine von ihm entworfene fahr-, dreh- und ausziehbare Feuerleiter vor.
Zunächst nur als Holzmodell präsentiert, wurde seine revolutionäre Idee nach Bewilligung von Finanzmitteln in Originalgröße gebaut. Die erste Drehleiter der Welt erreichte eine Höhe von 15,85 Metern und konnte von zwei Feuerwehrmännern in vier Minuten vollständig ausgezogen und somit einsatzbereit gemacht werden.
Die erste deutsche Drehleiter wurde im Jahr 1808 von dem Lienzinger Wagnermeister Andreas Scheck gebaut und an die Stadt Knittlingen geliefert.
[14]Die »Knittlinger Leiter« war eine zweiteilige Schiebleiter, die auf einem vierrädrigen Wagen, der für Pferdezug ausgelegt war, aufgebaut wurde. Der Drehkranz, mit dem die Unterleiter verbunden war, war über der Vorderachse angeordnet. Die Leiter wurde zur Hinterachse hin abgelegt. Dieses Prinzip wird heute noch bei so genannten »Mid-Mount Aerials« und »Tiller Ladders« nordamerikanischer Drehleiterhersteller verwendet. Das Aufrichten der Leiter wurde durch Stützstangen ermöglicht, die am Kopf der Leiter befestigt waren. Die Leiter konnte dann mittels Kurbelbetrieb über eine Seilwinde auf eine Länge von etwa elf Metern ausgezogen werden. Bis 1948 – 140 Jahre nach Indienststellung – war die »Knittlinger Leiter« im Dienst der Feuerwehr Knittlingen. Sie wird heute im Deutschen Feuerwehr-Museum in Fulda für die Nachwelt erhalten.
Bild 1: Holzmodell der weltweit ersten Drehleiter. Das gezeigte Modell steht im Feuerwehrmuseum in München. (Bild: Archiv M. Gihl)
Als einer der wichtigsten Konstrukteure und Erfinder von technischen Details rund um die Drehleitern gilt zweifelsohne Conrad Dietrich Magirus. Der Kommandant der Ulmer Feuerwehr vertrat in seinem 1877 erschienenen Werk »Das Feuerlöschwesen in allen seinen Theilen« die These, dass nur eine ausziehbare Leiter, die auch im Freistand bestiegen werden könne, zur Verbesserung eines Löscherfolges bei der Brandbekämpfung beitragen würde. Bereits fünf Jahre zuvor hatte Magirus eine Leiter gebaut, die diesen Ansprüchen gerecht wurde: die so genannte »Ulmer Leiter«. 1904 entwickelte Magirus gemeinsam mit seinen Ingenieuren die erste vollmaschinell dampfbetriebene Drehleiter der Welt. Diese für die Feuerwehr Köln bestimmte Drehleiter hatte eine Steighöhe von 22 Metern und besaß drei Dampfmaschinen: eine für den Antrieb der Hinterräder und jeweils eine für das Aufricht- und Auszugsgetriebe.
Vor Beginn des Ersten Weltkrieges wurde bei der »Carl Metz Feuerwehrgerätefabrik« in Karlsruhe begonnen, Drehleitern mit automatischem Leitergetriebe zu konstruieren. Eine Kippsicherung wurde bei diesem Modell über eine mechanische Waage im Aufrichtegestell erreicht. Dieses Prinzip wurde von Metz im Grundsatz bis 1993 in allen Drehleitern angewendet.
In den 1930er-Jahren ersetzten geschweißte Stahlleitersätze die bisher verwendeten Holzleitersätze. Die Drehleitern wurden größer, es wurden bei einigen Modellen Steighöhen von 46 Metern erreicht.
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren viele Feuerwehrfahrzeuge zerstört oder von den Siegermächten requiriert worden. Eine Neubeschaffung von Drehleitern bei den Feuerwehren begann aufgrund fehlender Finanzmittel zum Teil nur sehr zögerlich. Im Jahr 1957 erschien die erste Nachkriegsnorm für Drehleitern, die DIN 14701 »Kraftfahr-Drehleitern«. Man unterschied nur noch handbetätigte und maschinell betätigte Drehleitern.
[15]Als wesentliche Weiterentwicklung im Drehleiterbau kann die Einführung der Rettungskörbe angesehen werden. 1965 stattete Magirus seine Drehleitern mit einem an der Leiterspitze einzuhängenden Korb aus, mit dem die Rettung gehunfähiger Personen aus oberen Geschossen ermöglicht werden sollte. Auch wenn Metz bereits in den 1930er-Jahren mit Körben, die zum Teil unter der Leiterspitze an Drahtseilen hängend befestigt waren, experimentierte, legte sich der Karlsruher Drehleiter- Hersteller erst 1967 auf das System eines auf der Leiterspitze stehenden zwangsgesteuerten Rettungskorbes fest.
Bild 2: Die hydraulische Schrägabstützung (rechts) ermöglichte eine größere seitliche Ausladung des Leitersatzes als die senkrechte Spindelabstützung (Bild: Archiv M. Gihl)
Die Fallhaken, die ein Nachsacken des Leitersatzes verhinderten, verschwanden und wurden durch zwei voneinander unabhängige Sicherheitseinrichtungen ersetzt, die jeweils eigenständig die Leiter in ihrer Stellung halten mussten.
Die manuellen Fallspindeln, die bisher die Abstützung bei Drehleitern darstellten, wurden durch die hydraulische Schrägabstützung ersetzt. Diese Abstützform wurde von Magirus und Metz gleichermaßen übernommen, sie sicherte durch die über die [16]Fahrzeugbreite hinausragenden Stützbalken ein größeres Benutzungsfeld, als es mit Fallspindelabstützung erreichbar war. So konnte die Drehleiter bei wesentlich größerer Ausladung des Hubrettungsauslegers noch im Freistand bestiegen werden.
Bereits 1957 wurde die damals größte Drehleiter der Welt, eine Metz DL 60+ 2, auf einem Kaelble-Fahrgestell nach Moskau geliefert. 1966 diskutierten Hamburgs damaliger Oberbranddirektor Hans Brunswig und Vertreter von Metz die Machbarkeit einer DL 75. Diese wurde allerdings nie realisiert.
1972 verabschiedete sich Metz bei der DL 30 von der bis dahin bei beiden Drehleiter-Herstellern zu findenden Schrägabstützung und führte das bis heute verwendete System der Waagerecht-Senkrecht-Abstützung ein, welches eine variable Abstützbreite ermöglicht.
Da die Drehleiter-Fahrzeuge in ihrer Bauhöhe mit zunehmender Entwicklung immer größer wurden (um 1920 ca. 2,70 m Höhe, 1970 ca. 3,25 m Höhe) wurde Mitte der 1970er-Jahre bei Magirus in Ulm damit begonnen, eine Drehleiter zu entwickeln, die diesen Trend stoppen sollte. Die Norm für Hubrettungsfahrzeuge gab und gibt eine maximale Bauhöhe von 3,30 m vor.
Im Jahr 1979 wurden der Feuerwehr München zwei Versuchsfahrzeuge der so genannten »niedrigen Bauart« (Kürzel »n.B.«) übergeben, welche eine Gesamthöhe von nur 2,83 m aufwiesen. Bei diesem Fahrzeug wurden erstmalig das so genannte Vario-Drehgetriebe und eine neue in der Breite variable X-Abstützung verbaut. Magirus bezeichnete diese Abstützform als »Vario-Abstützung«. Metz hingegen ging einen anderen Weg, um die Bauhöhe der Fahrzeuge zu reduzieren. Bei den Karlsruher Drehleitern wurde der Drehkranz mittig auf dem Fahrzeug angeordnet und der Leitersatz dann nach hinten abgelegt (vgl. »Knittlinger Leiter«). Es entstand die SE-Baureihe, wobei das Kürzel »SE« für Soforteinstieg stand.
Die DIN 14701 wurde 1978 und 1980 überarbeitet, erweitert und der Begriff »Hubrettungsfahrzeuge« wurde eingeführt. Auch die Nomenklatur änderte sich. Man ging von der klassischen Bezeichnung der Steighöhe weg und bezog sich stattdessen auf die Nennrettungshöhe und die Nennausladung. Die Hubrettungsfahrzeuge wurden somit als Drehleiter mit Rettungskorb »DLK« oder als Drehleiter ohne Rettungskorb »DL« mit der Nennrettungshöhe von 23 Meter bei einer seitlichen Nennausladung von zwölf Metern bezeichnet. Die 23 Meter Nennrettungshöhe ergeben sich dabei aus der baurechtlichen Hochhausgrenze (22 Meter Fußbodenhöhe über der Geländeoberfläche, zuzüglich einem Meter Brüstungshöhe).
Viele Jahre gab es in Deutschland ausschließlich Drehleitern der beiden Hersteller Magirus und Metz. Dies änderte sich 1987, als der Feuerwehrgerätehersteller Ziegler in Kooperation mit dem französischen Drehleiter-Hersteller Camiva die erste Drehleiter nach Meersburg auslieferte. Die Kooperation zwischen Ziegler und Camiva hielt [17]bis Ende der 1990er-Jahre. Heute gehört Camiva zum Iveco-Konzern und führt die Endmontage der in Ulm gebauten Drehleitern für den französischsprachigen Markt durch. Auch der zweite französische Drehleiter-Hersteller Riffaud versuchte in Deutschland Fuß zu fassen, konnte allerdings in den 1990er-Jahren lediglich vier vollautomatische Drehleitern verkaufen.
Ende der 1980er-Jahre wurden bei den beiden deutschen Drehleiter-Herstellern Stülpkörbe (Magirus), beziehungsweise Klappkörbe (Metz) eingeführt. Der Überhang über die Leiterspitze in den Verkehrsraum und das zeitintensive nachträgliche Einhängen des Korbes im Einsatzfall gehörten damit der Vergangenheit an. Die Rettungskörbe beider Hersteller wurden in den Folgejahren weiterentwickelt und von einer Nutzlast von 180 Kilogramm (zwei Personen) auf 270 Kilogramm (drei Personen) Nutzlast aufgewertet.
Kurz nach der Einführung der über den Leitersatz klappenden Rettungskörbe stellten Magirus (Interschutz 1988) und Metz (Deutscher Feuerwehrtag 1990) elektronisch überwachte Drehleitern der Öffentlichkeit vor. Magirus nannte sein System »Computer Controlled« (CC). Bei Metz hieß die Überwachung »Program Logic Control« (PLC).
Im Jahr 1989 wurde die Norm für Hubrettungsfahrzeuge erneut überarbeitet und in drei Teile aufgegliedert. Es wurden dabei drei verschiedene Nennreichweiten festgeschrieben: 23-12, 18-12 und 12-9.
Nach der deutschen Wiedervereinigung wurde der ehemalige Volkseigene Betrieb (VEB) Feuerlöschgerätewerk Luckenwalde privatisiert. Die Drehleiter-Produktion wurde auch in der neuen GmbH weitergeführt. Zunächst wurden die in der DDR bewährten Drehleiter-Komponenten auf Mercedes-Fahrgestellen aufgebaut. Innerhalb von nur drei Jahren entwickelten die Luckenwalder dann eine eigene computergestützte Drehleiter, die DLK 23-12 CIR. Das Kürzel »CIR« steht dabei für »Computer Integrierte Rettung«. Erstmalig wurde ein Bedienkonzept mit LCD-Farbdisplay verbaut. 1993 wurde die erste Drehleiter dieses Typs an die Feuerwehr Teterow (Mecklenburg-Vorpommern) geliefert. Im Jahr 1995 musste die FGL GmbH dann Insolvenz anmelden. Metz übernahm die Produktionsstätten in Luckenwalde und stellte die Herstellung der FGL-Drehleitern nach insgesamt nur 16 Auslieferungen ein.
1994 wurde bei der Interschutz in Hannover von Magirus eine »Weltneuheit«1 präsentiert, die DLK 23-12 CC GL. Die Bezeichnung »GL« steht dabei für »Gelen[18]kleiter«. Nur neun Jahre später ging das 250. Fahrzeug mit Gelenk im Leitersatz an die Feuerwehr Gosheim (Baden-Württemberg). Seit dem Jahr 2006 bietet Magirus auch ein auf 4,70 m teleskopierbares Gelenkteil an, um die maximale Rettungs- und Arbeitshöhe zu vergrößern.
2007 gingen auch die Karlsruher Drehleiterhersteller von Metz Aerials dazu über, Drehleitern mit einem Gelenkteil zu produzieren. Das erste Fahrzeug dieser Baureihe wurde im September 2007 beim 5. Technikseminar der Feuerwehr Hamburg der Öffentlichkeit vorgestellt.
Im Jahr 2002 brachte Magirus eine Weiterentwicklung seiner computergesteuerten Drehleiter auf den Markt. CS ersetzte CC, anstatt »Computer Controlled« hieß es nunmehr »Computer Stabilized«. Das neu entwickelte Computersystem erkennt das Auftreten von Schwingungen des Hubrettungsauslegers. Es berechnet diese und regelt den hydraulischen Zufluss in die Aufrichtezylinder so präzise, dass aufgetretene Schwingungen innerhalb kürzester Zeit abgefangen werden. Ein neu konzipierter Drei-Personen-Rettungskorb (Nutzlast 270 Kilogramm) mit zwei auf den vorderen Ecken befindlichen Einstiegen wurde ab der Baustufe CS ebenfalls angeboten. Seit 2004 bot auch Metz einen neuen Rettungskorb an, der die Vorzüge der über Eck angeordneten Einstiege beinhaltete.
Mit der Einführung der Norm DIN EN 14043 »Hubrettungsfahrzeuge für die Feuerwehr – Drehleiter mit kombinierten Bewegungen (Automatik-Drehleitern)« sowie der DIN EN 14044 »Hubrettungsfahrzeuge für die Feuerwehr – Drehleiter mit aufeinander folgenden (sequenziellen) Bewegungen (Halbautomatik-Drehleitern)« können seit dem 1. Januar 2006 nunmehr unterschiedliche Drehleitertypen beschafft werden. Außer den bisher bekannten Drehleitern mit drei gleichzeitig möglichen Bewegungen, können nun auch sequenziell zu steuernde Drehleitern beschafft werden. Bei diesen Drehleitern kann immer nur eine Bewegung ausgeführt werden, d.h., der Leitersatz kann immer nur nacheinander aufgerichtet, gedreht und ausgefahren werden. Die Kurzbezeichnungen für Drehleitern änderten sich ebenfalls mit der Einführung der neuen Normen. Wurde eine Drehleiter mit einem 30 Meter langen Leitersatz bisher als DLK 23-12 bezeichnet, hieß sie nun DLA (K) 23/12 bzw. DLS (K) 23/12; das »A« steht dabei für »automatisch«, das »S« für »sequenziell«.
Bereits ein Jahr zuvor (in 2005) wurde die DIN EN 1777 »Hubrettungsfahrzeuge für Feuerwehren und Rettungsdienste, Hubarbeitsbühnen (HABn) – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung« veröffentlicht. Diese ersetzte den Teil der DIN 14701, in dem die Anforderungen an Teleskop- und Gelenkmaste beschrieben waren.
Nachdem sich Magirus und Metz viele Jahre den deutschen Drehleiter-Markt teilten und Camiva im Iveco-Konzern aufgegangen war, trat der französische [19]Drehleiter-Hersteller Riffaud als Teil des Gimaex-Konzerns 2006 nach zwölfjähriger Abwesenheit2 wieder in den Markt für Hubrettungsfahrzeuge ein. Eine erste Drehleiter DLA (K) 18/12 wurde nach Thüringen geliefert.
Während der Fachmesse INTERSCHUTZ 2010 in Leipzig präsentierten die Drehleiter-Hersteller einige Neuerungen. Gimaex, Metz Aerials und Iveco-Magirus zeigten neue Vier-Personen-Rettungskörbe.
Metz Aerials präsentierte zudem ein neuartiges hydraulisches Schwingungsdämpfungssystem für deren Drehleitern. Magirus zeigte eine Drehleiter mit einer Arbeitshöhe von 60 Metern und entwickelte die DLA (K) 23/12 CS GL weiter. Anstelle eines fünfteiligen Leitersatzes verfügt das Fahrzeug nun über einen vierteiligen Leitersatz, der mittels einer speziellen Kinetik ausgeschoben wird.
2012 wurde von Metz Aerials eine neue Gelenk-Drehleiter mit kompakterem Leitersatz präsentiert, die Kinematik des Gelenkteils wurde dabei neu konstruiert. Metz nennt diese Baureihe XS.
2013 wurden durch Gimaex gleich zwei Neuheiten auf den Markt gebracht, eine besonders kompakte Drehleiter DLA (K) 23/12 mit fünfteiligem Leitersatz und kurzem Radstand für eine gute Wendigkeit. Weiterhin wurde auch eine Drehleiter mit vierteiligem Leitersatz, wobei die Oberleiter als abwinkelbarer Einzelauszug genutzt werden kann, vorgestellt.
2014 hat Magirus ein neuartiges System für die Rettung schwergewichtiger Personen präsentiert. Der so genannte Rescue Loader kann anstelle des Rettungskorbes an der Leiterspitze adaptiert werden, um dort eine Schwerlast-Schleifkorbtrage daran zu befestigen. Mithilfe einer Fernsteuerung kann der Rescue Loader gesteuert werden. Ebenfalls wurde bei Magirus ein neues Design für die Drehleitern gezeigt.
Während der INTERSCHUTZ 2015 in Hannover wurden von den Herstellern von Hubrettungsfahrzeugen mehrere Innovationen präsentiert. Metz, seit der INTERSCHUTZ zu Rosenbauer Karlsruhe umfirmiert, zeigte einen neuen Rettungskorb mit einer Nutzlast von bis zu 500 kg. Der Korb kann an der Frontseite durch Entnahme aller Umwehrungsteile komplett geöffnet werden. Somit kann auch eine Krankentragenlagerung nunmehr auf dem Korbboden fixiert werden. Dies ermöglicht eine größere Nutzlast für die Rettung von adipösen Patienten.
Magirus zeigte außer einem neuen Design für den europäischen Markt innovative Sicherungssysteme für das Zurückhalten im Korb. Zudem wurde ein Absturzsiche[20]rungssystem für die zeitgleiche mehrfache Top-Rope-Absturzsicherung gezeigt. Dieses System kann an der Leiterspitze anstelle des Korbes zugerüstet werden.
Anfang 2018 wurde die DIN 14701-1 veröffentlicht, die als deutsche Norm die europäische DIN EN 1777 Hubarbeitsbühnen (HAB) für Feuerwehren und Rettungsdienste ergänzt. In dieser Norm werden weitergehende Anforderungen an die jetzt Teleskopgelenkmaste (TGM) bezeichneten Hubarbeitsbühnen dokumentiert.
1
Seit den 1980er-Jahren baute der kanadische Feuerwehrfahrzeug-Hersteller Camions Pierre Thibault Inc. Gelenkdrehleitern des Typs »Sky Arm« nach dem gleichen Prinzip. 1991 übernahm die neugegründete Nova Quintech Corp. die Produktion. Seit 1997 baut der US-Feuerwehrfahrzeug-Hersteller Pierce den Typ »Sky Arm«.
2
Im Jahr 1994 wurde die bis dahin letzte Riffaud-DLK 23-12 an die Feuerwehr Bad Friedrichshall ausgeliefert.