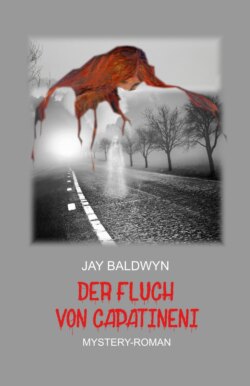Читать книгу Der Fluch von Capatineni - Jay Baldwyn - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1
ОглавлениеEs war eine stürmische und regnerische Nacht, in der man sprichwörtlich keinen Hund vor die Tür jagte. Das jämmerliche Heulen stammte deshalb auch nicht von Hunden, die man aus Sicherheitsgründen mit den Schafen oder Ziegen im Stall schlafen ließ, sondern von den Wölfen der näheren Umgebung.
Dem jungen Mädchen schien das Unwetter nichts auszumachen. Unbeirrt setzte es seinen Weg von dem kleinen Friedhof durch das in tiefem Schlaf liegende Dorf fort, bis es schließlich am Haus der Eltern ankam.
Mioara Udoi schreckte aus dem Schlaf hoch, als es an der hölzernen Tür klopfte. Ihr Mann Razvan, der Schäfer, drehte sich auf die andere Seite, während er Laute des Unmuts ausstieß.
»Wer kann mitten in der Nacht etwas von uns wollen?«, fragte Mioara, »ob ein Unglück geschehen ist?«
»Bin ich Hellseher?«, grummelte Razvan, »sieh nach, dann weißt du Bescheid!«
Die Frau zog ihren verschlissenen Wollmantel an und ging zur Eingangstür. Unterwegs beruhigte sie ihre vier Kinder, die allesamt wach geworden sich die Augen rieben.
»Schlaft weiter, es ist nichts«, flüsterte sie. Als sie die Tür öffnete und einen Schwall feuchter, kalter Luft hereinließ, stieß sie einen Schrei des Entsetzens aus. »Dakaria, bist du das? Aber wie kann das sein?« Dann versagten ihr die Beine, sodass sie sich an der Wand abstützen musste.
»Was willst du hier?«, fragte Razvan, der unbemerkt hinter sie getreten war, »wir haben dich vorige Woche begraben. Deine Wohnung ist jetzt im Reich der Toten und nicht mehr bei uns.«
»Willst du deine Tochter nicht hereinlassen, Tatăl? Ich dachte, du freust dich, mich wiederzuhaben.«
»Nenn mich nicht Vater! Unsere Tochter liegt unter der Erde. Ich weiß nicht, wer oder was du bist.«
»Aber, tata, erkennst du mich nicht? Ich bin Dakaria.«
»Jetzt lass sie doch um Gottes willen herein, bevor die Nachbarn noch etwas mitkriegen«, sagte Mioara.
»Danke, Mama.«
»Ich habe gesagt, du sollst uns nicht Vater und Mutter nennen«, schimpfte Razvan, »so eine Höllengeburt wie du hat keine Eltern, höchstens den Teufel.«
Mioara zog ihre Tochter am Ärmel ins Haus und dirigierte sie zur Feuerstelle, in der noch etwas Glut brannte.
»Ich mache dir erst einmal einen heißen Tee, und dann musst du aus den nassen Sachen raus. Du holst dir ja den …« Mioara hielt erschrocken inne.
»Speise und Trank braucht dieses Ding nicht mehr, und nasse Kleidung macht ihm auch nichts aus. Den Tod kann es sich nicht mehr holen, denn der hat sie schon. Ich habe immer gesagt, sie ist eine Hexe. Aber du wolltest ja nicht hören. Wir hätten sie in ihrem Sarg fesseln sollen oder ihr ein Kreuz auf die Brust legen, zumindest aber eine mit Gras bewachsene Erdscholle auf ihren Mund oder ihre Stirn legen sollen. Das hilft gegen Wiedergänger. Ich habe schon so etwas geahnt und darauf geachtet, dass keine Bänder, Schleifen, Zipfel ihres Kleides oder des Totentuchs und keine Blumen ins Gesicht oder in den Mund hingen, damit sie nicht ihre Geschwister oder uns nachholt. Doch es hat alles nichts genutzt, wie man sieht.«
»Lass doch, Razvan! Sie ist doch unser Kind. Vor Kurzem hast du noch bittere Tränen an ihrem Grab vergossen.«
»Ja, da habe ich sie auch noch nicht in ihrem Sarg schmatzen gehört. Sieh nur! Sie sieht gesünder als vorher aus. Wahrscheinlich weil sie dir die Lebenskraft ausgesaugt hat. Du bist die letzten Tage immer elender geworden. Wenn sie ihr schauriges Werk fortgesetzt hätte, wärst du noch an Auszehrung gestorben. Sie ist ein Nachzehrer, der dir alle Kraft raubt. Hat sie dich aus ihrer Grube gerufen oder ist sie gedanklich mit dir in Verbindung getreten?«
»Weder noch. Sonst hätte ich doch nicht so einen Schreck bekommen, sie zu sehen. Was machen wir denn jetzt? Die Leute aus dem Dorf werden Fragen stellen.«
»Wir sollten ihr einen Pfahl ins Herz rammen und sie dorthin zurückbringen, wo sie hergekommen ist.«
Plötzlich ertönte ein klägliches Weinen. Lacrima, die Jüngste unter den Geschwistern, konnte nicht glauben, was sie gerade gehört hatte. Auch Sinka und Traian, die nur jeweils zwei und vier Jahre älter waren, kämpften mit den Tränen. Nur Petre, der Älteste, behielt die Nerven.
»Warum schickt ihr sie nicht zur Burg? Die Gräfin Luena soll einen ungeheuren Verschleiß an Dienstboten haben. Erst neulich waren ihre Häscher wieder im Dorf«, sagte Petre, »und sie kommen bestimmt wieder. Wenn euer Verdacht stimmt, wird man ihr da oben nichts anhaben können.«
»Das ist eine gute Idee«, meinte Razvan, »soll sie doch unter dem adligen Gesindel etwas aufräumen.«
»Scht, wenn dich einer hört!«, ermahnte Mioara ihren Mann, »du redest dich noch um Kopf und Kragen. Wärst du damit einverstanden, mein Kind?«
Dakaria zuckte mit den Schultern. »Hier bin ich ja nicht willkommen. Ich wollte schon immer mal wissen, wie man in diesen Kreisen so lebt.«
»Stell dir das nicht so einfach vor«, sagte Petre, »die Gräfin gilt als unerbittlich und grausam.«
»Jetzt rede es ihr nicht wieder aus. Der Vorschlag kam doch von dir.« Razvan sah seinen Sohn böse an.
»Ich werde schon mit ihr fertig werden. Schlimmer als hier, wo mich keiner will, kann es nicht sein.«
Lacrima fing wieder an zu weinen. »Ich will dich. Du hast mir immer so schöne Geschichten erzählt«, sagte sie kläglich.
»Ja, ich will auch, dass du hier bleibst«, meinte Traian, und Sinka nickte heftig, um im nächsten Moment auf Dakaria zuzustürzen und sich an ihr festzuklammern.
»Komm da weg! Du bist noch zu klein, um zu verstehen, was hier passiert.« Razvan riss Sinka von Dakaria weg und verpasste ihr eine Ohrfeige.
»Im Schlagen seid ihr groß«, sagte Dakaria, »ich habe nicht die Pest, dass man sich vor mir fürchten müsste. Vielleicht habt ihr mich ja lebendig begraben. Habt ihr einmal daran gedacht?«
»Unsinn, der Doktor hat eindeutig deinen Tod festgestellt.«
»Der alte kurzsichtige Säufer? Ich möchte nicht wissen, wie viele der schon unter die Erde gebracht hat, obwohl sie noch lebten.«
»Und wie ist es dir dann gelungen, über eine Woche ohne Wasser und Speise auszukommen?«, wollte Razvan wissen.
»Du selbst behauptest doch, ich sei eine Hexe. Vielleicht kann ich meine Lebensfunktionen auf das Geringste zurücksetzen.«
»Du meinst, wie ein indischer Yogi? Wohl kaum. Und wie konntest du dich aus dem Sarg befreien, nur mit den Händen? Ich denke eher, du hast dem Teufel den Arsch geküsst oder ihm deine Seele verkauft. Meinst du, ich habe nicht gemerkt, wie du dich des Nachts oft davongeschlichen hast?«
»Indem ich den Totengräber dazu brachte, die Grube wieder auszuheben und den Deckel zu öffnen, zum Beispiel«, ließ sich Dakaria nicht beirren.
»Und zum Dank liegt er jetzt statt deiner da unten, ja?« Razvans Augen sprühten Blitze vor Zorn. »Hast du ihn umgebracht?«
»Es gibt schwarze und weiße Hexen, lieber tata. Ich bin eine weiße. Ein kleiner Liebeszauber genügte, um ihn gefügig zu machen.«
»Dann geh doch zu ihm. Vielleicht lässt er dich bei ihm wohnen. Hier kannst du jedenfalls nicht bleiben. Ruh dich noch etwas auf dem Strohsack aus, aber bevor es hell wird, machst du dich auf den Weg!«
»Razvan, bitte, lass sie noch ein paar Tage hier, bis die Leute aus dem Schloss kommen. Wir machen sie hübsch zurecht und übergeben sie dann«, flehte Mioara.
»Wenn du es nicht anders willst. Aber sollte nur einer von uns krank werden … Ich habe keine Hemmungen, einen Pfahl anzuspitzen …«
Die Burg Poenari – Cetatea Poenari oder Cetatea Poienari lag in achthundertfünfundfünfzig Metern Höhe am Südhang des Fagaras-Massivs. Als Erbauer galt Fürst Rudolf Bessaraba der Schwarze – Radu Negru Vodă, der legendäre Gründer der Walachei. Im 14. Jahrhundert noch die wichtigste Festung der Bessarabiden, wechselten in den Folgejahrzehnten Name und Bewohner mehrmals, bis die Burg verlassen wurde und allmählich verfiel.
Der wohl berühmteste Besitzer war im 15. Jahrhundert Vlad III. Drăculea, der Bram Stoker als Vorlage der Romanfigur Dracula dienen sollte. Es ist stark zu bezweifeln, dass Vlad Drăculea ein Vampir war, doch er war schon zu seiner Zeit berühmt berüchtigt für seine Grausamkeit. So ließ er angeblich Gesandten die Hüte am Kopf festnageln, Tausende pfählen und Zigeuner gegen ihren Willen in den Kriegs ziehen, indem er sie wählen ließ, ob sie gegen die Türken kämpfen oder ihre Kinder verspeisen wollten. Er soll das Blut seiner Opfer getrunken und die Armen verbrannt haben, um auf diese Weise die Armut zu „beseitigen“.
Eine alte rumänische Geschichte beschreibt, dass Vlad einst eine goldene Schale auf dem Marktplatz von Târgovişte platziert hatte. Diese Schale durfte von jedem zum Stillen des Durstes benutzt werden, musste aber auf dem Marktplatz verbleiben. Am nächsten Tag soll er zurückgekehrt sein, um diese wieder aufzulesen. Niemand hatte es gewagt, die Schale zu berühren, die Furcht vor lebensbedrohender Bestrafung war zu groß.
Diese vergleichsweise harmlose Geschichte stand im Gegensatz zu deutschen Erzählungen. Demnach richtete sich Vlads Zorn auch auf Verstöße gegen die weibliche Sittsamkeit. Unverheiratete Mädchen, die ihre Jungfräulichkeit verloren; Ehebruch begehende Ehefrauen, sowie unkeusche Witwen wurden allesamt Ziel von Vlads Grausamkeiten. Frauen mit derartigen Verfehlungen wurden oft die Geschlechtsorgane entfernt oder die Brüste abgeschnitten. Auch wurden sie mit glühenden Pfählen durch die Vagina gepfählt, bis der Pfahl zum Munde der Opfer heraustrat. Vlad bestand ebenso auf Ehrlichkeit und den Fleiß seiner Untertanen. Kaufleute, die ihre Kunden betrogen, fanden sich schnell neben gemeinen Dieben am Pfahl wieder. Vlad sah die Armen, Kranken und Bettler als Diebe. Eine Geschichte erzählt von seiner Einladung an Kranke und Arme zu einem Festmahl, währenddessen das beherbergende Gebäude geschlossen und angezündet wurde.
Die strategische Bedeutung der Burg Poenari erkennend, ließ er sie durch Zwangsarbeiter instand setzen und verstärken. Der Chronik nach mussten die Bojaren so hart arbeiten, dass ihre Kleider in Fetzen an ihnen hingen, wenn sie nicht gar vor Erschöpfung starben.
Der lang gestreckte Bau von vierundvierzig Metern Länge und nur elf Metern Breite wies bis zu drei Meter dicke und über fünfzehn Meter hohe Mauern auf. Zu den älteren an der Nordseite aus Flussstein kamen an der Südseite Ziegelsteinaufbauten auf Flusssteinfundamenten hinzu, die direkt in die steil ins Tal abfallende Felsformation übergingen. Ihre geschützte Lage machte sie fast uneinnehmbar. Die Türme hatten einen Zinnenkranz mit Verteidigungsplattform und Spitzhelmen, die Mauern Wehrgänge. Fünf Wehrtürme, je zwei runde an Süd- und Nordseite sowie ein massiver, mit Stützpfeilern verstärkter prismatischer Wohnturm, der noch aus dem 13. Jahrhundert und gleichzeitig als Bergfried und Torturm den einzigen Zugang an der westlichen Mauerseite bewachte, komplettierten die Wehranlage. Der Wohnturm bildete den Burgkern. Die luxuriöse Einrichtung wies Sechskantziegel und glasierte Kacheln auf. Das Kellergeschoss im Felsen war Verlies und Aufbewahrungsort des Landesschatzes, das Erdgeschoss diente der Wachmannschaft, die oberen vier Stockwerke beherbergten Wohnräume für Burggraf und Burgvogt. Im Innenhof stand die Burgzisterne.
Nach der Flucht von Vlad III. blieb die Burg bis 1529 Stützpunkt der walachischen und transsilvanischen Fürsten. Burggraf Neagu verließ 1552 Burg Poenari, die danach zum zweiten Mal aufgegeben werden sollte. Burggraf Dragomir Vacar, der Mitte des 17. Jahrhunderts dort mit Frau Luena und Gefolge einzog, störte sich nicht an dem Umstand, dass die Burg mehr und mehr verfiel. Denn er hielt sich ohnehin die meiste Zeit in einem der Türme auf, um dort seine alchimistischen Studien zu betreiben. Er hatte es sich in den Kopf gesetzt, es Paracelsus gleichzutun, indem er die Alchemie als Grundlage zur Herstellung möglichst reiner Heilmittel für die Medizin nutzen wollte.
Paracelsus unternahm den Versuch, einen genauen Zusammenhang zwischen einem Medikament und der Krankheit, die damit behandelt wurde, herzustellen. Dazu formulierte er seine Lehre vom Mikrokosmos Mensch und dem Makrokosmos Umwelt. Beides bestehe aus den gleichen Substanzen und deshalb entstünde die Krankheit, wenn das „äußere“ Mineral seinen Zwilling im Körper entzünde und so die Krankheit zum Ausbruch bringe, war er überzeugt. Die Behandlung bestand darin, aus dem verursachenden Mineral ein Heilmittel herzustellen und es dem Patienten zu verabreichen. Die Herstellung dieser reinen Heilmittel sollte vor allem durch „Sublimation“ und „Destillation“ von unreinen „Schlacken“ befreiter Wirkstoffe erfolgen.
Burggräfin Luena, eine herbe Schönheit mit bläulich schimmernden, schwarzen Haaren, belächelte die Machenschaften ihres Mannes. Doch gnädiger Weise ließ sie ihn seine Tinkturen und Salben an ihren Opfern ausprobieren. Denn es kam immer wieder vor, dass sie bei Bestrafungen über die Stränge schlug. Sie duldete nicht den geringsten Widerspruch und ahndete Fehler mit unbotmäßiger Härte.
Für sie waren Dienstboten Ungeziefer oder allenfalls Schlachtvieh ohne Lebensberechtigung. Diese Ansicht ging auf ihre Erziehung zurück. Denn bereits ihre Eltern hatten keine Gnade bei Untergebenen gekannt und waren nicht davor zurückgescheut, diese zu töten.
Der unaufhaltsam in ihr auflodernde Wahnsinn ließ sie sich immer qualvollere Methoden ausdenken. Dazu gehörten das Verbrennen mit glühenden Gegenständen oder die Mädchen in die eiserne Jungfrau zu stellen und langsam die Tür zu schließen. Mitunter zwang sie auch ihre Opfer das eigene, gebratene Fleisch zu essen.
Kein Wunder, dass bei diesen Methoden der Bedarf an Nachschub enorm anstieg, denn viele ihrer Opfer überlebten die Torturen nicht. Die Leichen, die sie anfangs unter den Betten mit ungelöschtem Kalk bedeckt hatte, ließ sie in späteren Zeiten einfach in den Abgrund werfen, wo sie den Wölfen als Fraß dienten.
Die grausame und zweifellos geistesgestörte Frau war sehr eitel und sorgte sich wie die Königin im Märchen Schneewittchen um ihre Schönheit und peinigte sich insgeheim mit der Angst vor dem Alter. Deshalb mussten ihre treueste Dienerinnen täglich nach Mitteln der ewigen Jungend suchen.
Da kam ihr der Zufall zu Hilfe: Eine Zofe stellte sich ungeschickt beim Frisieren an und zog etwas zu kräftig an Luenas Haaren.
»Au, kann sie nicht aufpassen, das Bauerntrampel?« »Verzeiht, Herrin. Es soll nicht wieder vorkommen.«
»Ich werde sie lehren …«
Außer sich vor Zorn schlug die Gräfin der Zofe ins Gesicht. Das Mädchen begann sogleich heftig aus Mund und Nase zu bluten. Dabei wurde auch die Hand der Gräfin mit Blut benetzt. Mit vor Ekel verzerrtem Gesicht langte die Gräfin nach einem Tuch. Beim Abwischen des Blutes erschien ihr die Haut glatter und frischer, um nicht zu sagen: jugendlicher. Ihre treueste Dienerin und Kammerfrau Harild bestätigte sofort den unglaublichen Effekt. Fortan glaubte die Gräfin, das Wundermittel der ewigen Jugend und Schönheit gefunden zu haben: Menschenblut! Doch es musste rein sein, wie man es nur bei Jungfrauen fand.
Dakaria Udoi war bereits seit drei Tagen wieder bei ihrer Familie. Ihr Vater Razvan strafte sie mit Nichtachtung, und die Mutter Mioara reagierte hilflos. Dakaria stellte keine Ansprüche und nahm keinerlei Nahrung zu sich. Dass sie nachts auch nicht schlief, bekam keiner in der Familie mit.
Während Razvan tagsüber die Schafe hütete und Petre sich um die Ziegen kümmerte, half Dakaria ihrer Mutter beim Hausputz oder machte sich anderweitig nützlich. Nur das Haus durfte sie nicht verlassen, damit sie von den Dorfbewohnern nicht gesehen wurde. Abends las sie ihren Geschwistern, Lacrima, Sinka und Traian Geschichten aus einem alten, zerfledderten Buch vor oder erzählte aus dem Stegreif typisch rumänische Legenden.
»Habe ich euch schon die Geschichte über das Märzchen/mărţişor erzählt?«, fragte sie zum Beispiel.
»Ja, bestimmt schon zehnmal«, maulte Traian.
»Das macht nichts. Wir hören sie gerne zum elften Mal«, sagte Sinka, »nicht wahr, Lacrima?«
Die Kleinste nickte heftig.
»Also, es begab sich vor langer Zeit, dass die Sonne als junges Fräulein auf die Erde herabstieg«, begann Dakaria, »sie hatte nicht vor, lange hierzubleiben, doch ein furchtbarer Drache nahm sie gefangen, um sie in seiner Burg einzuschließen.«
»War das unsere hier auf dem Berg?«, fragte Lacrima.
»Nein, ich glaube nicht«, lächelte Dakaria.
»Gott, bist du dumm! Wie kann man so einen Quatsch nur für bare Münze nehmen?«, beschwerte sich Traian, »die Sonne ist viel zu groß, um in eine Burg eingesperrt zu werden.«
»Sei still! Du musst ja nicht zuhören. Wir wollen wissen, wie es weitergeht«, sagte Sinka.
»Ja, du hörst doch, die Sonne hat die Gestalt eines Mädchens angenommen«, fügte Lacrima hinzu.
»Wie soll denn das gehen?«, gab Traian nicht auf.
»Sei nicht so streng mit deinen Schwestern«, rief ihn Dakaria zur Ordnung, »in Märchen und Sagen ist alles möglich. Da verwandeln sich Menschen in Tiere und umgekehrt. Also, es wurde auf der ganzen Welt stock-finster. Alle Menschen waren traurig, und die Kinder wollten nicht mehr spielen. Ein besonders mutiger, junger Mann, der sich in das strahlende Fräulein verliebt hatte, kämpfte mit dem Drachen und bezwang ihn. Indem er das Mädchen befreite, konnte die Sonne wieder in den Himmel aufsteigen. Doch der Kampf hatte ihm schwere Wunden beigefügt, sodass er vor der Drachenburg im Sterben lag. Sein Blut färbte den Schnee rot.
An dieser Stelle sprossen später die Boten des Frühlings – die Schneeglöckchen. Zur Erinnerung an den Helden binden die Menschen jeden Frühling die Schneeglöckchen mit einer roten Schnur zusammen, als Symbol der Tapferkeit und des Frühlingsbeginns. Seitdem verschenkt man am 1. März die Märzchen, und Mädchen und Frauen tragen sie stolz als Glücksbringer an ihrer Brust.«
Die kleine Lacrima klatschte begeistert in ihre Patschhändchen. »Ja, ich will im Frühling auch Märzchen pflücken!«
»Bevor Dakaria noch weiteren Unsinn erzählt, gehe ich lieber schlafen«, sagte Traian, »Tata und die Schafe haben mich heute ganz schön herumgejagt, uah …«
»Aber du erzählst uns noch eine Geschichte«, bettelte Sinka.
»Also gut. Ihr kennt doch den kleinen Wald am Ende des Dorfes. Dort steht eine über hundert Jahre alte Buche, deren Blätter niemals abfallen. Sie ändern nur ihre Farbe und trocknen aus, bis die neuen nachwachsen. In dem hohlen Baum soll es eine Quelle geben, deren Wasser die Menschen früher getrunken haben, denn es heilte viele Krankheiten. Deshalb nennt man sie auch „Die verzauberte Buche“.«
»Hör sofort auf, den Kindern mit deinem Hexenkram den Kopf zu verkleistern!«, rief Razvan böse von seiner Lagerstatt aus, »und ihr macht, dass ihr in die Betten kommt! Sonst versohle ich euch den Hintern. Und lasst euch nicht erwischen, in den verfluchten Wald zu gehen. Dort sind schon mehr als ein Kind verschwunden.«
Die Geschwister folgten brav und zogen sich die Decke über den Kopf. Dakaria ging zu ihrer Mutter in die Küche.
»Leg dich doch auch hin, Mädchen«, sagte Mioara, »du warst heute sehr fleißig und musst doch müde sein.«
»Ach, Mama, ich brauche kaum Schlaf.«
»Sag mal, stimmt es, was dein Vater sagt, du seiest nachts an den Fluss gegangen, um bis Mitternacht auf den Teufel zu warten?«
»Mama, um dem Teufel zu begegnen, muss man nicht nachts zum Fluss gehen. Es reicht, ihn an einer Wegkreuzung laut zu rufen. Er freut sich nämlich, in die Geheimnisse der Hexerei eingeweiht zu werden. Man kann sich auch an einem unreinen Ort aufhalten, wenn man Höllenhilfe erhalten will.«
»Kind, du machst mir Angst. Das hast du doch hoffentlich nicht getan?«
»Nein, und ich habe auch nicht bei Vollmond mit ihm getanzt. Ich sage doch, ich bin eine weiße Hexe und beschäftige mich nicht mit schwarzer Magie. Aber ich halte mich an das Sprichwort: „Sprich nicht schlecht über den Teufel, denn du weißt nicht, wem du später gehören wirst“.«
»Ich bin jedenfalls froh, dass du dem Rat deines Bruders folgen und auf der Burg arbeiten willst. Es wird Zeit, dass du dem Dorf mit seinem Aberglauben den Rücken kehrst.«
»In Capatineni und Cheiani ist es nicht anders als in anderen Dörfern. Und was mich dort oben erwartet, daran wage ich nicht zu denken. Wenn es stimmt, was man über die Gräfin erzählt … Doch ich werde mich zu wehren wissen. Mit mir wird sie kein so leichtes Spiel wie bei den anderen haben.«
»Mach dich nicht unglücklich, Kind. Mit den hohen Herrschaften ist nicht zu spaßen. Sie haben die Macht und viele ihnen treu ergebene Helfer. Für die sind wir Schlachtvieh und nicht mehr.«
»Mach dir keine Sorgen, Mama. Was kann mir schon passieren? Schließlich bin ich doch schon tot, wie tata meint.«
»Du darfst das deinem Papa nicht übel nehmen. Er ist von der Situation überfordert und sorgt sich um seine Familie. Und du musst zugeben, dass deine Wiederkehr mehr als seltsam ist.«
»Man kann sich sein Schicksal eben nicht aussuchen, Mama. Ihr so wenig wie ich. Und jetzt gönn dir etwas Ruhe! Damit du Kraft für morgen sammelst.«
Drei Tage später war es dann so weit. Zwei Diener und eine Dienerin begleitet von Wachen gingen von Haus zu Haus und verlangten, die halbwüchsigen, jungfräulichen Töchter zu sehen. Es ging dann weniger darum, ob die Eltern bereit waren, ihre Kinder freiwillig herauszugeben, sondern ob die Mädchen geeignet schienen und vom Aussehen her nicht die Augen der Gräfin beleidigten. Dementsprechend gab es viele heiße Tränen und herzzerreißende Abschiedsszenen.
Dakaria wurde aufgrund ihres ansprechenden Äußeren sofort herangewunken. Mioara umarmte ihre Tochter ein letztes Mal und sprach ihr Mut zu. Lacrima und Sinka weinten bitterlich, und selbst Traian kämpfte mit den Tränen, als wüsste er, dass er die große Schwester niemals wiedersehen würde. Petre klopfte ihr aufmunternd auf die Schulter.
»Du machst das schon! Und falls es dir zu bunt wird, gib Bescheid! Dann werde ich alles daran setzen, dich da rauszuholen.«
»Danke, aber überschätz deine Mittel nicht.«
Auf dem Dorfplatz hatten sich schon mehrere Mädchen versammelt, die streng bewacht wurden. Sie wurden auf einen Karren verfrachtet, der noch die Dörfer Poienari und Cheiani anfuhr. Bald saßen die Mädchen dicht gedrängt, sodass keine Maus mehr zwischen ihnen Platz gefunden hätte. Viele drückten ihr Bündel mit einfacher Kleidung und etwas Proviant von Mama an sich.
Dakaria kannte die eine oder andere aus Capatineni vom Sehen. Nur mit Mitica, ebenfalls einer Schäferstochter, war sie näher bekannt, denn sie spürte, dass beide etwas miteinander verband. Das überaus hübsche Mädchen stach unter allen anderen hervor. So war es kein Wunder, dass Mitica später auf dem Burginnenhof von Harild, der ältesten und treuesten Dienerin der Gräfin, ausgesucht wurde. Zwei weitere wurden ebenfalls auserkoren, Dakaria war nicht darunter. Harild hatte sie mehrmals prüfend gemustert, dann aber das Gesicht verzogen, als habe sie etwas Schlechtes gerochen, und sich abgewandt.
Die anderen wurden für die Küche, die Wäscherei oder zum Putzen eingeteilt. Am Abend trafen sich alle in der Küche zum Essen wieder und stellten danach fest, dass die meisten gemeinsam dieselbe Unterkunft erhalten hatten. Ein karger, kalter Raum mit einfachen Betten, in dem es furchtbar zog. Die Matratzen bestanden aus einfachen Strohsäcken wie auch das Kopfkissen. Als Zudecke dienten grobwollene Decken, die schrecklich kratzten.
Die wenigen Kerzen waren längst gelöscht worden, als einige Mädchen noch Gesprächsbedarf verspürten.
»Dagegen schlafe ich ja zu Hause beinahe luxuriös«, sagte Valea, eine rotgesichtige Vierzehnjährige mit verfilzten, blonden Haaren.
»Hast du gedacht, du schläfst am Fußende der Gräfin oder beim Grafen auf dem Schoß?«, fragte Aurelia, die ihre ebenholzfarbenen Haare in dicken Zöpfen trug.
»Sicher nicht, du dumme Kuh. Aber dazwischen gibt es wohl noch etwas anderes.«
»Kinder, zankt euch nicht«, meinte die blasse und sehr dünne Sharai, »es kommen harte Zeiten auf uns zu. Die überstehen wir nur, wenn wir zusammenhalten.«
»Ein Glück, dass ich noch Wurst und Käse dabei habe«, sagte die etwas rundliche Ionela kauend, »von der Wassersuppe heute Abend konnte man ja kaum satt werden.«
»Kinder, hier ist es ja arschkalt«, gab Anyana ihren Kommentar ab, »wenn ich nicht meine dicken Wollsocken dabei hätte, würde ich mir glatt Frostbeulen holen.«
»Scht, ich glaube, da kommt einer.«
Später, als alle schliefen, erhob sich Dakaria, warf ihr Tuch aus dicker Wolle über, zog sich ebensolche Socken an und schlich lautlos durch die Gänge ihrer neuen Heimat. Dabei achtete sie peinlich darauf, von keiner der Wachen entdeckt zu werden. Schließlich hatte sie sich total verlaufen und landete in der Nähe der Gemächer der Fürstin. Als sie einen Schatten sah, der vom Licht der Fackeln auf die Wände geworfen wurde, erschrak sie zunächst, atmete aber erleichtert auf, als sie Mitica erkannte.
»Du bist es! Kannst du auch keinen Schlaf finden?«
»Nein, ich schlafe schon länger nicht mehr.«
»Dann bist du wie ich. Das habe ich gleich gespürt.«
»Was meinst du damit?«
»Na, du bist auch ein Wiedergänger. Wann hat man dich begraben?«
»Vor zwei Monaten. Sechs Wochen später bin ich zu meiner Familie zurückgekehrt.«
»Und wie hat man dich aufgenommen?«
»Mit großer Liebe und Herzlichkeit. Nur tata war ich wohl etwas unheimlich.«
»Wie bei mir. Er wollte mich zuerst gar nicht reinlassen. Dann wollte er mich wieder wegschicken. Er hat Angst, dass ich ihn und die Familie verhexe.«
»Das hat man mir nicht unterstellt«, sagte Mitica, »obwohl sie allen Grund dazu gehabt hätten, aber ich bin freiwillig gegangen. Irgendwie passe ich nicht mehr zu ihnen.«
»Glaubst du, dass es hier noch mehr von uns gibt?«
»Bestimmt. Bei zwei oder drei habe ich es in den Augen gesehen.«
»Dann müssen die in einem anderen Raum schlafen. In meinem war nur ich wach. Apropos schlafen. Ich hoffe, ihr wohnt besser als wir. Immerhin gehört ihr jetzt zum Umkreis der Gräfin.«
»Darauf hätte ich gerne verzichtet. Uns hat man einen Nebenraum zugewiesen, damit wir jederzeit für die Gräfin erreichbar sind. Da gibt es weiche, aber ziemlich muffige Betten. Zuerst mussten wir baden, und dann hat man unsere Kleider ins Feuer geworfen und uns neue gegeben. Was heißt neue? Ich möchte nicht wissen, wer die schon alles vor uns getragen hat. Und vom Schnitt her mehr als einfach. Wahrscheinlich sollen wir der Gräfin und ihrem Gefolge nicht den Rang ablaufen.«
»Und, wie ist sie so?«
»Viel schöner als ich dachte. Aber wenn du mich fragst: Aus ihren Augen leuchtet der Wahnsinn. Und diese Harild würde für sie töten. Wie mancher Diener wohl auch. Die Zofen tun mir leid. Sie dürfen sich keinen Fehler erlauben, sonst hagelt es Schläge und schlimmste Grausamkeiten. Die Gräfin beißt sogar zu und reißt ganze Hautfetzen von ihren Opfern.«
»Das sind ja keine guten Aussichten für dich.«
»Bis jetzt darf ich ihr noch nicht zunahe kommen. Wenn es so weit ist, werde ich sie mit Magie in Schach halten.«
»Dann bist du also auch eine Hexe?«
»Ja, und zwar so schwarz wie die Nacht.«
»Ich würde mich eher als eine weiße bezeichnen. Wie ist es dir gelungen, dass diese Harild dich ausgesucht hat?«
»Das fragst du noch? Bei meiner Schönheit? Nein, Quatsch. Ich habe da so meine Methoden.«
»Bei mir hat sie sofort gemerkt, dass ich ein Wiedergänger bin. Sie tat, als stinke ich nach faulen Eiern.«
»Tust du nicht?« Mitica lachte, als sie Dakarias entsetztes Gesicht sah. »Ich mache nur Spaß. Bei mir hat sie nichts gemerkt, weil ich einen Schutzzauber trug. Für sie duftete ich nach Rosen, statt nach Schwefel.«
»Ach so, und warum wolltest du unbedingt in die Nähe der Gräfin?«
»Damit ich ihr endlich das Handwerk legen kann beziehungsweise neue Schandtaten verhüten. Aber ich muss jetzt zurück, damit keiner was merkt. Wir sehen uns. Und pass auf dich auf!«