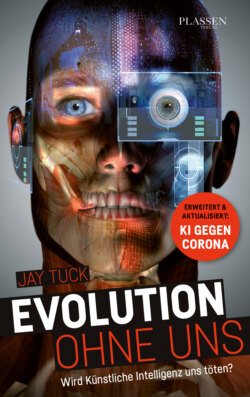Читать книгу Evolution ohne uns - Jay Tuck - Страница 50
ОглавлениеPlaystation-Piloten
Der deutsche Oberleutnant hat recht.
Drohnen sind die Zukunft.
Aber womöglich ohne Fernbedienung.
Womöglich gänzlich ohne Menschen.
Größtenteils können sie das jetzt schon – Anflug und Angriff, Rückkehr und Landung. Für viele in der Rüstungsindustrie ist heute schon klar, dass die Drohnen der Zukunft völlig autark fliegen werden. Aber daran müssen sich die Militärs erst gewöhnen.
Schon der Wechsel von herkömmlichen Kampfjets zu ferngesteuerten Flugrobotern ging bei der US-Luftwaffe nicht konfliktfrei ab. Altgediente Generäle meinten, man brauche noch die Reichweite, Schnelligkeit und Tragkraft konventioneller Kampfjets und Fernbomber.
Widerstand gab es auch bei den Kampfjet-Jocks. Piloten aus der „Kick-the-Tire/Light-the-Fire“-Generation sahen ihren Status als Top-Gun-Stars gefährdet. Und waren sauer, dass Computer-Kids in den Containern die begehrten Wings auf ihre Luftwaffen-Uniform pinnen durften. Wings waren früher die Auszeichnung für Piloten, die ihr Leben im tiefen Blau des hohen Himmels riskierten.
Aber der Einsatz von Kampfdrohnen hat sich als mehr als sinnvoll erwiesen. In der asymmetrischen Kriegsführung, wo Supermacht-Soldat gegen Wüstenkämpfer antritt, kann die Kampfdrohne gezielt und ohne Lebengefahr für Piloten eingesetzt werden.
Eine Zeit lang hofften altgediente Militärplaner, dass der Drohnenkrieg eine Trenderscheinung sei. „Die Drohnen-Flotte, die ich aufgebaut habe und weiterhin aufbauen soll“, meinte vor einigen Jahren General Mike Hostage vom Global Strike Command, „ist nicht relevant in der heutigen Zeit. Das menschliche Gehirn ist noch der beste Computer, den ich kenne, die menschlichen Augen die besten Sensoren.“31
Veraltetes Denken.
Computer und Sensorik haben sich in rasendem Tempo entwickelt. Mit exponentieller Geschwindigkeit. Den Glauben an die Überlegenheit menschlicher Piloten hat die Technik längst hinter sich gelassem.
Moderne Krieger müssen nicht in den Krieg ziehen. Die Männer, die Killerdrohnen steuern, sind unweit von Las Vegas in den Sandwüsten des US-Westens stationiert. Ihr Arbeitsplatz ist ein unscheinbarer Container mit Wüstentarnung und Spaghetti-Antennen. Standort ist der US-Stützpunkt Creech, gut 12.000 Kilometer von den Schlachtfeldern entfernt, wo die Bomben fallen. Die Drohnen werden gewartet und gestartet von Lokalmannschaften am Einsatzort. Geflogen werden sie von den Männern und Frauen im US-Westen.
An einem typischen Arbeitstag frühstücken die Piloten im Pancake House am Highway 95, töten tagsüber Taliban vom Container aus und helfen ihren Kindern abends bei den Schularbeiten.
Die Piloten, mit denen ich auf dem US-Stützpunkt gesprochen habe, sind stolz auf ihre Tätigkeit. Die Drohnenangriffe in fernen Ländern sehen sie als wichtigen Beitrag zur Sicherheit der USA. Bei Abschüssen bitten sie die Lokalmannschaften, kleine Bomben auf die Tragflächen zu pinseln. Kriegsbemalung.
Wie Kerben an einem Colt.
Von einem PR-Offizier werde ich belehrt, dass der Begriff „Killer-Drohnen“ nicht sachgemäß sei. Dabei ist das erste Wort weniger problematisch. Sie sollen ja killen. Eine „Drohne“, so sagt man mir, ist ein Terminus technicus für ein selbstständig fliegendes Flugzeug. Predator und Reaper der US-Luftwaffe werden aber von einem Piloten gelenkt. Deswegen müssten sie eigentlich Remotely-Piloted-Vehicles oder RPVs („ferngesteuerte Flugzeuge“) genannt werden.
Dabei ist „Drohne“ in vielen Sprachen der Welt ein fester Begriff, auch im deutschen Duden. Er steht sogar auf T-Shirts in den Air-Force-Souvenir-Shops. Die Piloten sind stolz darauf.
Das langweilige Leben der Drohnenpiloten
Mary „Missy“ Cummings ist Professorin am Massachusetts Institute of Technology (MIT) und ehemalige Kampfjetpilotin. Sie wurde vom Pentagon beauftragt, die Arbeitsabläufe von Drohnenpiloten zu untersuchen. Sie sollte die Software vereinfachen und den Stress der jungen Männer und Frauen reduzieren.
Als Cummings die Container der Drohnenpiloten auf dem Stützpunkt Creech betrat, war sie innerlich angespannt. Sie wusste von den langen Arbeitszeiten, von der komplizierten Technik, von der bedrückenden Verantwortung der Piloten.
Sie erwartete Stress.
Und fand Langeweile.
Die Abläufe in den acht- bis zehnstündigen Schichten sind weitgehend automatisiert. Die ferngesteuerten Flugzeuge finden ihren Weg ins Zielgebiet selbstständig, verfolgen automatisch Mensch oder Fahrzeug und können über einem Zielgebiet stundenlang und ohne menschliche Beteiligung kreisen. Adrenalin-Momente sind selten und kurzlebig, dafür intensiv. Wenn eine Zielperson aus dem Schatten tritt, oder ein Geländewagen sich einem alliierten Stützpunkt nähert, müssen in Windeseile Entscheidungen gefällt werden. Unter Hochspannung. Es sind Entscheidungen über Leben und Tod.
„Missy“ Cummings protokollierte den typischen Arbeitstag: in Sesseln lümmeln, an Erdnüssen knabbern, in Comics blättern. Cummings kennt Stressberufe mit Leerlauf, zum Beispiel bei der Feuerwehr. Auch die Piloten von Liniengesellschaften starren nicht ununterbrochen auf Himmel und Horizont. Sie entspannen sich, lassen den Autopiloten arbeiten, verlassen sich auf die Intelligenz ihrer Bordelektronik.
„Solche Situationen erleben wir häufig, wenn Menschen als Babysitter für voll automatisierte Systeme eingesetzt werden“, sagt sie.32
Die lernfähige Software wird immer schlauer, die Arbeitsbelastung von Menschen immer geringer, ihre Verantwortung auch. Künstliche Intelligenz fliegt die Drohne, beobachtet die Landschaft, hält Ausschau nach verdächtigen Bewegungen. Bei Bedarf lässt sie ein Warnsignal ertönen und Menschen einschalten.
Immer mehr Aufgaben werden von der Automatik übernommen. Die Piloten werden mit immer mehr Leerlauf klarkommen müssen. Nach Berechnungen der US-Luftwaffe ist der typische Drohnenpilot heute schon in 95 Prozent seiner Arbeitszeit untätig. In dieser Zeit ist Künstliche Intelligenz am Steuer. Die Schere wird sich weiter öffnen.
Und die nächste Generation von Drohnen ist bereits in der Luft. Bei ihnen wird kein PR-Offizier auf dem Begriff RPV bestehen. Sie werden nicht ferngesteuert. Sie fliegen allein, ohne menschliche Piloten.
Künstliche Intelligenz trifft die Flugentscheidungen.
Ungesehen, unbemerkt, unbeachtet
Eine solche Drohne ist die geheimnisumwitterte X-47b Pegasus. Der Deltaflügler hat das Aussehen eines UFOs, die Geschwindigkeit eines Passagierjets und die Reichweite eines Fernbombers. Im Gegensatz zu bisherigen Drohnen kann die X-47b schwere Waffen tragen. Ihre Waffenlast wird auf über 2.000 Kilo beziffert.
Die US-Navy hat sie entwickelt. Sie soll ein Hauptproblem ferngesteuerter Drohnen umschiffen: die mühsame Suche nach einem Landeplatz in fremden Ländern. Man braucht eine freundliche Regierung, einen geheimen Standort und die Nähe zum Kampfgeschehen – keine leichten Kriterien. Darum muss sich Pegasus nicht kümmern. Sie hat ihren eigenen Landeplatz immer dabei.
Sie startet vom Flugzeugträger.
Die neue Killerdrohne operiert praktisch ohne Menschen. Gesteuert von Künstlicher Intelligenz fliegt Pegasus ganze Operationen völlig frei von menschlicher Intervention. Bei jedem Flug lernt sie dazu. Sogar die trickreiche Landung auf einem fahrenden Flugzeugträger meistert sie fehlerfrei.
Außerdem ist sie unsichtbar.
Unsichtbar?