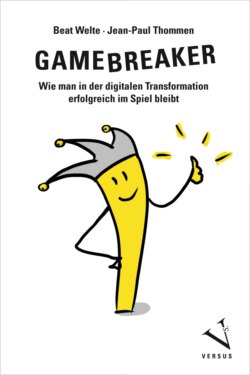Читать книгу Gamebreaker - Jean-Paul Thommen - Страница 7
Оглавление2 Der verlorene Kunde
Die Karriere des größten Gamebreakers, den die Schweiz wahrscheinlich je hervorgebracht hat, beginnt mit zwei Pleiten: 1923 wurde der Kolonialwarenhändler Sigg & Duttweiler liquidiert. Der eine der beiden Inhaber wanderte in der Folge nach Brasilien aus. Dieser setzte kurz darauf – nach einem weiteren Misserfolg, aber mit neuer Perspektive auf den Handel bereichert – zu einem beispiellosen Gamebreaking an. Seine «spielbrechende» Idee: Den Zwischenhandel eliminieren und eine Verkaufsorganisation aufbauen, die direkt vom Produzenten zum Konsumenten führt. Am 15. August 1925 gründete Gottlieb Duttweiler zu diesem Zweck die Migros. Die «Brücke» wurde dabei zum Symbol für diesen Brückenschlag (vom Produzenten zum Konsumenten) und zum Markenzeichen der Migros.
Damit machte Duttweiler etwas, was auch heutiges «modernes» Gamebreaking auszeichnet: Er eliminierte eine ganze Stufe in der Wertschöpfungskette und sah sich damit in die Lage versetzt, seinen Kunden die Produkte wesentlich günstiger anzubieten als die Konkurrenz. Nichts anderes, aber noch etwas radikaler, macht das heute der Online-Händler Zalando, der den traditionellen Detailhandel in Angst und Schrecken versetzt und stark wächst. Das ist echtes, auf den Kunden und den Kundennutzen ausgerichtetes Gamebreaking: Denn kein Kunde hat ein Interesse daran, mehrere unnötige Stufen in einer Wertschöpfungskette zu füttern, die das Endprodukt verteuern. Wem das offensichtlich und banal erscheint, der sei daran erinnert, dass auch heute noch sehr erfolgreiche Geschäftsmodelle auf der Basis aufgeblähter und ziemlich nutzloser Wertschöpfungsketten basieren: 2012 starb einer der reichsten Schweizer, Walter Haefner, der einen Großteil seines Vermögens mit dem exklusiven Generalimport von Autos über die Firma Amag erzielt hat. Es ist also auch heute noch durchaus möglich, mit Zwischenhandel reich zu werden – bis früher oder später – wahrscheinlich eher früher! – auch hier irgendwann ein Gamebreaker kommt und den Schweizern billige Autos bringt. Erste Ansätze mit Direktimporteuren sind immerhin schon erkennbar.
Indes war Duttweiler noch in anderer Hinsicht ein Gamebreaker, der auch heute viele Nachahmer findet: Kunden wollen nämlich nicht nur kostengünstige Produkte, sie wollen diese Produkte auch bequem und mit möglichst kleinem Aufwand und Zeitverlust erwerben. Und auch hier erwies sich der Migros-Gründer als höchst einfallsreich. Wenn der Berg nicht zum Prophet kommt, dann muss der Prophet eben zum Berg gehen, mag sich Duttweiler gesagt haben: Mit einem Startkapital von 100 000 Franken erwarb er fünf Ford-T-Lastwagen und bestückte diese mit sechs Basisartikeln (Kaffee, Reis, Zucker, Teigwaren, Kokosfett und Seife), die er zum Teil bis zu 40% günstiger als die Konkurrenz anbot – und dies direkt vor der Haustür. Auch dieser «spielbrechenden» Idee von Duttweiler wird heute in vielfachen Varianten nachgelebt: Die Pizza muss nicht mehr in der Pizzeria erworben werden, sondern wird ins Haus geliefert. Oder noch ein bisschen futuristischer, aber bereits Realität: Mit dem Tintenlieferservice von HP bekommt der Kunde die Tinte automatisch zugeschickt: Der Drucker erkennt den «Notstand» und löst automatisch eine Bestellung bei HP für neue Tinte aus.
Duttweiler war zeitlebens eine Figur, die stark über das schweizerische Mittelmaß herausragte und stark polarisierend wirkte. Neben der Migros gründete er auch seine eigene Zeitung sowie eine politische Partei und scheute sich auch in späteren Jahren nicht, seine Meinung sehr «handgreiflich» kundzutun: Weit über die Landesgrenzen hinaus sorgte ein Steinwurf von Duttweiler 1948 für großes Aufsehen: Der bekannte Unternehmer und Parlamentarier Duttweiler warf eine Fensterscheibe im Bundeshaus zu Bern ein aus Protest, dass sein Vorstoß zur wirtschaftlichen Landesverteidigung verschleppt wurde.
Gamebreaker, so lernen wir, sind häufig kontroverse, polarisierende, «unbequeme» Zeitgenossen. Unternehmen müssen das aushalten können, wollen sie den Nutzen aus Gamebreaking abschöpfen können. Das fällt nicht immer leicht: Noch heute findet man ältere Menschen, die niemals einen Migros-Laden betreten würden, weil ihnen die Migros mit ihren «radikalen» Ideen immer noch suspekt erscheint. Umso erstaunlicher ist es, dass die Migros zum größten und erfolgreichsten Detailhändler aufsteigen konnte, und dies, obwohl Duttweiler neben seiner polarisierenden Gamebreaker-Persönlichkeit noch einen anderen Wettbewerbsnachteil hatte: Er bot aus Überzeugung keinen Alkohol und Tabak an.
Die radikale Kundenorientierung von Duttweiler steht in scharfem Kontrast zur Art und Weise, wie die heutigen Unternehmen operieren. Wie wir im vorherigen Kapitel gelernt haben, sind prozessorientierte Großunternehmen heute vor allem mit sich selbst beschäftigt, und radikale neue Ansätze wie derjenige von Duttweiler bleiben aus. Das mit sich selbst beschäftigte System wird aber dysfunktional, weil es seinen eigentlichen Existenzzweck völlig aus den Augen verliert: dem Kunden einen möglichst großen Mehrwert zu liefern.
Das hat jeder von uns schon in der einen oder anderen Form erlebt. Nämlich dann, wenn er ein Problem mit einem Produkt oder einer Dienstleistung eines großen Unternehmens hat. Kontaktiert man das Unternehmen, landet man unweigerlich in einem «Servicecenter», das im besten Fall im eigenen Land, wahrscheinlich aber weit weg und in nicht seltenen Fällen in Indien oder Nordafrika angesiedelt ist. Aus Sicht der Unternehmensorganisation liegen solche «Servicecenter» (und damit der Kunde mit seinem Problem) an der «Peripherie» des Unternehmens, und dessen Mitarbeitende stehen oft schlecht bezahlt an der untersten Stelle in der Hierarchie. Sie sind mit keinerlei Kompetenzen, dafür mit einem Fragebogen ausgestattet, der die dreißig häufigsten Probleme abdeckt. Schlechte Telefonleitungen und mangelnde Sprachkenntnisse des Gegenübers erschweren es oft, sein Anliegen überhaupt anzubringen. Immerhin: Liegt man innerhalb der dreißig vom Prozess vorgesehenen «Standardanliegen», hat man zumindest eine Chance auf eine zufriedenstellende Antwort bzw. Lösung seines Problems. Liegt man aber außerhalb, dann nimmt das Unternehmen meistens in Kauf, dass der Kunde mit seinem ungelösten Anliegen unzufrieden zurückbleibt. Denn solche Großunternehmen bieten den Kunden niemals das Beste, sondern nur so viel wie nötig. Ganz im Sinne des Löwenbeispiels im ersten Kapitel: Ich muss nicht schneller als der Löwe sein, sondern nur schneller als der andere im Wettrennen.
In solchen Unternehmen geht der Kunde buchstäblich verloren – und er fühlt sich auch verloren: nämlich im undurchdringlichen organisatorischen Gewirr eines Unternehmens, das schlicht nicht dafür gemacht ist, ihm zu helfen. Statt dem Kunden zu helfen, schiebt das Unternehmen das Problem häufig zurück im Sinne von: selbst schuld.
Unternehmen lassen unzufriedene Kunden als Kollateralschaden zurück und vergeben genau dort ihre größte Chance: Denn wo Kunden unzufrieden sind, besteht das größte Potenzial, sich selbst in Frage zu stellen, etwas anders zu machen und das Kundenbedürfnis wirklich zu erfassen und zu erfüllen. Aber genau dies geschieht nicht, denn kein zentralistisch geführtes und prozessorientiertes Großunternehmen ist so aufgestellt, dass es sich von der Peripherie her und mit dem Input von hierarchisch tiefgestellten Mitarbeitenden neu erfinden könnte. Es ist deshalb nicht überraschend, dass sie disruptiert werden von Unternehmen, die den Fokus genau darauf legen: Wie kann ich einem Kunden mit möglichst geringem Aufwand einen möglichst großen Mehrwert erbringen und zwar genau dort, wo seine größte Unzufriedenheit ist. Wegen dieser Unzufriedenheit werden die Angriffsflächen der Großunternehmen immer größer. Und damit bieten sich für die Herausforderer vielfältige Chancen für ein erfolgreiches Gamebreaking.
| Aus der Praxis | Lidl – Gamebreaking mit Chatbots |
Das Disruptionspotenzial ist immer dort am höchsten, wo der Kundenschmerz am größten ist. Dies ist meistens an der Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kunden der Fall. Denn die meisten Unternehmen sind organisatorisch kozentrisch aufgebaut: Im Zentrum steht nicht etwa der Kunde, sondern die Geschäftsleitung, und darum herum gruppieren sich Geschäftseinheiten und Funktionen, in abnehmender Bedeutung gegen außen. An der «Peripherie» vollzieht sich der Kundenkontakt. Je weiter weg vom Zentrum, desto tiefer im Allgemeinen die Bezahlung, die Entscheidungskompetenz und – oft bedingt durch häufige Wechsel – auch das Wissen.
Diese Situation wird sich in den nächsten Jahren dramatisch ändern mit Chatbots, textbasierten «intelligenten» Dialogsystemen: Nach vielen holprigen Versuchen – etwa der 2016 stillgelegte Chatbot Anna von Ikea – werden sich die digitalen Helfer in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich durchsetzen. Mussten frühere Chatbots mühsam und mit viel menschlichem Aufwand trainiert werden, lernen heutige Chatbots dank Künstlicher Intelligenz beziehungsweise Machine Learning selbständig dazu – sie werden mit jeder Kundenanfrage «gescheiter».
Hinzu kommen enorme Fortschritte in den Natural-Language-Processing-Fähigkeiten (maschinelle Verarbeitung natürlicher Sprache) und Sentiment Analytics (Stimmungserkennung): Kombiniert mit einem Avatar (einer virtuellen Figur) werden Chatbots bald in der Lage sein, sich mit Menschen natürlich zu unterhalten, sich dabei situationsbeziehungsweise stimmungsgerecht zu verhalten und dank unbeschränktem Zugang zu relevanten Wissensdatenbanken zu (fast) allem Auskunft zu geben – und das rund um die Uhr, ohne Urlaub oder krankheitsbedingte Ausfälle und «brain drain» (Wissensschwund) bei Kündigungen.
Die allerbesten Chatbots in den Labors sollen bereits heute so gut sein, dass es schwer ist, sie im Dialog von menschlichen Wesen zu unterscheiden. Ein durchschnittlicher Chatbot hingegen versteht heute erst etwa 60 bis 70 Prozent der gesprochenen Sprache. Verbreitet sind deshalb vor allem Chatbots auf der Basis von Text.
Lidl setzt – aufbauend auf Facebook Messenger – die Chatbot «Margot» ein, die den Konsumenten in England zum richtigen Wein verhilft. Auf die Frage «Welche Burgunder können Sie mir empfehlen?» folgt prompt die Antwort der «persönlichen Favoriten» mit einem Mâcon Villages für 6.99 Pfund an der Spitze. Eine Spielerei? Vielleicht. Aber gemäß einer Studie des Forschungsunternehmens Spiceworks sind 2018 rund 40% der Großunternehmen dabei, solche Chatbots aufzuschalten. Denn wer obenauf schwingt, wird seinen Kunden einen so hervorragenden Service bieten können, der mit «normalen» Mitteln kaum finanzierbar wäre. Und wer früh beginnt, hat gute Chance, zum Gamebreaker in seiner Branche zu werden.
Lessons learned
■ Gamebreaking ist nicht neu, sondern war schon zu Duttweilers Zeiten gefragt. Durch die stark erhöhte Veränderungsgeschwindigkeit und tiefgreifenden Veränderungen ist die Notwendigkeit für Gamebreaking indes stark gestiegen.
■ Echte Gamebreaker können ihre Idee wie Duttweiler in einen Satz fassen: «Ich senke die Preise durch Ausschalten des Zwischenhandels und bringe die Produkte vor die Haustüre des Kunden.»
■ Gamebreaker erfinden neue Geschäftsmodelle, indem sie oft unnötige Stufen in der Wertschöpfungskette ausradieren (Zwischenhandel) und dem Kunden auf diese Weise einen Mehrwert bringen.
■ Gamebreaker stellen die Dinge auf den Kopf und lösen sich von Dingen, die «schon immer so gemacht wurden»: Nicht der Kunde geht in das Geschäft zu den Produkten, sondern die Produkte kommen zum Kunden.
■ Gamebreaker im Sinne von Disruptoren sind oft stark polarisierende, politisch nicht immer korrekte Menschen: Ein Fenster im Bundeshaus einzuwerfen ist eigentlich ein No-Go – das sollte aber nicht von der Leistung des Gamebreakers ablenken.
■ Dort, wo der größte Kundenschmerz ist, befindet sich die Stelle mit dem größten Disruptionspotenzial.