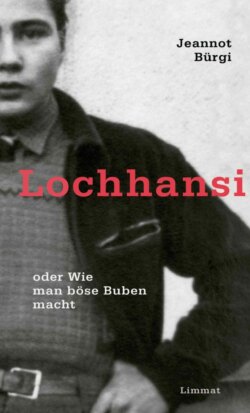Читать книгу Lochhansi oder Wie man böse Buben macht - Jeannot Bürgi - Страница 8
ОглавлениеAls Hans, mein Vater, nach der Rekrutenschule und der Grenzbesetzung, die er im Jura und im Tessin verbrachte, wieder nach Hause zurückkehrte, hatte sich nicht nur im Loch die Welt verändert. Im ganzen Land herrschte Krisenstimmung, eine heftige Grippewelle erschütterte die Schweiz, soziale Spannungen führten im Herbst 1918 zum Generalstreik.
Kaum zu Hause, wurde er wieder zum Dienst aufgeboten, diesmal ging es zwar nicht an die Grenze, sondern zum Ordnungsdienst nach Zürich, wo streikende Arbeiter ihre Rechte einforderten. Die Preise für Grundnahrungsmittel waren stark angestiegen, die Angst um die Existenz führte in der politisierten Arbeiterschaft zu Unsicherheit und Unmut. Die Spitäler waren von Grippekranken überfüllt, die Krankheit zog mit den demobilisierten Soldaten nach Hause, in die Städte und Dörfer. In den Familien der Heimgekehrten hielten Leid und Trauer Einkehr, so erlagen im Loch zwei Brüder meines Vaters im blühenden Alter der Spanischen Grippe. Doch trotz Verlust und Trauer raufte man sich zusammen, versuchte die Not zu lindern, wo sie am grössten war. Die alte Zeit war mit dem Ende des Weltkriegs vorüber und vorbei, nun begannen die Zwanzigerjahre, ein Aufbruch und Neubeginn.
Die Loch-Kinder waren gewachsen und langsam gross geworden, wie es das Schicksal so will, hatten einige überlebt, andere halt nicht, in der Dorfschule in Bürglen hatten sie notdürftig lesen, schreiben und ein wenig rechnen gelernt. Einige besser, andere kaum. Sodass zum Beispiel der Benz in der Rekrutenschule kaum fähig war, seinen Namen zu schreiben, geschweige denn einen Satz fehlerfrei aufs Papier zu bringen. Dass dann gerade diesem Benz später mit seinen Geschäften der grösste Erfolg von allen zufiel und er es als Einziger in der Familie zu Reichtum und behäbigem Wohlstand brachte, war sicher nicht seiner Schulbildung zuzuschreiben.
Vater hatte seine Lehrzeit als Zimmermann bei seinem Onkel Fanger in Wilen abgeschlossen. Inzwischen war auch Tante Karolin gestorben, waren die beiden Schwestern Sabina und Rosa auswärts verheiratet. Mit vereinten Kräften bauten nun die Brüder die obere Scheune, die das «doppelte Fineli» in ihrem Wahnsinn abgebrannt hatte, wieder auf, schöner, grösser und moderner als die alte, mit einem überdeckten Tränkschopf, einer grossen Tenne und einem abgesonderten Strohgaden, wo zur Not auch mal ein Taglöhner oder Landarbeiter hausen konnte. Natürlich hätte der älteste der Locherbuben, mein Vater Hans, nun endlich heiraten sollen, eine allen genehme Braut wäre auch vorhanden gewesen, doch diese Sache kam nicht recht voran.
Anfang der Zwanzigerjahre besuchte mein Vater mit einem Kollegen aus der Militärdienstzeit eine Ausstellung von Autos und Motorrädern in Zürich. Nach Hause kam er dann mit einem nigelnagelneuen schweren Töff, den er sich mit seinem Ersparten gekauft hatte. Nun kam für ihn das Heiraten sowieso nicht mehr in Frage, schliesslich fehlten ihm dazu nun ganz schlicht die Mittel. Seine grosse Liebe galt seiner Harley-Davidson, im Laufe der Jahre sollten dann noch mehrere Lieben folgen, Motorräder auch, eine Triumph, eine Indiana und zuletzt noch eine BSA mit Seitenwagen.
Es sei diese Zeit die schönste in seinem ganzen Leben gewesen, erzählte mir mein Vater oft, als er als flotter Junggeselle mit seinem Motorrad den Blick so mancher Schönen auf sich zog. Er versuchte erst, als selbständiger Handwerker seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Wobei es vorläufig beim Versuch blieb. Wohl gab es ab und zu Reparaturarbeiten, ein neues Vordach oder den Dachstock einer alten Scheune, vielleicht mal eine Alphütte in unwegsamem Gebiet, es waren dies meistens Arbeiten, die kein anderer machen wollte. Die wirklich guten Aufträge, grosse Aufträge, die auch lohnend gewesen wären, konnte er nicht annehmen. Dazu fehlte ihm die nötige Infrastuktur, er hätte dann auch Mitarbeiter annehmen müssen, Gerätschaft und Maschinen anschaffen müssen, auch eine grosse Werkstatt hätte er gebraucht und ein Lager für das Holz. So verdingte er sich als Zimmermann bei der Holzbau AG, arbeitete hauptsächlich im «Aussendienst» in Zürich zusammen mit zwei Kollegen, dem Sagihans und dem Stafelhans, beide ebenfalls Zimmerleute aus Lungern, die er schon aus seiner Lehrlings- und Militärdienstzeit her kannte.
Es muss dies eine lustige Gesellschaft gewesen sein, diese drei Hansen aus der Innerschweiz, allen voran Sagihans, «der Zulu», wie ihn seine Kameraden wegen des wilden Lockenkopfs gern nannten, die einmal sogar selbdritt auf Vaters Töff durch die Stadt rasten, wo sie von Polizisten aufgehalten und verfolgt, mit der ganzen Bagage eine steile Treppe hinunterholperten, um dem polizeilichen Zugriff zu entkommen.
Vater verbrachte seine Freizeit gern im «Volkshaus» oder in der «Eintracht», wo er sich für gewerkschaftliche Anliegen und «linke» Ideen begeistern liess. Seine Freunde waren Arbeiter wie er, einige von ihnen wanderten dann sogar in das neue «Arbeiterparadies», die Sowjetunion, aus, um dort beim Aufbau der antikapitalistischen Gesellschaft mitzuhelfen. Andere blieben ihm noch viele Jahre lang verbunden, oft besuchten sie uns auf dem Kaiserstuhl, halfen beim Heuen oder bei der Ernte mit oder verbrachten in unserem Haus einige Ferientage mit ihren Familien. Erinnern kann ich mich noch gut an die Familie Zöbeli mit ihrem Sohn Dölfi aus der Bäckerstrasse im Kreis Cheib, an den gemütlichen Herrn Demuth, der aussah wie ein Kranzschwinger, und an den lustigen Herrn Stierli, der stets für jeden Schabernack zu begeistern war.
Seit Ende der Zwanziger- und Anfang der Dreissigerjahre lebte mein Vater nun nicht mehr zu Hause im Loch, sondern die meiste Zeit auswärts, in Zürich oder bei seiner Schwester Sabina im Röhrli in Lungern. Im Lochheimet lebte zwar der Ätti noch mit seiner jüngsten Tochter, der Cäcilia, die sich zu einer fröhlichen, quirligen jungen Frau entwickelt hatte. Vom Ätti hatte sie die Vorliebe und das Talent für alles Musikalische geerbt, das sonnige Naturell und das mediterrane Temperament, dazu die Gabe der Leichtigkeit, die Probleme des Lebens mit einem Lachen zu bewältigen.
Die schwere Arbeit auf dem Feld und im Stall, das Holzen und die Alpsömmerung wurde von den Brüdern Jost und Fredi, beide zu dieser Zeit noch unverheiratet, übernommen. Als nun Vaters Götti, ein Onkel, der im Haus Alpenblick als Altlediger mit einer Haushälterin gelebt hatte, starb, vermachte er seinem Patensohn sein altes Haus, was den Hans nun wiederum bewog, nun endlich das Heiraten ins Auge zu fassen. Seine Braut fand er im grossen Melchtal, das anders als das kleine das ganze Jahr über besiedelt war. Es war dies der engste und hinterste Krachen von Obwalden, wo die paar Talbewohner im Schatten des Nünalphorns, des Hutstocks, des Frauenklosters und der Wallfahrtskirche unserer lieben Frau in harter Arbeit und frommer Einfalt ihr kärgliches Dasein fristeten.
Elisabeth, Elisi, hiess die Auserwählte, ihr Vater war schon früh auf dem Berg umgekommen, derweil ihre Mutter sich nach seinem Tod in eine Krankheit flüchtete und jahrelang das Bett hütete. Als junge Frau, die zweitälteste Tochter der Familie, begann sie in Kerns eine Lehre als Schneiderin. Doch infolge der Krankheit ihrer Mutter musste sie diese vorzeitig abbrechen, sie wurde zu Hause gebraucht, waren da doch noch jüngere Geschwister zu versorgen. Später konnte sie sich dann zur Hauspflegerin ausbilden lassen, in der Folge absolvierte sie noch einen Hebammenkurs und arbeitete in verschiedenen Privathaushalten. Inzwischen war sie bereits vierundreissig Jahre alt, auch Hans war nicht mehr der Jüngste, ging er doch gegen die vierzig. Ihren Traum, einmal zu heiraten, eine Familie zu gründen und einen eigenen Bauernhof zu besitzen und zu bewirtschaften, hatte Elisi schon längst aufgegeben. Mit Hans bot sich ihr die Gelegenheit nun doch noch. Auch für ihn war das die beste Lösung für alle seine Probleme, die Sorge für den alten Vater, die Arbeit auf dem Hof konnte er so an seine Frau delegieren. Eigentlich war sie ihm zwar ein bisschen zu ernst, zu fromm und gottesfürchtig, doch, so dachte er, das würde sich wohl mit der Zeit geben.
Was beide gleichermassen verband, war der Kinderwunsch, der für ihn oberste Priorität hatte, wollte er doch alles, was er ererbt, erarbeitet und bewahrt hatte, auf keinen Fall seinen Geschwistern hinterlassen. Für sie, die in ihrer Berufsarbeit in so vielen Haushalten die Kinder ihrer Brotgeber betreut hatte, bedeutete ein Kind die Erfüllung, den höchsten Sinn und Zweck ihres Lebens und Daseins. Doch das Schicksal hatte anders bestimmt, kaum ein Jahr nach ihrer Eheschliessung musste sie sich einer Unterleibsoperation unterziehen. Und damit war auch das Thema «Kind» für sie vom Tisch. Das bedeutete für die strenggläubige Katholikin aber auch, dass von diesem Zeitpunkt an sexueller Verkehr mit ihrem Gatten nicht mehr möglich war. War doch der Beischlaf nach der Sittenlehre der Kirche verheirateten Paaren nur gestattet, wenn auch Kinder aus diesem Akt geboren werden konnten. So wurde sie Mitglied des Dritten Ordens, trug fortan ein Skapulier und rückte ihr Bett um die Breite des Nachttischchens vom Bett des Gatten ab. Trotz seines oft sehr charmanten Drängens blieb sie hart, betete in Zeiten der Bedrängnis den Rosenkranz und verzehrte sich in harter Arbeit. Sie führte nun den Hof und leitete die Landwirtschaft, seit Fredi und Jost das Loch verlassen und ihr Auskommen im Unterland gefunden hatten. In der neuen oberen Scheune standen nun nur noch zwei Stück Vieh und ein paar Häupter Galtigs, die aber einem Viehhändler aus dem Nachbardorf gehörten und auch von einem seiner Knechte besorgt wurden. Schon bald hielt sich Elisi im Geissenstall ein Dutzend Toggenburger Ziegen, im Tränkschopf einige Kaninchen. Zusammen hauste das neugebackene Ehepaar in der hinteren Wohnung im Vaterhaus, während Cilly und Ätti den vorderen Hausteil belegten. Am Anfang muss das Verhältnis der zwei Frauen recht gut gewesen sein. Vater renovierte unterdessen den Alpenblick, nach Mitte der Dreissigerjahre gab es für die Holzbau AG nur wenig zu tun, viele Mitarbeiter mussten entlassen werden.
Nach Mutters Unterleibsgeschichte und ihrem Aufenthalt im Krankenhaus verschlechterte sich die Atmosphäre im Loch eindeutig, die Beziehung zwischen den zwei Frauen spitzte sich zu, dass dabei auch Eifersüchteleien und weibische Perfidie im Spiel waren, behauptete der Ätti, wenn dieses Thema zur Sprache kam. Cilly war noch ledig, eine junge, hübsche Frau von Mitte zwanzig. Recht häufig bekam sie Besuch von Nachtbuben oder Freiern. Denen wurde dann aufgetischt und kredenzt, das war so Sitte, diese Rituale entwickelten sich oft zur Plage, störten die Ruhe und den Frieden. Mein Vater kam meistens erst spät nach Haus, er arbeitete bis in die Nacht hinein an seinem Haus. Wenn er dann auftrat, leerte sich die Stube, und die Besucher verschwanden in die Nacht, aus der sie gekommen waren. Es kam vor, dass er über das Lotterleben fluchte, über die sinnlose Verschwendung, das Füttern dieser Buben belaste nur den Haushalt. Doch meistens war es Elisi, die zeterte, wegen der Moral oder der Gelegenheit zur Unzucht, der hier Vorschub geleistet werde. So waren dann alle Beteiligten froh, als der Umbau und die Renovation des Alpenblick endlich fertig war, das war im Frühling ᾽37, und Hans und Elisi hielten dort Einzug.
Grossvater schenkte den beiden das Bildnis von Sankt Kümmernis, es war die Darstellung einer gekrönten gekreuzigten Figur, angetan mit einem blauen Gewand, besät mit goldenen Sternen. Das Kunstwerk war aus Wachs gefertigt und mit einer echten Reliquie versehen, gekräuseltes Barthaar in einer Kapsel, bedeckt von einer gewölbten Glasplatte, das Ganze in einen reichverzierten Goldrahmen gefasst. Wie Ätti zu erzählen wusste, war St. Kümmernis eine Königstochter aus Lusitanien, die auf ihr Bitten von Gott mit Bartwuchs augestattet wurde, sodass sie in ein Männerkloster eintreten konnte und dort ihr ganzes Leben lang Gutes tat. Als sarazenische Räuber das Kloster überfielen, kreuzigten sie alle Mönche. Die Blutzeugen wurden, als die Übeltäter verschwunden waren, von den überlebenden Dorfbewohnern vom Kreuz abgenommen und feierlich bestattet. Beim Waschen und Zurichten der Leichen wurde dann die Identität der heiligen Märtyrerin entdeckt und in der Folge vom Volk als St. Kümmernis verehrt. Das eigenartige Bild der gekreuzigten, bärtigen Frau hing dann noch jahrelang in einer Ecke im Schlafzimmer meiner Eltern. Ich durfte dort nicht hin, dieses Zimmer war für mich verbotenes Terrain. Doch kam es manchmal vor, wenn ich allein zu Hause war, dass ich hineinschlüpfte und dann voll Staunen diese bunte, barocke Darstellung betrachtete, mit Andacht, Furcht und leichtem Schaudern. Eines Tages ertappte mich meine Mutter dabei, und dann war das Bild weg, ich habe es nie mehr gesehen.
Die Ehe meiner Eltern muss von Anfang an von Problemen belastet gewesen sein. Es war mein Vater, der viel später dann – es war während meiner Sekundarschulzeit – mit mir darüber sprach. Sei es, um seine Eskapaden zu rechtfertigen, war er doch wieder einmal in eine Vaterschaftsklage verwickelt, sei es, um mich vor den Klippen des Ehelebens zu warnen, über die Gefahren des Eros aufzuklären.
Ein schlechtes Omen war bereits der Start zur Hochzeitsreise. Am Morgen nach der Hochzeit wollten sie vor der Lungerer Kirche, umgeben von einigen Angehörigen und Freunden, zur Hochzeitsreise ins Tessin aufbrechen. Beide in Motorradanzügen, angetan mit Lederkappen und grossen Staubbrillen, winkten den versammelten Leuten zu. Dann startete Vater die schwere Maschine, Mutter sass hinter ihm auf dem Soziussitz, als er plötzlich anfuhr und das steile Strassenstück zum Brünigpass hinaufdonnerte, wobei seine Ehefrau vom Sattel fiel und unsanft auf die Strasse plumpste. Er bemerkte das Missgeschick erst im ersten Rank, kehrte um, und unter dem Gelächter der Umstehenden wurde dann zum zweiten Mal gestartet. Auch die Hochzeitsnacht muss in einem Desaster geendet haben, erschien doch anderntags die frischgebackene Ehefrau mit rotgeschwollenen, verweinten Augen am Frühstückstisch. Und als ihm dann seine Frau die Erfüllung ehelicher Freuden später ganz versagte, war er keineswegs bereit, sich in sein Josefsschicksal zu fügen, von Askese, Kasteiungen und frommem Wandel war er gar nicht angetan, im Gegenteil. Enthaltsamkeit entsprach seinem Temperament in keiner Weise. Es war auch nicht so, dass ihn nun Sinneslust zur Unmässigkeit oder zu Ausschweifungen getrieben hätte, nie sah ich ihn betrunken, nie unbeherrscht. Immer wieder brachte er ein kleines Präsent mit, wenn er von längeren Absenzen wieder einmal nach Hause kam, vom Berg oder aus der Stadt, ein Sträusschen Edelweiss, eine Schachtel Pralinen oder ein schönes Umhangtuch, einmal sogar eine Serie kunstvoll bestickter Taschentücher. Auf die Frage meiner Mutter, was sie denn nun damit anfangen solle, meinte er sarkastisch grinsend, es gebe dafür bei ihr wohl immer Bedarf, und sei es nur zum Trocknen ihrer Freudentränen, wenn er endlich wieder daheim sei.
Jeden Morgen stieg er in das kalte Wasser des Brunnentrogs hinter dem Haus, selbst im Winter, wenn er zuerst das Eis zerschlagen musste. Doch scheinbar konnte auch Eiswasser seine Hitze nicht löschen, man munkelte so dies und das, die Leute tratschten hinter vorgehaltener Hand, dass das Elisi gar so manches nachsah und in ihrer Toleranz oft bis an die Grenzen des Erträglichen ging. Meine Mutter, die stets die Miene stiller Duldung zur Schau trug und dabei einen kleinen Geruch von Unzufriedenheit ausströmte, schien in ihrem arbeitsamen und gottesfürchtigen Lebenswandel so etwas wie einen Ausgleich für die Härten ihres Schicksals gefunden zu haben.