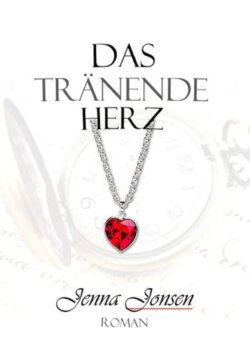Читать книгу Das tränende Herz - Jenna Jonsen - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1 – Früher Vogel
ОглавлениеNicht grundlegend rosig, erlebte ich im Großen und Ganzen eine schöne Kindheit. Zu meiner Zeit, als Google & Co noch nicht existierten und die ersten Mobiltelefone, mit ausziehbarer Zahnstocher-Antenne, überwiegend als Schlagknüppel zu nutzen waren, in der das versehentliche Drücken des Internet-Buttons eine wahre Nerven- und Kostenkatastrophe auslöste, gab es für jegliche Blödsinns-Attacken keinerlei Beweise, es sei denn man ließ sich auf frischer Tat ertappen und konnte so direkt zur Rechenschaft gezogen werden. Heute bleibt, dank fortschreitender Entwicklung, nichts mehr dem Zufall überlassen geschweige denn unentdeckt. Und wer konnte schon bisher jemals behaupten, dass er mit einer Handyhalterung am Rollator, womöglich inklusive höchstsensibler Freisprecheinrichtung, sein Haus verlässt?
Bis zum Alter von zwölf Jahren wuchs ich auf einem Bauernhof, in einem kleinen Dorf mit sieben alten Häusern, auf, wie in Schlumpf-hausen, Tür an Tür mit den Anrainern. Ein Geschäft oder Ähnliches gab es nicht. Selbstversorgung stand, neben dem täglichen Schul-Wahnsinn, auf dem Programm. Die nächste Einkaufsmöglichkeit erreichte man nach drei Kilometern, die umliegende Schule nach rund zwanzigminütigem Fußmarsch. Dass mein Schulweg in der kalten Jahreszeit kein Pappenstiel war begriff ich erstmals, als ich die winterlichen Schneemassen mit meinem gelben 5-Gang-Drahtesel zu bekämpfen versuchte und dabei vom Schneepflug ausversehen über den Haufen geräumt wurde. Durch Zufall, auf seinem täglichen Arbeitsweg, entdeckte Onkel Fidy, der Bruder meiner Mutter Regine, mit dem ich zu Kindeszeiten unter einem Dach lebte, mich unter dem großen, eisigen Schneehaufen, vom Pflug zusammengeschert, aus dem ich nicht mächtig war mich eigenständig zu befreien. Zum Glück ragte der Hinterreifen meines Fahrrads aus der Schneemasse heraus, sonst hätte mich wohl niemand so rasch gefunden. Dennoch mochte ich mein zu Hause. Hier durfte ich unbeschwert Kind sein und meine Freizeit, nach den Hausaufgaben, in der Natur oder bei Freunden genießen. Langeweile, ein Fremdwort!
Oma Rosalie, auf deren Hof ich aufwuchs, war Bäuerin und stand jeden Morgen um 3.30 Uhr auf der Matte, wenn der uralte, zerrupfte Nachbarsgockel den ersten grässlichen Schrei von sich stieß, der sich eher dem lauten Gejammer eines brünftigen Hirsches unterordnen ließ. Sämtliches Ungeziefer seines dreckigen Federkleides dürfte auf diese Weise freiwillig das Weite ersucht haben. Rosalie bereitete mir täglich mein Frühstück zu, nachdem sie vom Kühe melken aus dem Stall, mit frisch gezapfter Milch, zurückkehrte. Bei Oma Rosalie und Opa Raimund standen 18 Milchkühe im Stall, die täglich zwei Mal gemelkt werden wollten. So erarbeiteten sich die beiden, neben dem Verkauf von eigen angebautem Obst und Gemüse aus dem Garten, ihr tägliches Brot…
Meine Mutter bekam ich überwiegend an den Wochenenden zu Gesicht, da sie Vollzeit berufstätig war. Schon als Winzling lebte ich somit erstmals bei meinen Großeltern, väterlicherseits, Abery und Hugo. Später pendelte ich wöchentlich zwischen beiden Paaren hin und her. Mein Vater, Sigi, holte mich freitags nach Schulschluss in Obsor, dem kleinen Bauerndorf, ab und fuhr mich zu Abery, wo ich jedes Wochen-ende verbrachte. Meiner Mum nahm ich die seltenen Treffen mit zunehmendem Alter definitiv übel. Als Teenie blieb mir unverständlich, dass Geld nicht auf Bäumen wächst und von irgendwoher kommen musste. Jeden Sonntag kutschierte mich Regine zurück nach Obsor, da ich schulpflichtig war und zuerst die Grundschule, später die fünfte und sechste Klasse der Gesamtschule, besuchte…
Nach zwölf Jahren hatte ich die Nase vom Bauernhofdasein, trotz der Pendelei am Wochenende, gestrichen voll, es fehlte an Abwechslung. »Neue Pflaster beschreiten und eigene Wege gehen«, sollten sich meine Zukunftspläne, Masche für Masche, fest ineinander verstricken. Mein Leben schrie förmlich nach Veränderung. So zog ich zu Oma Abery ins rund 20 Kilometer entfernte Genimo. Die lebte in ihrer 84-Quadratmeter-Parterrewohnung, inmitten der kleinen »Ghetto-Siedlung«, unweit von Schulen und dem »Zentrum des Geschehens« entfernt, wenn es dieser Bezeichnung denn überhaupt würdig war. Beim Einzug in mein Reich, ein rund zwölf Quadratmeter großes, quadratisches Zimmer mit Norm-Fenster, half mir Nachbar Flo, gelernter Maler, nach einer Schnelleinführung in die Fertigkeiten der Wischtechnik, zwei Wände in Gelb zu bepinseln. Ansonsten lebte ich schlicht und einfach, wie es zu meiner Zeit eben so üblich war. Ein Bett, ein Tisch mit Nachttischlampe samt Stuhl, über den ich abends vorm zu Bett gehen die tagsüber getragene Kleidung hängte, und ein kleiner Schrank, in dem meine Klamotten Platz fanden, war so relativ alles was ich besaß. Markenklamotten oder Tablets und Handys spielten keine Rolle. Und das brauchte ich als Kind auch nicht. »Natur pur!« wurde mir zwar zugegeben mit zunehmendem Alter zu öde, doch hätte ich mir keine schönere, unbeschwertere Kindheit vorstellen können. Andererseits gab es für mich keinen schlimmeren Gedanken als Stillstand. Stillstand bedeutet automatisch Rückstand. Und ich wollte mich nicht zurückentwickeln, sondern fortbilden…
Kein Kind von Traurigkeit bildete ich auch in der neuen Klasse der Mädchenrealschule, die Klosterschwestern betreuten, unter den Schülern als »Watschelpinguine« verschrien, rasch Kontakte zu anderen Mitschülerinnen.
»Gesicherte Freizeitaktivitäten!«
Zwar nicht die hellste Leuchte, aber immerhin nicht ganz auf der Brennsuppe daher geschwommen, fiel es mir nicht sonderlich schwer, mich an den übermäßigen Lernstoff, den ich so von der Gesamtschule bisher nicht kannte, zu gewöhnen…
Alles lief rundum gut, dann landete Abery plötzlich im Krankenhaus. Dass sie schwer krank war, wusste ich ja schon als Kind. Aber als Teenie nahm ich nie richtig wahr, was mir meine Eltern da eigentlich erzählten, bis es mir selbst die Augen öffnete und das Leben mich, »Klatsch-Boom«, vor vollendete Tatsachen stellte. Eben wie bei Kleinkindern, nach dem Motto »learning by doing«, so bleibt es oft weiterhin im Erwachsenenalter.
Und da lag sie…
…mit einem Schlauch in der Nase und der Nadel mit 200 Milliliter Infusion im Arm, die ihr angeblich Flüssigkeit zuführen sollte. »Peeeeep…, Peeeeep…, Peeeeep…«, dröhnte es gleichmäßig neben ihr aus dem Puls- und Herzfrequenzmesser, an den sie mit dem linken Zeigefinger, über eine Art kleiner grauer Sensor, angeschlossen war. Das weiße Nachthemd, in das sie die Schwestern bei der Einlieferung gehüllt hatten, glich haargenau ihrer derzeitigen Gesichtsfarbe, käsebleich und weiß wie eine frisch gestrichene Wand. Dass Abery so mit ihrer Gesundheit kämpfte, begriff ich erstmals, als ich sie dort so hilflos liegen sah…
Da sie trotz ihres schweren Herzinfarkts »die Tapfere« spielte und selbst im ärgsten Schmerz keine Mine verzog, wurde sie erst Stunden später in die umliegende Klinik eingeliefert. Zuvor verbrachte sie die halbe Nacht am sperrangelweit offenen Fenster, mit aufgeknöpftem Nachthemd und ihrer Lippenbremsen-Atmung, die sie sich über Dr. Kraus Jahre zuvor für den Ernstfall angeeignet hatte, immer wieder nach Luft ringend. Ich erwachte durch die entstandene Zugluft und nahm ein leises »Au…, Aua…« aus Aberys Schlafzimmer, schräg gegenüber, wahr. Sofort alarmierte ich den Notarzt, der die gebrechliche alte Dame rund 15 Minuten später, lauthals mit Sirene und Blaulicht, ins nächstgelegene Krankenhaus, die Untersberg-Klinik, verfrachtete. Das Nötigste in eine riesige braune Reisetasche aus Leder zusammengewürfelt, fetzte ich mit dem Fahrrad, so schnell meine Beine traten, hinterher in Richtung Notaufnahme, wo Abery zwischenzeitlich gründlich untersucht wurde. »Warum kommen Sie erst jetzt, Frau Fröhlich?«, testete der Kardiologe fragend, mit seiner schwarzen Taschenlampe, das linke Auge fest zugekniffen, ihre momentane Pupillenreaktion. »Na hätten Sie sich mal lieber früher einliefern lassen!«, folgte es weiter in strenger Tonlage.
»Hätte, hätte Fahrradkette…«
»Alles klar. Und hätte, hätte spielt gerade Klarinette«, entgegnete Abery gleich zynisch. »Jegliche Vorwürfe verbessern ihren derzeitigen Zustand natürlich wesentlich!«, musste ich seine zuvor getroffene Aussage abrunden. Vorerst gab es keine genaueren Untersuchungsergebnisse…
Schwester Erika, aktiver Nachtdienst der Station 1, brachte Oma Abery, in ihrem Bett auf Rädern, mit dem Personenaufzug auf Zimmer 101, erster Stock. Hier sollte sie vorerst für unbestimmte Zeit einquartiert werden. Links auf der Fensterseite des Dreibettzimmers abgestellt, die bunten, der Länge nach linierten, Vorhänge zugezogen, noch eine Flasche stilles Wasser hingestellt und schon setzte Erika pfeifend, ohne Weiterbeachtung, den Trott ihrer Nachtschicht fort. »Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich…
…so ausgesprochen fröhlich?«, hörte ich sie unmusikalisch, ihre Crocks quiekend, den langen Gang hinunter, vor sich hin piepen.
»Ihr Ernst?«
Abery lauschte damals meinem ersten Schrei, wir pflegten eine besonders eminente Bindung zueinander. Gerne betonte sie ihre Druckmethoden an meinem Geburtstag, denn ich sollte um jeden Preis vor der Sonntagsmesse geboren werden, die Abery nie versäumte. Am 31.01.1988, um 11.05 Uhr, erblickte ich sodann, verschrumpelt und erschöpft, mit einem lauten Schrei, das Licht der Welt. Geboren unter 86-prozentigem Mondeinfluss, im Aszendenten Stier, vom Sternzeichen Wassermann, gehörte ich, Jenna Nicola Jonsen, laut Terlusollogie, zur Gruppe der lunaren Einatmer. Was das für mich und meine Lebensweise bedeuten sollte, stellte sich erst viele Jahre später heraus, als lästige Hautekzeme, die von zahlreichen Ärzten, nach ellenlangem Rätselraten und Rumgedoktore, mit »psychosomatischer Ursache« abgestempelt worden waren, meine Lebensqualität einschränkten…
Bereits beim Betreten des Flurs im ersten Stock rannte mir kalter Schweiß über den Nacken in den Rücken, zwischen meinen beiden knochigen Schulterblättern hindurch, hinab durch die vielen kleinen Brustwirbel, bis in den letzten Lendenwirbel. Haar für Haar sträubten sich meine Nackenhaare und stellten sich einzeln senkrecht gegeneinander auf. Mit einem Schlag wurden meine Hände pitschnass. »An der Hose abwischen«, dachte ich nur. Doch sobald ich sie abgestreift hatte, waren sie sofort wieder mit vielen winzigen, eiskalten Schweißperlen durchtränkt. »So kann ich die Türklinke unmöglich anfassen«, wusste ich. »Päh!, Bakterienschleuder. Nichts Schlimmeres als Krankenhauskeime!«, warf ich geekelte Blicke auf meine beiden Pratzen. Vor jeder Eingangstür befanden sich Spender mit hellblauer Flüssigkeit, Desinfektionsmittel. Ich desinfizierte mir gründlich, Finger für Finger, angefangen mit dem linken Daumen, beide Hände. Der goldene Ring mit weißer Diamanteinfassung, ein Geschenk meiner Mutter, musste dafür ab.
»Bloß keine Viren oder Bakterien in Aberys Zimmer, auch wenn dieses Zeug abartig grausig müffelt!«
Das übernahmen meiner Meinung nach schon die Ärzte, Schwestern und Besucher der zwei halbtoten Bettnachbarn, Frankensteins Kinder persönlich, denen jeweils nur die Korken links und rechts der Halsschlagader fehlten, makaber aber wahr. Diesen sterilen Geruch, der sich rasend schnell über den gesamten Flur ausbreitete, nahm ich unmittelbar nach Betreten der Eingangstür wahr. Er bohrte sich in meine beiden schlanken, dennoch aufnahmefähigen, Nasenlöcher. Dieser, fast schon penetrante, Gestank befahl meinen Nasenflügeln sich mit dem nächsten Wimpernschlag zu Rümpfen und den Ekel unter keinen Umständen unbemerkt vorbeiziehen zu lassen!
Krankenhäuser mochte ich generell noch nie, aus Prinzip. Als sich mein Vater, Sigi, damals dann, nach seiner Knie-Operation am Meniskus, die ohnehin eher miss- als gelungen verlief, mit einem merkwürdigen Krankenhauskeim infizierte, leuchtete mir recht schnell ein, dass auch Ärzte nur Menschen waren, die hin und wieder Fehler begingen. Irren bleibt schließlich menschlich. Und bei dieser Anzahl an Arbeitsstunden, die zweifelsohne an abartige Akkordarbeit grenzte, konnte die Konzentration niemals dauerhaft auf Hochtouren bleiben, bei Robotern vielleicht, ja. Abery aber war eine alte Frau von 78 Jahren. An ihr konnte man nicht einfach so, mir nichts dir nichts, herumexperimentieren…
»Die warten hier doch nur auf meine Organe. Gleich wenn der Arzt meinen Hirntot diagnostiziert hat, werden die anfangen mich aufzuschnipseln, wirst sehen!«, pfiff sie, mit einem schelmischen Lächeln auf den Lippen, über die Bettkante. »Hör bloß auf damit, du weißt genau, dass ich mir immer alles bildlich vorstellen muss«, erwiderte ich kopfschüttelnd und nicht gerade amüsiert über ihre Aussage. »Ist doch wahr. Da blitzen nur die Euro-Scheine in den Pupillen. Wusstest du eigentlich, dass die für jeden Toten einen Haufen Geld kassieren?«, folgte es weiter kühl aus ihrem Mund. Eine fast erdrückende Stille durchschwebte den kahlen, übersichtlichen Raum. Vorzugsweise hätte ich die Frau, die ihre eigene Angst gerne mit schlag-fertigen Kommentaren übertrumpfte, in den komischen Plumps-Rollstuhl gesetzt, den Schwester Erika neben ihrem Bett geparkt hatte, als Nacht- oder Rollstuhl nutzbar, und wäre mit ihr auf die »In-Ordnung-Wiese« gefahren. Als Kind gab es die für mich. Immer dann, wenn ich verzweifelt war, mich unwohl oder einsam fühlte, spazierte ich zu meiner Lieblingswiese und legte mich dort zu Boden, völlig egal ob es aus Kübeln schiffte, wie wild schneite oder die Erde von der Sonne mit warmen Strahlen geküsst wurde. Kurze Zeit später fühlte ich mich besser, frei, so bescheuert es klingen mag, geerdet. So gerne hätte ich auf diese Weise auch Abery geholfen, dass das aber nicht möglich war, wusste ich ebenso. »Zeit mit ihr verbringen, denn ich weiß nicht, wie lange ich sie noch bei mir habe und sie erzählt schließlich die schönsten Geschichten«, schoss es mir durch den Kopf, als ich ihr Krankenzimmer betrat. Oft war unmöglich zu unterscheiden, ob Aberys Erzählungen der Realität zuzuordnen oder frei erfunden waren, zu glaubhaft erzählte sie…
Trotzdem ihr Körper durch den erlittenen Infarkt sehr schwach war, fing sie, als konnte sie meine Gedanken lesen, sofort nach der Begrüßung wie so oft, an: »Als kleines Mädchen, zwei Tage nach meinem achten Geburtstag, schlenderten meine Mutter und ich durch den Wald, um Pilze zu sammeln. Als wir mit vollen Körben den Heimweg antraten, stießen wir am Wegrand auf ein Reh, verfangen in einer Falle. Beim Versuch das Tier zu befreien, geriet meine Mutter selbst mit der Hand in die Schnappfalle. Ich war klein und wusste mir keinerlei Rat…
Mutter, deren Hand bereits nach kürzester Zeit völlig blutdurchtränkt war, schickte mich durch den endlosen, düsteren Wald, um im Dorf Hilfe zu holen. Was blieb mir für eine Wahl, ich musste sie alleine lassen, sie wäre sonst jämmerlich verblutet…
Also lief ich, durch die grünen Tannen, Eichen, Ahorn und Kastanien. Plötzlich kreuzte, wie es der Zufall wollte, ein Jäger meinen Weg. Aufgeregt erzählte ich, ohne Luft zu holen, was geschehen war, doch er schenkte mir keinen Glauben und wollte auf seinen Thron, hoch oben zwischen den Bäumen, versteckt im Geäst, zurücksteigen. Ich aber blieb hartnäckig und zerrte ihn am Arm…«
Und dann wurde sie durch ein tiefes Räuspern der blonden Schwester Erika, die schon eine ganze Weile an ihrem Bett stand und aufmerksam der Geschichte lauschte, unterbrochen und aus der Welt der Fantasie entrissen. »Ihre Medikamente, Frau Fröhlich«, hörte ich die raue, rauchige Whiskey-Stimme sagen. »Noch mehr Medikamente? Wozu sollen die denn wieder gut sein?«, fragte ich entsetzt. »Ein regelrechtes Vollgepumpe ist das hier. Ernähren will ich mich von diesen gummiüberzogenen Smarties, die mein Gehirn verkalken, nicht!«, scherzte Abery. Sie sollte also noch mehr Tabletten schlucken. Und das, obwohl ihr Herz ohnehin schon schwach war!
Der Oberarzt, Dr. med. Dieter Pfunzer, der kurze Zeit später, nach Schwester Erika, Zimmer 101, erster Stock, siebte Türe links neben dem Aufzug, betrat, verdeutlichte allen Anwesenden im Raum, ohne langes Gerede um den heißen Brei, dass über die Hälfte seiner Patienten in der Woche nach dem Infarkt an dessen Folgen stirbt. »Das Herz ist keine Maschine und übersteht bei Weitem nicht alles!«, sagte er nur in kalter, strenger Stimmlage, mit gerümpfter Nase und zusammengezogenen Augenbrauen, die sich kurz vor Beginn seiner hohen Denkerstirn in einen tiefen Knick verwandelten. »Und mit der Unsterblichkeit haben wir es noch nicht so!«, fügte er noch zwinkernd hinzu, dann war er auch schon wieder verschwunden.
»Richtig professionell und rücksichtsvoll!«
Seine Stirnfalten verrieten eine ersichtliche Langeweile in dem Berufsfeld, das der gute Mann wohl eiskalt auf ganzer Linie verfehlt haben dürfte, nahezu unmenschlich klang er. Aber warum wurde Abery dann in einer Tour mit Tabletten und Infusionen zugedröhnt?
Wie sollte sich ihr Herz so erholen?
Doch Abery war eine der stärksten Kämpferinnen weltweit, wie Uma Thurman in »Kill Bill«, mit ihrem handgeschmiedeten Hattori Hanzo Schwert, alleine gegen den Rest der Welt, auf der Suche nach Vergeltung dafür, was man ihr angetan hatte…
Auch wenn ich nie viel auf die Macht weißer oder schwarzer Magie setzte, wusste ich, dass es etwas gab, das eine Verbindung zwischen Abery und mir aufrechterhielt. So übereilte mich damals in der Schule urplötzlich starkes Bauchweh, sofort ab nach Hause!
Krankenzimmer konnte ich beim besten Willen partout nie ausstehen. Diese rauen Bundeswehrdecken, auf der seltsam rutschigen, grünen Doktorliege sollten dem Kranken Erholung bieten?
Nein, diese Meinung konnte ausschließlich jemand vertreten, der nicht ganz bei klarem Verstand war, so viel war sicher. Zu Hause angekommen, bemerkte ich zügig, dass Abery unglücklich gestürzt war und es nicht schaffte alleine aufzustehen…
Am Abend ihres Herzinfarktes umschlich mich ebenso eine komische Vorahnung. Ich schlief unruhig und wachte mehrmals, ungefähr stündlich, auf. Sonst nächtigte ich wie ein dicker, schwerer Felsklotz. Schlaf war mir heilig, den durfte und wollte mir niemand stehlen, sonst wurde ich ganz fix zum rudelbeschützenden Wolf in Angriffsposition. So hätte man jemanden neben mir ermorden können, wenn ich mich in der Tiefschlafphase befand, es wäre spurlos an mir vorübergezogen. Anders am besagten Abend…
Frieda, Aberys Mutter, legte Karten. Aus einem gewöhnlichen Kartenblatt offenbarte sie Ereignisse, die meist kurze Zeit später eintraten. Das faszinierte mich schon als kleines Mädchen. Karten aber stellten für mich nur einen gestapelten Berg Zahlen auf etwas festerem Papier dar. »Was sollte man daraus schon großartig lesen können?«, glaubte ich. »Uroma Frieda muss ir-gendeinen anderen Trick haben«, war ich demnach absolut überzeugt. Es war eher natürliches Material, das mir Bezug verschaffte. Als ich dann, bei einem Stadtbummel, ein Pendel im Schaufenster eines Edelsteingeschäftes fokussiert hatte, an dem es am Rückweg unmöglich war vorbei zu schlendern, begannen meine ersten Experimente in Eigenregie. Es war ein braun-weiß marmorierter Stein in Tropfenform, in Silber gefasst, am Ende der Kette mit durchsichtiger Perle versehen, der mich so faszinierte. Er lag perfekt in der Hand. Ich hätte mir kein besseres Pendel aussuchen können, obwohl ich sowieso an seiner Macht zweifelte.
»Bereit für den ersten Test!«
Wieder einmal war es der Schlüssel, der für mehrere Stunden unauffindbar blieb. »Ob er sich so wiederfinden lässt?«, versuchte ich mich zu konzentrieren und legte los. Das Pendeln an sich funktionierte ganz gut, ich fand meinen Schlüsselbund auf Anhieb. »Mit Sicherheit reiner Zufall«, redete ich mir ein, aber als ich mit der Zeit auf diese Weise immer mehr Verlegtes wiederfand, wagte ich einen weiteren Schritt: einen Blick in mein eigenes Leben. Das Pendel diente lediglich als Hilfestellung. Im tiefen Inneren kannte ich die Antwort bereits. Und: Es rückten Einzelheiten zu Tage, die besser in meinem Unterbewusstsein vergraben geblieben wären, zu sehr hatte ich lange Zeit mit einigen von ihnen gekämpft…
Abery schluckte ihre Medikamente. Schwester Erika und Oberarzt Dr. med. Pfunzer hatten Zimmer 101 nacheinander wieder verlassen. Und sie erzählte weiter: »Ich zog ihn zu den alten, verrotteten Baumstämmen, wo meine Mutter und das junge Kitz blutüberströmt, stark verletzt, ihrem Schicksal ausgeliefert, lagen. Der Jäger befreite die beiden und rettete ihnen ihr Leben. Ihre tiefen Fleischwunden, verursacht durch das Zuschnappen der gelegten Wild-Falle, schienen…
…cchhhhzzzz…, chhhhzzz…«
Wieder war es vorbei. Abery schlief. Wahrscheinlich der vielen Pillen wegen. Ich verließ vorerst das Krankenhaus. Auf mich gestellt probierte ich die derzeitige Situation zum Besten zu nutzen. »Das Leben ist kein blasbares Wunschkonzert. Manches lässt sich nicht ändern, so sehr man es auch herbeisehnt«, musste ich mir eingestehen. Selbst kochen, keiner kontrollierte meine Hausaufgaben. Die anfallenden Hausarbeiten, die sonst Abery erledigte, blieben mir überlassen. Über zwei Wochen »hauste« ich in meinem vertrauten Heim. Schlimmer wäre das zwischenzeitliche Umsiedeln zu einem Angehörigen oder gar in betreutes Wohnen gewesen. Nach 17 Tagen kehrte Abery endlich zurück. Sie hatte sich gut von dem schweren Infarkt erholt. Voller Vorfreude bereitete ich ihr einen ordentlichen Willkommensempfang…