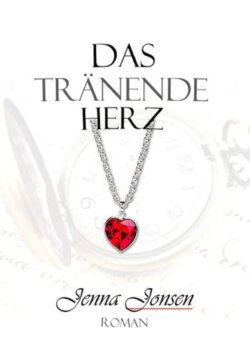Читать книгу Das tränende Herz - Jenna Jonsen - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2 – Kollos auf Zeit
ОглавлениеMit rund 16 Jahren, zu Mitte der Pubertät, legte ich stark an Körpergewicht zu. 30 zusätzliche Kilos zierten meine Hüften und verwandelten ein einst schlankes, zierliches Püppchen in einen dicken Pummel mit knapp 98 Kilogramm. Von Hosengröße 36 auf 44, das schaffte mit Sicherheit nicht Jeder, ich dafür mit Links!
Eines Morgens, als ich mich routinemäßig vorbereitete, überkam mich ein dermaßener Graus vorm eigenen Spiegelbild, der sofortige Gegenmaßnahmen erforderte, die idealerweise schon vorvorgestern begonnen hätten. Doch da war es wieder, dieses kleine, aber feine Wort: »Hätte«. »Jeder unerträglichen Fettrolle den Kampf ansagen…«, versuchte ich enttäuscht den Knopf meiner Lieblingsjeans zuzukriegen, was der Stau um den mittleren Ring aber vorzüglichst zu verhindern wusste. Aus dem »Hätte« wurde rasch ein »Werde«, immerhin der erste Schritt für einen Anfang. Alles Weitere erforderte harte Arbeit und Durchhaltevermögen. Essen nach 16.00 Uhr, ab dem Zeitpunkt der Kampfansage, ein absolutes Tabu. »Bis dahin kann ich mir einverleiben was ich will. So ist kein Verzicht nötig und der Jo-Jo-Effekt bleibt auf Dauer aus!«, so zumindest die Theorie.
»Beschlossene Sache, denn wer nicht wagt, der ohnehin niemals gewinnt!«
Die Option des zweiten Siegers eröffnete sich zwar generell, aber jetzt war es unumstößlich Zeit sich zu metamorphosieren. Sich ohne jeglichen Versuch in die Schublade des Verlierers packen zu lassen stand mir sowieso nicht. Und in die Kategorie »Dickes Hühnchen mit X-Beinen« sollte mich niemand mehr einen einzigen Tag länger einordnen können!
Abnehmen an sich fand ich mit ausreichender Wasserzufuhr, gutem Salz, mehr Bewegung und dem Verzicht auf jegliche Speisen nach vier Uhr nachmittags, nicht schwer, das Gewicht auf Dauer zu halten dafür umso mehr. Der innerliche Schweinehund, der mich zwingen wollte zwei Tafeln Schokolade schlagartig in mich zu stopfen, einen Liter Fanta, mit drei Strohhalmen gleichzeitig, auf einen Satz auszusüffeln oder mir mitten in der Nacht das dickste XXL McDonalds-Menü einzuverleiben, war zwar in manchen Minuten extrem stark, doch dank Bananenchips mit Honig und Kokosfett, hin und wieder in flüssige Zartbitterschokolade getaucht, besiegte ich alle anfänglichen nächtlichen Fressattacken. Innerhalb von sechs Wochen speckte ich knapp 29 Kilogramm ab und hielt mein Gewicht dauerhaft.
Eine ausgiebige Shopping-Tour, als Belohnung für all die harten Mühen, setzten dem Schlabber-Look, den mein Kleiderschrank seit dem Gewichtsverlust ausspuckte, und der überhaupt nicht mein Ding war, schnell ein Ende…
Abery war heilfroh, dass ich ihr Unterstützung bot, sie ermöglichte, was nur ging. Aber mit Eintritt der Volljährigkeit, zumindest auf Papier, wurde ich langsam flügge. Mit meinem neuen »Ich« sichtlich zufrieden, lernte ich Sims kennen und nur drei Monate nach meiner Ausbildung zur Kinderpflegerin, mit knapp 19 Jahren, wurde ich von ihm schwanger. Mein eigenes kleines Familienglück nahm seinen ersten Anfang...
Acht Monate später, hochschwanger, zog ich aus dem kleinen Zimmer bei Abery aus. Der Einzug in die neue Wohnung, nur 300 Meter entfernt, ersparte zwar hohe Transportkosten, ich blieb weiter rund um die Uhr erreichbar, am nachbarlichen Umfeld änderte das aber herzlich wenig. Einen Katzensprung weiter, zwei Blocks um die Ecke, zweites Obergeschoss links, in einem hohen Plattenbau-Mehrfamilienhaus, sollte sich unser neues zu Hause finden. Keine exquisite Dauerlösung, für den Anfang aber ein angenehmer Übergang. Nach vorgenommener Grundsanierung durch den Vermieter ging der Umzug, dank mehrerer Helfer, die fleißig mit anpackten und zahlreiche Schweißperlen verloren, gut über die Bühne. Mein Hab und Gut fand zügig Platz im neuen Heim. Einrichten wollte ich alleine, in Ruhe. Ich musste und wollte mich hier wohlfühlen…
...und der Geburtstermin rückte von Stunde zu Stunde näher. Mein Frauenarzt, Dr. Bara, der den 23. November 2007 errechnet hatte, erwischte den Fötus bei fast jeder Vorsorgeuntersuchung, die im Abstand von vier bis sechs Wochen, zur reinen Routine stattfanden, mit seinem linken Zeigefinger in der Nase bohrend. »Das wird mal ein Piniebelchen, eine ganz strenge Beamtin«, scherzte Dr. Bara gerne. Meinen Frauenarzt kenne ich, seitdem ich 14 bin. Trotz seiner rabiaten Artikulationsweise, die zweifelsohne Nerven aus dickem, undurchdringlichem Stahl erfordert, bleibt er mir sympathisch. Er hatte mir damals die erste »Anti-Baby-Pille« verschrieben, von der sich mein ansonsten eher ebenmäßiges Hautbild wie ein, mit bunten Zuckerperlen überzogener, Streuselkuchen zierte. In seiner Praxis fühle ich mich, neben den fürsorglichen Sprechstundenhilfen und einem großen Labrador, der für jede Patientin den persönlichen »Angstentzieher« spielt, bestens aufgehoben…
Jede geleerte Kiste verlieh der Wohnung eine weitere individuelle Note. Das Kinderzimmer-Mobiliar bestellte ich im Internet. Es wurde zwei Wochen nach dem Einzug geliefert. »Gestrichen wird erst, wenn ich mein Baby in den Armen halte!«, gab es für mich keine Wiederrede. Obwohl mir Dr. Bara zu 97 Prozent versicherte, dass ich ein Mädchen gebären würde, vertraute ich nicht auf seine »Wahrscheinlichkeitssichtung«, zu oft wurde mir durch Freundinnen das Gegenteil bewiesen, deren Babys ihr Geschlechtsteil bis zum Tag der Geburt fabelhaft versteckten und am Ende die kleine, aber feine Überraschung lieferten. Und da blieben immerhin diese ungewissen drei Prozent. Ich hielt es für hirnrissig, die Wände in einem sanften Rosa-Ton zu bemalen und womöglich im Anschluss einen Jungen zur Welt zu bringen.
»Und bei meinem Glück…«
Die Tage, in denen die Hüftkugel mehr und mehr wuchs, vergingen. Liegen oder Schlafen auf dem Rücken, ein Ding der Unmöglichkeit, »little Buddha«!
»Auch die Wassereinlagerungen in den Beinen werden, trotz der wöchentlichen Akupunktur, kein bisschen weniger. Und die Wohnung sollte bis zum geplanten Geburtstermin fertig eingerichtet sein«, versuchte ich mich abzulenken…
Am 22. November, mit Einbruch des Winters, einen Tag vor dem errechneten Geburtstermin von Dr. Bara, wurde Lee Sophia geboren. Es war ein Donnerstagabend, 22.31 Uhr, als Hebamme Heidi, Sims und mir zu unserem kleinen Mädchen, das 51 Zentimeter groß und 2840 Gramm schwer war, gratulierte. Dicke Schneeflocken fielen vom Himmel, während marode Straßenlaternen, flackernd, die dunkle Krankenhaus-Gasse erhellten. »Keine Menschenseele auf der Straße, weit und breit nicht.«
Nach 17-stündigem Spektakel, mehreren Wehenhemmern und Wehenförderern, war es schlussendlich soweit: Sims schnitt die lederartige, blutgefüllte Nabelschnur durch. Dem Schneideverhalten nach zu urteilen dürfte sich das in etwa mit dem Durchtrennen eines stabilen, fest ineinander verwebten Kokosstricks gleichstellen lassen haben. Da ich am Tag der Geburt, in den frühen Morgenstunden, einen Blasensprung erlitt und bis dato nicht eine einzige Wehe verspürte, zugegeben eine Traum-Schwangerschaft, mussten mir die Ärzte wehenfördernde Mittel spritzen. Innerhalb einer Stunde entwickelten sich die Senkwehen so heftig, ich hätte Sims vor Schmerzen fast seinen linken Daumen, aus der Gelenkpfanne des Handgelenks, ausgekugelt, nicht zu vergleichen mit natürlichen Wehen, dass die Geburtshelfer gezwungen waren, mir wieder Wehenhemmer zu verabreichen. Und kaum hatten die unerträglichen Schmerzen etwas nachgelassen, stand ich schnurstracks vor dem nächsten Problem: Lee steckte, aufgrund der raschen Öffnung des Geburtskanals, in meinem Beckenboden fest. »Sie sollten jetzt unbedingt Treppen steigen«, meinte eine Geburtshelferin der Station. »Treppensteigen, mit derartigen Schmerzen?«, fragte ich entsetzt. »Gibt es denn keine andere Möglichkeit?«, schoss es hintennach. »Nein, die gibt es nicht!«, erwiderte sie nur streng. Mir bot sich keine andere Wahl, als ramme mir jemand das Messer in den Rücken, täte ich es nicht…
Treppe für Treppe fühlte ich die Intensität des Schmerzes. Er schien nicht nachzulassen, sich dafür Stufe für Stufe immer weiter zu intensivieren. Nach rund einer Stunde Wandertour durch das gesamte Krankenhaus, Treppe auf - Treppe ab, insgesamt 1 167 Stufen, Gang hinauf - Gang herunter, watschelte ich völlig erschöpft, im Ententempo, zurück in Richtung Kreissaal, wo Hebamme Heidi schon mit einem warmen Entspannungsbad, in der großen gelben Babybadewanne, vergleichbar mit einem Auffangbecken für Baby-Wale, auf mich wartete.
»Baden, jetzt?«
»Niemals!«
»Nichts schlimmer als das!«
Von dem Gedanken, was dabei alles neben mir im Wasser umherschwimmen würde, ganz abgesehen, wäre warmes Wasser jetzt sowieso unerträglich, nicht im Geringsten entspannend, einfach nur ekelhaft!
16 Stunden Wehen zerrten schließlich so an meinen körperlichen Kräften, dass ich mich für eine Periduralanästhesie (PDA) entschied. Auch an Lee Sophia zogen die Strapazen nicht spurlos vorüber und so wurde es Zeit, dass sie endlich geboren wurde…
Im Erstgespräch mit dem leitenden Chefarzt der Station, Dr. Harald Tuber, der mir die vorherige Unterzeichnung der Dokumente empfahl, hatte ich die Erlaubnis für einen Eingriff in das Rückenmark nicht gegeben. Zu fest war ich überzeugt, die Geburt würde auf natürlichem Wege vonstattengehen. Ich lehnte ab. Und ohne Unterschrift kein Eingriff!
Gezwungen, die Unterlagen in den Wehen samt höchster Schmerzen zu unterzeichnen, fing Dr. Tuber an, mich über sämtliche Risiken und Nebenwirkungen der Spritze aufzuklären, die meinem Rückenmark Schaden zufügen oder mich für mein gesamtes Leben lang gelähmt bleiben lassen konnten, was mir aber zu diesem Zeitpunkt relativ egal gewesen sein dürfte. »Unterschreiben…«, das Einzige was zählte. »Und warum, verdammt nochmal, dauert das so unglaublich lange?«, keifte ich schmerzdurchdrungen vor mich hin. Die Liste der Risiken und Nebenwirkungen, die der Mann in weißem Kittel langsam und gemächlich vor sich hin stotterte, glich der einer Medikamenten-Packungsbeilage. Ob er selbst durchblickte, was er da alles babbelte?
»Lesen Sie gefälligst schneller, ich habe Schmerzen und bin hier nicht auf Kaffeefahrt!«, zogen sich die wenigen Minuten schier endlos. Endlich drückte er mir den schwarz-goldenen Kugelschreiber, seine Initialen, »H. T.« eingraviert, in die rechte Hand. Ich verlor keine Sekunde und setzte ein wirres Gekritzel drunter.
»Unterschrift ist Unterschrift…«
Dann ging es auch schon los. Großräumig ein Pflaster um den Stichkanal geklebt, mit einem, in die hellblaue Brühe getränkten, Tupfer desinfiziert und die lange, sterile Nadel ins Rückenmark eingeführt.
»Knack…, knack…, ratz…«
Zuerst verspürte ich einen kleinen Piks, der sich kurz danach in einen auszuhaltenden Druck verwandelte. Knapp zwei Minuten später fühlte ich, wie die starken Schmerzen der letzten Stunden endlich, gemächlich aber sicher, nachzulassen begannen. Bisher fühlte es sich an, als würde man mir mit der Faust die Gedärme aus dem Unterleib herausquetschen wollen, Organ für Organ, angefangen mit einem bedeutenden Teil des Dünndarms…
»Wohl von Ihrer Frau das noble Teil?«, fragte ich sichtlich erleichtert. »Was, wer?«, starrte Dr. Tuber in den Schreiber des Langzeit-EKGs, der den körperlichen Zustand des Ungeborenen offenbarte. »Na, der edle Kugelschreiber«, gab ich, schon völlig benommen, von mir. Dann entfernten sich die Stimmen der Personen im Raum reihum. Dumpf hörte ich Hebamme Heidi noch sagen: »Ich denke die PDA war die Lösung…«
Wenige Minuten und einige Presser später, die mir mit einem Mal wie ein einfacher Toilettengang vorkamen, hielt ich Lee fest in meinen Armen und war den Tränen geweiht. Dass das weiße T-Shirt mit Toten-kopf-Aufdruck, welches ich am besagten Tag trug, völlig blutverschmiert war und der Vater des frischgebackenen Mädchens beinahe die eigentliche Geburt verpasst hätte, da er nach der ganzen Anfangstortur, einsam und verlassen, im Aufenthaltsraum seinen leeren Magen stärkte, interessierte gerade niemanden mehr. Sims schob mich überglücklich, zusammen mit unserer Tochter, aufs Zimmer. Laufen konnte ich nicht, da meine Beine, von der Narkose, vom Becken ab taub waren. Heidi legte mir, für den Fall der Fälle, und solange ich kein Gefühl verspürte, einen Katheter. »Wirklich richtig ekelhaft, dieses Schlauchbeutelzeugs. So muss sich also ein Mann ohne Unterhose fühlen«, wurde mir in diesem Moment bewusst. Wirklich lästig, wenn ständig etwas unkontrolliert zwischen den Beinen hin und her schlenkert…
Die erste Nacht ohne dicke Plauze!«, schlief ich, ohnehin ein Bauchschläfer, sofort erschöpft ein. Dass die nächtliche Ruhe aber von kurzer Dauer blieb, sollte sich schon nach rund einer Stunde, in der es gerade gemächlich in die Tiefschlafphase überging, herausstellen. Die pfiffige Nachtschwester, Inge Forz, riss mit einem Ruck die Tür des Vierbettzimmers, Station 4, auf, drückte auf den Lichtschalter, der das grelle Neonlicht gleich durch den gesamten Raum erstrahlen ließ und fuhr eine weitere Dame herein, Dany. »Bitte betätigen Sie sofort die Nachtglocke wenn Sie Auffälligkeiten bemerken, die Dame hatte eine sehr schwere Geburt!«, hörte ich, im Halbschlaf, Inge von sich geben. Prompt fing das Baby der anderen Bettnachbarin an zu schreien. Es wurde durch das grelle Licht geweckt. Dany schien narkotisiert zu sein. Sie jedenfalls schlief tief und fest. Mit meinem nächtlichen Schlaf war es vorerst vorbei. Es dauerte nicht lange und Schwester Inge trat erneut durch die Türschwelle. Diesmal brachte sie Lee, die hungrig war. Ich wusste es nicht auf Anhieb mit dem Stillen anzustellen und bat höflich um Hilfe. Ein mürrischer, strenger Blick, ein tiefes, genervtes Räuspern, zu war die Tür. Jede weitere Erklärung offensichtlich unnötig. Sie drückte mir nach 15-minütiger Wartezeit, in der Lee wie eine hungrige Hyäne brüllte, eine Flasche erwärmte Fertigmilch in die Hand. »Oh, nicht gerade die feine englische Art, dafür die einfachste Lösung!«, wusste ich ohne Zweifel. Die ersten beiden Nächte, nicht mehr als zwei Stunden Schlaf am Stück gegönnt, reflektierten den blanken Horror. Jedes Mal, wenn ich gerade in meine tiefsten Träume sank, in Richtung Schlummerland reiste, und das fiel mir wegen der ungemütlichen, starren Matratzen alles andere als leicht, wurde ich aus irgendeinem Grund wieder geweckt. Die dritte Nacht verlief nicht wesentlich besser und so war ich heilfroh, als ich das Krankenhaus, gemeinsam mit Lee nach vier Tagen verlassen durfte. Heidi betreute uns weiterhin zweimal die Woche mit guten Tipps per Hausbesuch…
Lee war ein braves Baby, das viel schlief und wenig schrie. Das erleichterte mir die Umstellung in der Anfangszeit erheblich. Das erste halbe Jahr verging mit einem Fingerschnipsen und sie wuchs zu einem hübschen, blonden Mädchen mit großen, blauen Knopfaugen heran. Jedem, der sie im Kinderwagen sitzen sah, zauberte es ein Lächeln über die Lippen. Und als die Zeit des Stillens nach über fünf Monaten endlich endete, wohlbemerkt funktionierte es sowieso nie richtig, verspürte ich eines lauen Sommerabends den Drang nach sofortiger Unternehmung. Mit meinen beiden besten Freundinnen, Ela und Sabina, war ich seit über einem Jahr nicht mehr shoppen, Kaffee trinken oder feiern gewesen…