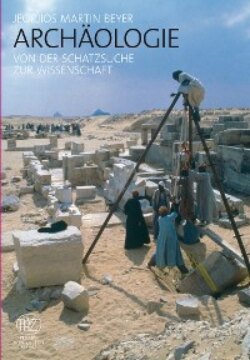Читать книгу Archäologie - Jeorjios Beyer - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Entdeckung der antiken Kunst
ОглавлениеRenaissance und Barock
Die Wiederentdeckung der Antike erfuhr mit dem „Humanismus“ des 14. Jhs. einen entscheidenden Schub. Dichter wie Dante (1265–1321), Petrarca (1304– 1374) und Boccaccio (1313–1375) haben mit ihren epochalen Werken den Weg vorgeprägt, der die Antike und ihre Kulturleistungen als Leitstern für die folgenden Jahrhunderte definierte. Dabei spielte die Loslösung des Studiums der alten Schriften aus dem Kontext der kirchlichen Deutungshoheit eine entscheidende Rolle. Sie führte in letzter Konsequenz auch zu einer Etablierung des Individuums als Maßstab, zur Herausbildung eines anthropozentrischen Weltbildes, das die mittelalterliche theozentrische Vorstellung von der Ordnung der Welt ablöste. Diese radikalen Veränderungen betrafen auch das Menschenbild.
Die Befreiung des Einzelnen aus dem Kollektiv, der Leistungsgedanke, der auf dem agonistischen Prinzip der Antike aufbaute, das neue Selbstbewusstsein der Städte als Hort der Kultur, die Rückbesinnung auf die naturgetreuen Darstellungsformen besonders des menschlichen Körpers, der nun auch im wörtlichen Sinne zum Maß aller Dinge wurde, dies alles sind Zeugen eines der entscheidenden Paradigmenwechsel der europäischen Kulturgeschichte. Sie alle werden in geradezu monumentaler Weise in einem der wohl bekanntesten Bilder der Renaissance sinnfällig in Szene gesetzt: L’uomo Vitruviano („der vitruvianische Mensch“), einer 1492 entstandenen Proportionsstudie Leonardo da Vincis (1452–1519).
Studieren, Nachahmen, Ergänzen
Besonders in Italien hatte seit dem Ende des 12. Jhs. das zunehmende Interesse für Kultur und Kunst der Antike auch die konkrete Beschäftigung mit den Artefakten zur Folge. Die Bildende Kunst setzte die Themen der antiken Mythologie und Geschichte um und nutzte dabei die „Anschauung“. Die Entwicklung der Hinwendung zu einem konkreteren Studium der Antiken lässt sich hervorragend anhand der Künstlerbiographien des Malers und Architekten Giorgio Vasari (1511–1574) nachzeichnen.
Am Beginn der Beschäftigung stand die Nachahmung. Und hier reicht der Arm bis ins Mittelalter zurück. Eines der zahlreichen Beispiele für diese Neuorientierung ist der Bildhauer und Architekt Nicola Pisano (1205/7–1278). Er hatte mit den Skulpturen am Baptisterium in Pisa und am Dom von Siena neue Maßstäbe gesetzt. Von ihm berichtet Vasari: „Nicola [Pisano] beachtete die Schönheit dieses Werkes [Meleagersarkophag, Pisa], und da es ihm vor allem wohl gefiel, wandte er großen Eifer und viel Fleiß auf, dieses und einige andere gute Skulpturen jener antiken Marmorsärge nachzuahmen, wodurch er bald als der beste Bildhauer seiner Zeit gerühmt wurde“ (G. Vasari, Lebensläufe [Edizione Giuntina] II 59).
Der Weg der Wiederentdeckung der Antike als ästhetisches Ideal ist gepflastert mit den großen Namen der Zeit: Lorenzo Ghiberti, Donatello, Andrea Mantegna, Andrea del Verocchio, Raffael, Bramante oder Michelangelo. Ihrer eigenen künstlerischen Betätigung ging in den meisten Fällen ein durchaus konkretes Studium der antiken „Vorbilder“ voraus. So ist von Ghiberti, Raffael und Bramante bekannt, dass sie „unermüdlich“ und „mit großem Eifer“ die antiken Kunstwerke studierten, Mantegna erhielt bereits sehr früh Unterricht anhand von Gipsabgüssen nach Antiken und Donatello und Verocchio ergänzten sogar antike Skulpturen.
Von Michelangelo erzählt Vasari eine bemerkenswerte Anekdote: Nachdem dieser für seinen Mäzen Lorenzo de Medici die Nachbildung eines schlafenden Cupidos nach antikem Vorbild geschaffen hatte, schlug ihm Lorenzo vor, die Skulptur so zu färben und zu behandeln, dass es antik aussehe und als Original verkauft werden könne. Zum Spaß – und ohne Lohn – ging Michelangelo auf dieses unlautere Angebot ein, mit dem Ergebnis, dass das Stück als antikes Original in die Sammlung eines römischen Kardinals verkauft wurde. Als dieser den Betrug entdeckte, musste der Händler die Kaufsumme zurückerstatten. Dem jungen Michelangelo jedoch entstand kein Schaden; vielmehr wurden seine besonderen Talente anerkannt. Zeugt dieser Vorfall zunächst vom Wert, den Sammler in der Renaissance den antiken Kunstwerken zumaßen, so belegt er gleichzeitig auch die enormen „praktischen“ Kenntnisse der Renaissancekünstler im Umgang mit den Antiken. Antike Skulpturen waren also nicht nur Vorbild, sondern auch Messlatte.
Die Grundlage für die Beschäftigung mit der Antike bildete weiterhin die Kenntnis der antiken Kunstschriftsteller. Man nutzte nicht nur die Schriften des Vitruv, das antike Standardwerk zur Architektur, man las die antiken Dichter und Literaten – und man kannte sie auswendig. Besonders deutlich wird dies am Beispiel der Auffindung einer der wohl bekanntesten antiken Skulpturen, der Laokoon-Gruppe, im Jahre 1506. Die hinzugezogenen Michelangelo und Giuliano da Sangallo (um 1443–1516) erkannten sofort in dieser das von Plinius d. Ä. (ca. 23–79 n. Chr.) beschriebene Werk.
Nicht bei allen Künstlern der Renaissance steht die konkrete Nutzung antiker Kunstwerke im Zentrum. Ausgerechnet Leonardo da Vinci stellt eine andere Facette der Auseinandersetzung mit den antiken Traditionen und Vorbildern dar. Er lässt sich zwar allgemein von den Ideen der griechischen und römischen Epoche inspirieren, sucht aber immer eigene Wege der Gestaltung. In seinem Traktat über die Malerei wird die Antike mit keinem Wort erwähnt. Sicherlich ist dies aber auch der noch nicht vorhandenen Kenntnis antiker Gemälde, wie etwa der Malereien von Pompeji und Herculaneum, geschuldet. Leonardos Eigenständigkeit steht in starkem Kontrast zu der weit verbreiteten Tendenz, die antike, idealisierte Formensprache zu imitieren oder doch zumindest nachzuempfinden, ja er formuliert seine grundsätzliche Ablehnung der Suche nach Vorbildern ausgesprochen deutlich: „Ein Maler soll niemals die Manier eines anderen nachahmen.“
Abb. 7: Raffaels 1510/11 entstandenes Fresko „Die Schule von Athen“ zeigt eine ganze Reihe antiker Geistesgrößen im Diskurs. In diesem Wandbild wird der außerordentliche Grad der Bewunderung für die griechische Kultur, vor allem für die Philosophie, als Wiege der eigenen Kultur besonders evident.
Auf dem Weg zur „antiquarischen Wissenschaft“
Der Erste, der sich aus vorwiegend wissenschaftlichen Beweggründen dem Studium der Antike zuwandte, war Flavio Biondo (1392–1463). Für Gregorovius ist Biondo der „Gründer der Archäologie“, der „antiquarischen Wissenschaft“. Neben anderen verfasste er 1446 ein Werk mit dem Titel Roma instauratä („Das wiederhergestellte Rom“). In diesem versucht er nicht nur eine Rekonstruktion der antiken Topographie Roms, sondern macht auch Vorschläge zur Wiedergewinnung des Verlorenen. Als einer der Ersten teilte er die Aufgaben der antiquarischen Altertumskunde in drei Bereiche ein: die analytische Untersuchung der geschichtlichen Rahmenbedingungen, die geographische Prospektion und die Topographie der Monumente.
Die antike Architektur Roms bildete auch für Raffael (1483–1520) einen zentralen Bezugspunkt (Abb. 7). Eine ganze Reihe von Bauwerken – etwa die Maxentiusbasilika, der Argentarierbogen oder das Pantheon – und Motive von der Trajanssäule und der „Domus Aurea“ erscheinen in seinen Bildern. Als Oberaufseher der römischen Altertümer war er seit 1515 gewissermaßen offiziell mit der Pflege und Erforschung der antiken Kulturgüter befasst (s. Info). Die wissenschaftliche Genauigkeit, mit der er seine Studien zu den antiken Monumenten betrieb, zeigt sich auch bei der Nutzung antiker Fachbücher zur Architektur, wie Vitruvs zehn Bücher zur Architektur oder die Abhandlung über Aquädukte des Frontinus (ca. 40–103 n. Chr.): In mehreren Fällen konnte er anhand des Vergleichs der Ausführungen mit den erhaltenen Bauten sowie durch exakte Messungen Fehler der antiken Autoren korrigieren.
Die von Raffael vorgenommene Vermessung der Denkmäler Roms wurde in genauen Plänen und Zeichnungen festgehalten, die ebenso detailgetreu wie anschaulich sein sollten. Autopsie und konkrete Umsetzung erfolgten dann durch den Architekten und Maler Pirro Ligorio (1513–1583), dessen Pläne in großen Partien erhalten sind. Dieser führte zudem für den Kardinal Ippolito II. d’Este (1509– 1572) anlässlich der Errichtung der Villa d’Este Grabungen im Bereich der Villa Hadriana in Tivoli durch. Wie Ligorio wurden auch andere „Hofantiquare“ meist beauftragt, im Rahmen der Planung und des Baus neuer Schlösser Sondierungen und Grabungen vorzunehmen.
Ohne die Vorarbeiten Raffaels und die von ihm angestoßenen kritischen Studien des Vitruvtextes wäre ein bedeutender Teil der Renaissancearchitektur, etwa die des Andrea Palladio (1508–1580), kaum denkbar. Und so liest sich auch der Titel des unter der Ägide Raffaels entstandenen Berichts zu den antiken Denkmälern Roms mit dem Titel Roma instauranda („Das wiederherzustellende Rom“) wie ein Programm: Die Erweckung der Antike als Leitkultur in der Renaissance.
In einem Brief Raffaels an Papst Leo X. zeigt sich der ganze denkmalpflegerische Elan des Künstlers deutlich – gleichzeitig aber auch die ungebrochen anhaltende „Nutzung“ des antiken Baumaterials. Im Fortgang der hier zitierten Passage kommt Raffael auf seine Vermessungsarbeiten zu sprechen, die neben denen Leon Battista Albertis auch Grundlagen schufen, nach denen in der Renaissance und im Barock Bauwerke geplant wurden.
„Wie viele Päpste, Heiliger Vater, ... haben den Ruin und den Verfall der antiken Tempel zugelassen, und der Statuen, der Triumphbögen und der übrigen Bauwerke, die den Ruhm ihrer Erbauer darstellen? Wie viele haben veranlasst, dass allein zur Beschaffung von Vulkanerde unter den Fundamenten gegraben wurde, wodurch die Gebäude in kürzester Zeit eingestürzt sind? Wie viel Kalk ist aus Statuen und anderem antiken Schmuck gebrannt worden? So dass ich sogar sagen würde, dass dieses ganze neue Rom, das man jetzt sieht, wie groß es auch sei, wie schön, wie sehr mit Palästen, Kirchen und anderen Gebäuden geschmückt, mit Kalk erbaut ist, der aus antiken Marmorsteinen gebrannt ist. Und ich kann mich auch nicht ohne große mitleidige Erregung daran erinnern, wo doch, seit ich in Rom bin, noch keine 12 Jahre vergangen sind, dass viele schöne Dinge zerstört worden sind, wie die Zielsäule, die sich in der Via Alexandrina befand, der Bogen, der am Eingang zu den Thermen des Diokletian stand, der Tempel der Ceres an der Via Sacra, ein Teil des Forum transitorium, das vor wenigen Tagen verbrannt und zerstört worden ist ... Außerdem sind viele Säulen zerstückelt und entzweigebrochen worden, so viele Architrave, so viele schöne Friese sind zerbrochen, dass es wirklich eine Schande dieser Tage gewesen ist, das zugelassen zu haben.“
Brief Raffaels an Papst Leo X. aus dem Jahr 1519.
Die enorme Bedeutung Vitruvs für die Architektur der Renaissance zeigt auch, dass die nach seiner Wiederentdeckung – Vitruvs Schriften waren auch in der Spätantike und im Mittelalter durchaus bekannt – im 15. Jh. schnell eine ganze Reihe von Kopien und Drucken erschienen, die bald durch illustrierte Fassungen ergänzt wurden. Die bekannteste unter ihnen, die 1521 erschienene italienische Ausgabe von Cesare Cesariano, wurde umgehend auch in andere Sprachen übersetzt. Mehr noch: Leon Battista Alberti (1404–1472) verfasste 1452 mit dem zehnbändigen Werk De re aedificatoria („Über die Baukunst“) ein eigenes Handbuch zur Architektur nach Vorbild des Vitruv. Vor der Etablierung des Vitruv. und dem Erscheinen von Albertis Handbuch gestaltete sich die Orientierung an den antiken Vorbildern ausgesprochen schwierig. Von Filippo Brunelleschi (1377–1446), dem berühmten Erbauer der Kuppel des Florentiner Doms, ist etwa bekannt, dass er sogar Grabungen unternahm, um verschüttete antike Bauglieder zu entdecken, anhand derer er die idealen antiken Proportionen zu rekonstruieren hoffte; die Grabungen trugen ihm in der Bevölkerung sogar den Vorwurf ein, er sei ein Schatzgräber.
Auch in der Folgezeit beschäftigten sich Künstler mit dem antiken Erbe. Allerdings ist eine Tendenz deutlich spürbar: Der enge Bezug zwischen dem „Künstler“ und dem „Forscher“, wie er in Brunelleschi oder Donatello (um 1386–1466) aufscheint, löst sich auf. Die Trennung dieser beiden Bereiche ist evident, und es gibt nicht wenige Beispiele, die ihre künstlerische Tätigkeit nur noch neben der wissenschaftlichen Betätigung ausüben.
Dieser Bruch, die Isolierung der wissenschaftlichen Betätigung von der künstlerischen Umsetzung, verlief selbstverständlich nicht linear. Es gab noch stark in der Tradition der Antike verhaftete Künstler, so z. B. in der Familie Caracci. Agostino Caracci (1557–1602), wie sein Bruder Annibale (1560–1609) und sein Cousin Ludovico (1555–1619) Maler, soll während eines Vortrags über den Laokoon zur Illustration eine Zeichnung der Skulpturengruppe an die Wand des Saales geworfen haben.
Rubens und Poussin
Zu den zentralen Figuren dieser künstlerischen Auseinandersetzung mit der Antike zählen Maler wie Peter Paul Rubens (1577–1640) und Nicolas Poussin (1594– 1665). Für Rubens bildete die Beherrschung der lateinischen Sprache die Basis seiner künstlerischen Tätigkeit. Gleichzeitig zeichnete er aber auch viel nach Antiken (Abb. 8). Seit seiner Italienreise begann er darüber hinaus zu sammeln, ja er schuf für seine Stücke in einem dem Pantheon nachempfundenen Kuppelbau einen musealen Ort.
Das besondere antiquarische Interesse Rubens’ spiegelt sich v. a. in seiner Korrespondenz. Mit dem Gelehrten Nicolas Claude Fabri de Peiresc (1580–1637) setzte er sich über die verschiedensten Themen auseinander, diskutierte etwa anhand von Stichen Funktion und Bedeutung von Dreifüßen (s. Info). Peiresc hat sich, obwohl er selbst nichts publiziert hat, große Verdienste als Multiplikator und Verbreiter wissenschaftlicher Erkenntnisse erworben und zählte zu den bekanntesten Altertumsforschern der Zeit. Er war gewissermaßen das Musterbeispiel eines Antiquars, dessen oberste Maxime das beständige Zusammentragen von antiken Gegenständen und Manuskripten – zuweilen auch nur in Kopien – war. Wie viele andere Zeitgenossen auch interessierten ihn dabei v. a. tragbare, also mobile Kunstgegenstände.
Abb. 8: Rubens’ „Studien nach dem Kopf des Laokoon“ (1628/39), Feder in brauner Tusche, schwarze Kreide und Rötel. Kopenhagen, Statens Museum for Kunst.
Rubens äußerte sich zur antiken Kunst beinahe ausschließlich in seinen Briefen. Seine erst im Jahre 1766 veröffentlichte Abhandlung De imitatione statuarum ist zunächst eine praktische Anleitung, wie Plastik in Malerei umzusetzen sei. Immerhin finden sich darin aber auch Aussagen zur ästhetischen Perfektion und zum Vorbildcharakter antiker Skulptur, ohne deren Kenntnis man laut Rubens nicht zur Vollendung in der Malerei kommen könne.
Das Interesse des Vaters an den antiken Denkmälern führte dazu, dass sein Sohn, Albert Rubens (gest. 1657), sich mit Haut und Haaren dem Studium der Antike verschrieb. Im Jahre 1665 wurden seine Untersuchungen posthum in dem umfangreichen Werk De re vestiaria ediert. Mit der Abhandlung Dissertatio de Gemma Augustea zollte er dem Vater Ehre, der dieses berühmte Stück in Zeichnungen nach einem Abguss dokumentiert und selbst ein Werk über antike Gemmen geplant hatte.
Nicolas Poussin (1594–1665) vereinigte gewissermaßen wissenschaftliche Recherche mit künstlerischer Umsetzung. Das intensive Studium antiker Autoren führte z. B. zur Illustration von Ovids Metamorphosen. Die systematische Lektüre wurde dabei ergänzt durch die Beschäftigung mit den antiken Denkmälern. Selbst wenn konkrete Übernahmen antiker Motive in seinen Werken kaum nachzuweisen sind, so sind sie doch in Aufbau, Form und Komposition der Figuren antiken Traditionen verpflichtet. Darüber hinaus hat Poussin auch nach Antiken gezeichnet. Die historische Detailgenauigkeit von Architektur, Kleidung, Waffen und sonstigem Gerät der Studienblätter zu antiken Denkmälern findet auch in seinen Bildern ihren Niederschlag (Abb. 9). Viele dieser Zeichnungen entstanden im Auftrag von Cassiano dal Pozzo (1589 oder 1590– 1657), wie etwa eine farbige Kopie des neu gefundenen Nilmosaiks in Palestrina. Durch dal Pozzo erhielt er auch Zugang zu den neuesten Funden aus den christlichen Katakomben Roms, die durch Antonio Bosios (1575–1629) Buch Roma sotteranea („Das unterirdische Rom“) aus dem Schlummer des Vergessens geholt worden waren. Letzterer kann, trotz aller sachlichen Mängel seines erst postum erschienenen Werkes, durch seine systematische Erforschung und Dokumentation der bis dahin weitgehend unbekannten Katakomben als Wegbereiter der Christlichen Archäologie gelten.
In vielen Fällen dienten Briefe der Diskussion strittiger Fragen in der Bewertung und Identifizierung antiker Kunst. Ein in der Forschung gern angeführtes Beispiel ist ein Brief Peter Paul Rubens’ an seinen Freund Nicolas Fabri de Peiresc. Rubens hat von diesem eine Sendung mit präzisen Zeichnungen eines antiken, in einem Neptuntempel gefundenen Bronzedreifußes erhalten. In seinem Antwortschreiben teilt Rubens Peiresc ausführlich seine Ansichten über den von ihm käuflich erworbenen Dreifuß mit. Am Ende des Briefes folgt eine Zusammenstellung von Zitaten aus Isidor, Athenaeus, Servius, Pausanias u. a. m., die Rubens’ Sohn Albert zusammengestellt hatte.
„Früher nannte man alle von drei Füßen getragenen Geräte Dreifüße, obgleich sie zu verschiedenen Zwecken, z. B. als Tische, Sitze, Kandelaber, Kochtöpfe dienten. Unter anderen hatten die Alten ein Gefäß, das man auf das Feuer setzen konnte und das zum Kochen des Fleisches diente, wie man es noch heutzutage in verschiedenen Gegenden Europas benutzt. Dann vereinigte man den Kessel mit dem Dreifuß, so wie wir unsere Kochtöpfe von Eisen oder Erz mit drei Füßen herstellen. Aber die Alten haben dieser Kombination sehr schöne Proportionen gegeben, und meiner Ansicht nach ist dies das Gerät, welches wir als den Dreifuß ansehen müssen, von dem Homer und andere griechische Dichter und Historiker sprechen ...
Ich glaube aber nicht, dass der Dreifuß von Delphi von dieser Art war, eher glaube ich, dass es eine Art Stuhl auf drei Füßen war, wie die, derer man sich noch allgemein in Europa bedient. Dieser Dreifuß hatte kein konkaves Becken, oder wenn es konkav war, um darin die Haut des Python zu bewahren, so bedeckte man ihn oben und die Pythia setzte sich auf diesen Deckel, der ein kleines Loch besitzen konnte. Es scheint mir in der Tat unmöglich, dass sie sich auf den Boden des Beckens setzen konnte, da dies wegen der Tiefe und der schneidenden Ränder desselben zu unbequem gewesen wäre.
Es wäre auch möglich, dass man auf diesem Becken, wie auf einer Pauke, die Haut der Pythonschlange ausgespannt hatte, die man deshalb cortina nannte, und dass sie durchbohrt war, ebenso wie das Gefäß. Sicher ist, dass man in Rom mehrere Marmordreifüße findet, die keinerlei Vertiefung haben, und es war mitunter gebräuchlich, wie Sie aus einigen angefügten Zitaten sehen werden, auf diese selben Dreifüße Statuen zu stellen, die verschiedenen Gottheiten gewidmet waren, was nur auf einem flachen und soliden Boden möglich war. Man darf glauben, dass, nach Beispiel des delphischen Dreifußes, man denselben auch für andere Gottheiten benutzte und das Wort Dreifuß alle Arten von Orakeln und heiligen Mysterien bezeichnete ...
Es besteht kein Zweifel, dass dies nicht der Dreifuß ist, der in der Kirchengeschichte des Eusebius und bei anderen Autoren so oft erwähnt wird und der zu den Räucherungen für die Idole diente, wie Sie aus den unten folgenden Zitaten ersehen werden. Und wenn ich mich nicht wiederum täusche, so muss angesichts des Materials, der Kleinheit und Einfachheit der Arbeit Ihres Dreifußes derselbe einer von denen sein, die zum Verbrennen des Weihrauches bei den Opfern dienten. Das Loch in der Mitte diente als Zugloch, um die Kohlen besser anzufachen, indem alle Kohlenbecken, oder wenigstens die Mehrzahl, irgendein kleines Loch zu diesem Zwecke haben. Und so weit man der Zeichnung nach urteilen kann, scheint der Boden des Beckens oder der Schale durchbrochen und vom Feuer angegriffen zu sein.“
Brief Rubens’ an Nicolas Fabri de Peiresc vom 10. August 1630
Abb. 9: Wie intensiv sich Poussin dem Detailstudium widmete, belegt diese Federzeichnung aus dem Jahre 1650. Zu erkennen sind u. a. römische Feldzeichen, ein Tropaion sowie Studien zu Pferdeköpfen, Stiefeln und Waffen. Chantilly, Musée Condé.
Abb. 10: Simon Studion dokumentierte seine Grabungen am römischen Kastell Benningen im Jahre 1597 in einzelnen, perspektivisch angelegten Plänen, in die neben Landmarken als Orientierungspunkten auch einzelne Maße eingezeichnet sind.
Das Zeitalter der Antiquare
Selbst wenn sich die Archäologie im 16. und 17. Jh. nicht mehr ausschließlich auf den Bereich der Kunst konzentrierte, so war sie auch noch nicht eine Wissenschaft im eigentlichen Sinne, denn sie vollzog sich v. a. im privaten Rahmen. Sie war eine „gelehrte Liebhaberei“, mit Enthusiasmus betrieben, aber eher eine Art „schönster Nebensache der Welt“.
Ab Mitte des 16. Jhs. tritt – auch außerhalb Roms – an die Stelle der reinen Sammelleidenschaft vermehrt die systematische Erfassung antiker Denkmäler. In dieser Zeit entstanden zahlreiche umfassende Dokumentationen und Kataloge. In England etwa veröffentlichte William Camden (1551–1632) im Jahre 1586 eine Schrift mit dem Titel Britannia, einen Katalog der sichtbaren Altertümer seiner Heimat. Zu diesem Zweck entwickelte er auf den Vorarbeiten eines gewissen John Leland (1506–1552), Bibliothekar Heinrichs VIII. (1491–1547), eine Vorstufe der heute als Survey bekannten Methode, die sog. peregrinatio.
Für die Entwicklung der Archäologie eröffnete die Arbeit Camdens durch den Einsatz neuer Methoden neue Wege. Als einer der Ersten versuchte er weitestgehend unabhängig von den antiken Überlieferungen den Denkmälerbestand einer ganzen Region zu erfassen. Bemerkenswert ist, dass er bereits Bewuchsmerkmale in einem Kornfeld bemerkte und sie als Hinweis auf darunterliegende antike Fundamente interpretierte. Mit dem methodischen Rüstzeug im Gepäck gelang ihm die erste konzise Darstellung der römischen Epoche in Britannien. Es ist durchaus nicht zufällig, dass der Primat des Gegenstandes vor dem antiken Text, der v. a. der Situation geschuldet war, zu einer Erweiterung der Untersuchungsmethoden führte – und in der Folge zu einer verstärkten Wahrnehmung der antiken Kunst abseits der klassischen Antike. Camden ist dadurch auch einer der Exponenten der in mehreren mittel- und nordeuropäischen Ländern aufkommenden landeskundlichen Forschung.
In Deutschland löste die Entdeckung der Germania des römischen Historikers Tacitus (ca. 58–166 n. Chr.) im Jahre 1455 einen Boom an Studien zur Geschichte und Kultur des römerzeitlichen Deutschlands aus. Auch hier konzentrierte sich die Auseinandersetzung nicht nur auf die literarische Überlieferung, sondern zunehmend auch auf die Inschriften, die allenthalben vor Ort zu finden waren, v. a. aber in den ehemals römischen Städten an Rhein und Mosel, in Mainz, Köln und Trier. Zu den wichtigsten Vertretern der regionalen Altertumsforschung zählen die Humanisten Dietrich Gresemund (1477–1512), Beatus Rhenanus (1485– 1547) und Johannes Huttich (1487–1544), aber auch Johann Georg Turmair, besser bekannt als Johannes Aventinus, (1477– 1534), der für seine in den Jahren 1526– 1533 entstandene Chronik Bayerns explizit darauf verwies, dass er auch „heiligtumb, monstranzen, seulen, creuz, alte stein, alte münz und gräber“ der Römerzeit für seine Studie heranziehen wolle. Logische Konsequenz der Etablierung der regionalen Studien war auch das Einsetzen mehr oder weniger systematischer Ausgrabungen im 16. Jh. Als einer der Ersten trat der „Vater der württembergischen Altertumskunde“ Simon Studion (1543– 1605) in Erscheinung, der das Römerkastell Benningen in Württemberg ergrub und seine Ergebnisse publizierte (Abb. 10).
Die Sehnsucht nach der Auffindung von Skulpturen berühmter griechischer Künstler, die im Boden großer Heiligtümer wie Olympia verborgen seien, war bei vielen Gelehrten des 18. Jhs. präsent. Die Vorstellung fußte dabei v. a. auf den Beschreibungen ganzer Skulpturenareale durch die römische Fach- und Reiseliteratur:
„Hier ist das alte Elis, wo die olympischen Siege gefeiert wurden, wo man eine Unzahl von Denkmälern für die Sieger errichtete: Statuen, Reliefs, Inschriften. Die Erde dort muss geradezu vollgestopft mit ihnen sein. Dabei ist besonders wesentlich, dass meines Wissens dort noch niemand gesucht hat. All das liegt in Eurer Reichweite. Sie könnten dort mit geringen Kosten eine reiche Ernte halten.“
Brief Montfaucons an den Bischof von Korfu und Griechenland, Angelo Maria Quirini, aus dem Jahre 1723.
„Ich kann nicht umhin zum Beschlusse dieses Capitels ein Verlangen zu eröfnen, welches die Erweiterung unserer Kenntnisse in der Griechischen Kunst sowohl als in der Gelehrsamkeit und in der Geschichte dieser Nation betrift. Dieses ist eine Reise nach Griechenland, nicht an Orte, die von vielen besuchet sind, sondern nach Elis, wohin noch kein Gelehrter noch Kunstverstaendiger hindurch gedrungen ist ... Ich bin versichert, daß hier die Ausbeute ueber alle Vorstellung ergiebig seyn, und daß durch genaue Untersuchung des Bodens der Kunst ein grosses Licht aufgehen wuerde.“
Johann Joachim Winckelmann, Anmerkungen über die Geschichte der Kunst des Altertums (Dresden 1767) 83 f.
Nicht nur die Erstellung von „Bestandsaufnahmen“ für einzelne Regionen wie im Falle der Britannia Camdens, auch die bereits gesammelten Informationen zwangen die Forscher dazu, ihr Material neu aufzubereiten und zu gliedern, denn mit der Zeit hatte sich eine Fülle von Einzeldarstellungen zu antiken Denkmälern angesammelt, die kaum ein Gesamtbild zu gewinnen erlaubten. Aus diesem Grund begannen einzelne Forscher mit der Systematisierung der angehäuften Informationen in großen Sammelwerken. Einer der Ersten war der oben genannte Cassiano dal Pozzo. Er führte 2300 Zeichnungen antiker Kunstwerke zusammen und ordnete sie nach Themen. Die systematische Gliederung des Materials durch Cassiano dal Pozzo orientiert sich auch an der durch den antiken Universalgelehrten Varro (116–27 v. Chr.) vorgegebenen Unterteilung in die res divinae und die res humanae, in den „göttlichen“ und den „menschlichen“ Bereich (Abb. 11). Sein Versuch blieb jedoch unpubliziert. Auf diese Vorarbeiten konnten die nachfolgenden Gelehrten zurückgreifen. So entstanden eine ganze Reihe umfangreicher Materialsammlungen, darunter die Thesauri der Niederländer Jacob Gronovius (1645–1702) und Johann Georg Graevius (1632–1703).
Die bedeutendste Erscheinung auf diesem Gebiet war der Benediktinermönch Bernard de Montfaucon (1655–1741, Abb. 12). Neben seiner Tätigkeit als Philologe und Kirchenhistoriker bemühte sich Montfaucon auch um das Studium der materiellen Hinterlassenschaft der Antike. Angeregt durch einen mehrjährigen Aufenthalt in Italien (1698–1701) entschloss er sich zu dem Vorhaben, das „ganze Altertum in seiner sichtbaren Erscheinung“ in einem umfassenden Werk darzustellen. Dazu trug er – wie andere auch – mit großer Energie Bildmaterial aus älteren Publikationen, aber auch unpublizierte Zeichnungen zusammen. Seine eigentliche Leistung besteht jedoch in der Systematisierung des Materials nach inhaltlichen Kriterien.
Das Werk erschien 1719 unter dem Titel L’antiquité expliquée et représentée en figures in zehn Bänden mit ca. 40 000 Abbildungen auf 1200 Tafeln in einer Auflage von 1800 Stück. Es wurde den Händlern aus den Händen gerissen und war bereits nach wenigen Monaten vergriffen. Diese außerordentliche Beliebtheit ist ein beredtes Zeugnis dafür, dass es für jeden an antiken Denkmälern Interessierten zum Standardwerk avancierte. Auch Goethe erwähnt es in seinem Wilhelm Meister. Es folgten Neuauflagen und Supplementbände.
Montfaucon war jedoch nicht nur der Sammler, der in seinen Werken, das Wissen seiner Vorgänger zusammentrug und systematisierte. Am Ende seines Lebens schlug er – angesichts der gerade aktuellen Entdeckungen in den Vesuvstädten Pompeji und Herculaneum – in einem Brief vor, das antike Olympia auszugraben, ein Vorhaben, das erst nach Winckelmann in die Tat umgesetzt wurde (s. Info).
Die Abkehr vom reinen Sammeln
Das Leben und Streben der Antiquare war bestimmt von philologischen Denkmustern. Letztlich versuchten sie, das antike Material zu ordnen und zu lesen wie einen Text. Beinahe scheint es so, als seien die antiken Relikte nur dazu genutzt worden, Ordnungssysteme nach dem Muster Varros zu erstellen und zu „füllen“. Mit Antiquaren wie Montfaucon befinden wir uns nun endgültig auf dem Weg zur Archäologie als Wissenschaft, als deren Gründungsvater allgemein Johann Joachim Winckelmann gilt.
Wie ein Schlusswort zu den „antiquarisch-archäologischen“ Bemühungen von der Antike bis zum Barock erscheint ein 1747 erschienener Traktat von Joseph Spence (1699–1768) mit dem ausufernden Titel Polymetis: or, An Enquiry concerning the Agreement Between the Works of the Roman Poets, And the Remains of the Ancient Artists. Being an Attempt to illustrate them mutually from one another. In diesem versucht der Autor eine Abkehr von der Gelehrsamkeit der Antiquare, allen voran Montfaucon. Diesen wirft er besonders ihre Pedanterie und ihren „Fleiß“ vor.
Abb. 11: Die systematische Gliederung des Materials durch Cassiano dal Pozzo orientiert sich an der durch den antiken Universalgelehrten Varro (116–27 v. Chr.) vorgegebenen Unterteilung in die res divinae und die res humanae, in den „göttlichen“ und den „menschlichen“ Bereich. Nach C. Dati, Delle lodi del Commendatore Cassiano dal Pozzo orazione, 1664.
Abb. 12: Bernard de Montfaucons Beschäftigung mit der Antike begann nach einer kurzen militärischen Laufbahn mit seinem Eintritt in den Benediktinerorden im Jahre 1676. Hier erlernte er zahlreiche Sprachen, darunter Griechisch, Hebräisch und Syrisch, und betrieb numismatische Studien. Seine Hauptwerke entstanden erst nach dem Ende seines Italienaufenthalts im Jahre 1701.
Um seine Leser zu unterhalten, entwirft Spence ein Gespräch zwischen der Hauptfigur mit dem sprechenden Namen Polymetis („Vieldenker“) und seinen Freunden Musagetes und Philander – bezeichnenderweise in einer Landvilla mit englischem Garten und antikisierenden Parkgebäuden. Das Treffen beginnt mit einer Tasse Tee. Im Laufe des Gesprächs beschäftigen sich die gelehrten Freunde v. a. mit Darstellungen aus der antiken Götterwelt. Als Anschauungsmaterial dienen dabei die in der Villa und den Gärten versammelten Kopien antiker Denkmäler, denn auf diesen Bereich konzentriert sich die Sammlung des Gastgebers. Auch die dokumentarischen Rahmenbedingungen sind für dieses Privatissimum ideal: In den Sockeln sind Schübe integriert, in denen Gemmen, Münzen oder Stiche zur Erläuterung und zum Vergleich aufbewahrt werden. Und so entspinnt sich eine Plauderei über die dort versammelten Statuen, den Apoll von Belvedere, die Venus Medici oder die Niobiden. Die Ausführung der Statuen, ihre Identifizierung und Deutung wird besprochen. Man liest sich antike Autoren vor und kommt dabei auch zur Diskussion anderer Meinungen. So kritisierte Spence sowohl die Deutung einzelner Figuren der Gruppe als auch ihre Aufstellung in den Gärten der Villa Medici in Rom.
Die Abkehr von der Tätigkeit der Antiquare formuliert Spence so eindeutig, wie kaum ein anderer zuvor. In seinen Augen habe keiner mehr Verlangen nach „profound reading“, die Zeit der unübersichtlichen und altmodischen Konvolute sei nun vorbei. Spence stellt sich damit in die Diskussion über das Verhältnis von Antike und Moderne, das unter dem Stichwort der „Querelle des anciens et modernes“ bereits am Ende des 17. Jhs. von Charles Perrault (1628–1703) angestoßen worden war. In einer Sondersitzung der Pariser Académie française im Jahre 1687 hatte dieser ein als „Le Siècle de Louis le Grand“ betiteltes Gedicht vorgetragen, in dem er die künstlerische und zivilisatorische Überlegenheit seiner Zeit über das klassische Altertum postulierte.
Abb. 13: Jean-Baptiste Siméon Chardin, Le singe antiquaire (1740), Paris, Louvre.
Das negative Bild, das die Antiquare hervorriefen, gipfelt in dem berühmten Bild Le singe antiquaire („Der Affe als Antiquar“, Abb. 13), das der französische Maler Jean-Baptiste Siméon Chardin 1740 der Öffentlichkeit präsentierte: Hier erscheint ein in eine zeitgenössische Robe gekleideter Affe, der mithilfe einiger numismatischer Folianten und einer Lupe eine Münze studiert. Im Bild des Affen als Antiquar erscheint ein Wechsel in der Bewertung der Altertumsforschung. War bis dahin der „Antiquarius“ allseits geachtet, so geriet diese Bezeichnung offenkundig im Verlaufe des 18. Jhs. zum Schimpfwort. Diese Abkehr belegt auch ein Ausspruch des Archäologen Christian Gottlob Heyne (1729–1812) einige Jahrzehnte später: „Nur Komplikationen ohne Gelehrsamkeit, ohne Geschmack und Beurteilung, macht den Inhalt der meisten antiquarischen Bücher aus.“ Eine Fülle von Karikaturen belegen das in den Augen vieler Zeitgenossen als sinnfrei und ziellos empfundene „Treiben“ dieser Spezies von Altertumsforschern. Letztlich deutet sich in ihnen der bevorstehende Paradigmenwechsel an – der Weg von „bloßer Gelehrsamkeit“ zur „Wissenschaft“.