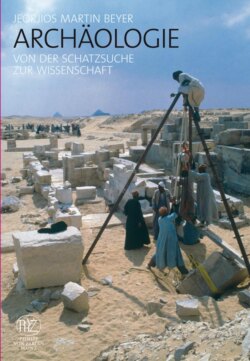Читать книгу Archäologie - Jeorjios Beyer - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Blick auf das „Gestern“
ОглавлениеAntike und Mittelalter
Die Auseinandersetzung mit der unmittelbaren Vergangenheit, mit den Ahnen, aber auch mit der nicht mehr greifbaren Vorgeschichte über die Mythen gehört für alle Kulturen dieser Welt zu den essenziellen Konstanten. Mithilfe von Mythen, Legenden und Geschichtsschreibung konnten sich soziale Gemeinschaften des eigenen Daseins vergewissern – eine Identitätsfindung durch den Blick auf das „Gestern“.
Der Kontakt zur eigenen Geschichte und Kultur erfolgte dabei über die Vergegenwärtigung der eigenen kulturellen Leistungen. Dies diente seinerseits nicht nur der künstlerischen Orientierung, sondern auch der Schaffung bzw. dem Erhalt der eigenen Macht und Überlegenheit auf politischem, religiösem oder allgemein kulturellem Gebiet. Oft handelte es sich dabei um die Konstruktion eines Idealbildes – gleichgültig ob es auf einer historisch bekannten Vergangenheit oder auf einer mythischen Vorzeit aufbaute. Als Medien der Tradierung dienten sowohl die Literatur als auch die Bildende Kunst.
Antike Leitkultur
Besonders deutlich ist die Beschäftigung mit der eigenen Geschichte und den Traditionen und Hinterlassenschaften der Vorfahren in der griechischen und römischen Epoche zu fassen. Die geistige Auseinandersetzung mit der Kunst der Vergangenheit verband sich dabei mit der Vorstellung einer idealen Vollkommenheit, an der sich die Gegenwart orientieren sollte. Auch in dieser Hinsicht war das Wissen um die kulturellen Leistungen der eigenen Geschichte ein grundlegender Bestandteil des Bildungskanons. Dabei lag der Fokus in besonderem Maße auf der Literatur. Die großen Dichter und Denker schufen die Paradigmen, an denen man sich orientierte, allen voran Homer und die großen Philosophen. Sie bildeten seit dem Hellenismus die Orientierungspunkte für das eigene Dasein (Abb. 2). Seit dieser Epoche – und verstärkt in römischer Zeit – gerieten auch die Werke der großen Künstler in den Blickpunkt.
So nimmt es nicht wunder, dass – befördert durch die Kunstschriftstellerei – bereits im Hellenismus nicht nur die Literaten, sondern auch die Bildhauer und Maler der griechischen Zeit, Phidias, Praxiteles, Apelles, für jeden Gebildeten ein Muss waren. Die Römer bewunderten die Errungenschaften griechischen Geistes so sehr, dass der Dichter Horaz ausrufen konnte: „Legt die griechischen Muster weder nachts noch bei Tage aus der Hand!“ – Vos exemplaria Graeca nocturna versate manu, versate diurna (Horaz, De arte poetica, 268 f.). Die Intensität der Beschäftigung mit der Kunst der Griechen in römischer Zeit, ihre Neigung griechische Originale zu kopieren und für die eigene Bildwelt zu nutzen, führte dazu, dass bis weit ins 19. Jh. die Kenntnis griechischer Kunst beinahe ausschließlich durch den Filter römischer Kopien erfolgen musste. Der Kulturhistoriker Jakob Burckhardt (1818–1897) brachte es wie folgt auf den Punkt: „Ohne die Römer wüssten wir nichts von den Griechen und würden nicht einmal etwas von ihnen zu wissen begehren“ (J. Burckhardt, Gesamtausgabe XIII 19). Es ist die Verwandtschaft der römischen zur griechischen Kultur, die eine nach heutigen Maßstäben wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Relikten der Vergangenheit abseits rein ästhetischer Werturteile lange verhinderte.
Abb. 2: Die Überreste des Apollontempels im griechischen Delphi.
Die Römer kannten die bewunderten Werke der Griechen zwar z. T. aus eigener Anschauung – dort, wo sie aus ihrem ursprünglichen Kontext gerissen und in Rom ausgestellt waren –, und wie erwähnt von Kopien griechischer Bildwerke. Die Geschichte berühmter antiker Monumente jedoch konnten sie „nur“ in entsprechenden Publikationen erfahren: Neben verstreuten Erwähnungen in der Literatur waren es v. a. die enzyklopädischen Werke wie die Naturgeschichte Plinius d. Ä. (ca. 23–79 n. Chr.) oder die von Reiseschriftstellern wie Pausanias (ca. 115–180 n. Chr.), in denen diese eine ausgiebige Behandlung erfuhren. Solche Traktate führten dazu, dass das Wissen um den Bestand an Denkmälern und eine Vorstellung von ihrem Erscheinungsbild nicht verloren ging (s. Info). Gleichzeitig förderten sie aber auch die Ausbildung eines Kanons, der die Erforschung der Antiken bis weit in das 19. Jh. hinein bestimmen sollte.
Archäologisches Reflektieren?
Die zahlreichen Erwähnungen antiker Denkmäler und ihrer Schöpfer in den Werken der römischen Historiker und Literaten sprechen für den hohen Stellenwert, den sie besaßen. Sie bezeugen, dass die Römer einen Sinn für griechische Kunst besaßen, dass sie Handel mit den Antiken trieben, sie imitierten und kopierten und sie für ihre Belange nutzten, sei es als Mittel der Selbstdarstellung und Repräsentation oder als schieren Schmuck für die eigenen Villen und Gärten.
Am besten literarisch dokumentiert ist die Suche nach geeigneten Skulpturen in den Briefen des römischen Rhetors Cicero (106–43 v. Chr.) an seinen Freund Atticus. Im Stile eines Innenarchitekten ordert er von ihm, während dieser sich in Athen aufhält, mehrfach griechische Originale für die Ausstattung seiner Villa in Tusculum. Trotz aller Kennerschaft scheint es Cicero bisweilen nicht so sehr auf die Qualität der Stücke angekommen zu sein – er vertraute dabei auf den Geschmack des Atticus –, sondern vielmehr auf den Preis und darauf, ob sie zu seinem Ruf als philosophisch und literarisch tätigem Menschen passten. Die für den privaten Teil gedachten Statuen sollten bei Symposien letztlich auch als Aufhänger für den gebildeten Diskurs dienen. Auf diese Art verschaffte sich die römische Oberschicht einen Zugang zu den bewunderten Meisterwerken. Die wachsende Kenntnis griechischer Meisterwerke schuf ihrerseits einen enormen Bedarf, der dazu führte, dass zunehmend Kopien der bewunderten Skulpturen für die Ausstattung privater und öffentlicher Räume produziert werden mussten. Über solche Kopien sind uns eine ganze Reihe verlorener griechischer Originale überliefert.
Die Konzentration auf die großen Künstler der Vergangenheit wird auch bei der folgenden Passage aus der Naturgeschichte Plinius’ d. Ä. deutlich. Da das beschriebene griechische Original verloren ist, schöpfen die heutigen Archäologen wie die zeitgenössischen Leser des Plinius gewissermaßen aus denselben Quellen:
„Niemand wird zweifeln, dass Phidias der vorzüglichste aller Bildhauer war, wenn er den von ihm verfertigten Jupiter Olympius zu beurteilen versteht; damit aber auch diejenigen, welche nichts von ihm gesehen, inne werden, dass er das ihm erteilte Lob mit Recht verdient, wollen wir einige wenn auch nur kleine Beweise seines Genies mitteilen. Diese Beweise sollen also nicht der Schönheit seines olympischen Jupiters, nicht der Größe seiner Minerva zu Athen (sie misst 26 Ellen und besteht aus Elfenbein und Gold), sondern nur dem Schilde der letztern entnommen werden. Auf dem erhöhten Rande desselben meißelte er die Schlacht der Amazonen, in der Mitte den Kampf der Götter und Giganten, am Fuß desselben aber den der Lapithen und Kentauren ein, und vereinigte somit alle Teile der Kunst auf ihm. Was er an dem Sockel der Statue anbrachte, nannte er die Ausgeburt der Pandora; 20 Gottheiten sind es, deren Geburt hier dargestellt ist, und unter ihnen bewundert man am meisten die Victoria. Kenner bewundern auch die Schlange und unter dem Spieß selbst die erzene Sphinx. Diese wenigen Andeutungen mögen genügen und zugleich dartun, dass dieser nie genug zu lobende Künstler auch in Nebendingen seine Vortrefflichkeit bewährt hat.“
Plinius d. Ä., Naturalis historia, XXXVI 180.
Die verbreiteteste Art der Auseinandersetzung mit den Kunstwerken – und den historischen Stätten jenseits der Adria – war aber weiterhin das Studium der berühmten Werke der Literatur. Vergleichbar der Grand Tour der Neuzeit bezeugen touristische Reisen nach Griechenland und Kleinasien allerdings auch, dass eine ganze Reihe von Kunstliebhabern nicht nur mit dem Geiste reisten, sondern die z. T. auch für sie „antiken“ Denkmäler in Augenschein nehmen wollten.
Ein ganz besonderes Kapitel der „Aneignung“ antiker Kunst bildet die systematische Plünderung griechischer, wie auch später römischer Stätten durch Herrscher. Die Liste ist lang: Nicht nur Kunstwerke aus den griechischen Städten, sondern v. a. die großen überregionalen Heiligtümer Griechenlands wurden ihrer Skulpturenausstattung beraubt. Was die Kunstsammler der späten Republik und frühen Kaiserzeit nicht bereits in ihre Villen geschafft hatten, entführten nun Kaiser wie Caligula (12–41 n. Chr.) und Nero (37–68 n. Chr.). Allein aus dem Apollonheiligtum in Delphi (Abb. 2) überführte Letzterer trotz aller Wertschätzung, die er – so der Rhetor Dion Chrysostomos (nach 40–vor 120 n. Chr.) – für die Heiligtümer Griechenlands hegte, eine Unmenge an griechischen Kunstwerken nach Rom. Pausanias notiert für Delphi etwa 500 Bronzestatuen, die der Raffgier Neros anheimfielen. Auch Kaiser Konstantin schaffte eine ganze Reihe an monumentalen Denkmälern aus Griechenland fort, um seine neue Residenzstadt Konstantinopel am Bosporus zu schmücken, darunter die sog. Schlangensäule (vgl. Abb. 3), ein Teil eines vergoldeten Dreifußvotivs für den Sieg der Griechen bei Plataiai im Jahre 479 v. Chr. (Abb. 3).
Selbst wenn es keine Archäologie, keine systematische Erkundung der Monumente der Vergangenheit gab, so sind doch bisweilen Ansätze archäologischer Reflexion zu erahnen. Denn was heute der Terminus Archäologie beinhaltet, ist in der Antike zunächst allgemein die Suche nach den eigenen Wurzeln. In Platons Dialog Hippias maior bezeichnet der Begriff archaiología die Kenntnis der Vergangenheit. Darin eingeschlossen waren neben dem Wissen um die Mythen und die Kenntnis des Ursprungs der eigenen Kultur und der Sitten auch diejenige um die Formen der ersten Siedlungen und Städtegründungen – eine durchaus gegenständliche Konnotation. Immerhin steht hinter dem Begriff archaiología bei Platon bereits als Kern eine Vorstellung von – im wahrsten Sinne des Wortes – „vergangenen Kulturleistungen“. Er unterscheidet somit deutlich zwischen einer unmittelbar zurückliegenden, geschichtlichen und einer in das Dunkel des Vergessens gefallenen, fernen Vergangenheit.
Viel konkreter ist die Auseinandersetzung mit den antiken Überresten in einem anderen Fall: Immer wieder kamen bei Baumaßnahmen beim Ausheben der Baugruben Denkmäler vergangener Zeiten ans Tageslicht. Und der Umgang mit diesen war letztlich kein anderer als der, dem heutige Zufallsfunde oftmals anheimfallen. Der antike Geograph Strabon (ca. 63 v. Chr.–23 n. Chr.) erwähnt einen Fall antiken Kunsthandels der besonderen Art: Als Caesar das 146 v. Chr. zerstörte Korinth wieder aufbauen ließ, wurden bei der Entfernung der Trümmer in den Nekropolen der Stadt eine Unmenge an korinthischer Keramik und Bronzegefäßen entdeckt. Systematisch wurden daraufhin die Gräber durchforstet und der römische Kunstmarkt mit den wertvollen Produkten überschwemmt. Schon nach kurzer Zeit war dieser jedoch so übersättigt, dass die Händler kaum mehr hohe Preise erzielen konnten.
Verstreut in den antiken Quellen finden sich Hinweise auf Deutungsversuche, die sich aus solchen Zufallsfunden ergaben. So mutet die Argumentation des griechischen Historikers Thukydides (ca. 460– 399/6 v. Chr.) nahezu modern an; er nutzt einzelne Rüstungsmerkmale exhumierter Toter auf der Insel Delos sowie die Art ihrer Bestattung als „Beweis“, um sie als Karer zu identifizieren. Aber auch Probleme der Deutung antiker Relikte spricht Thukydides an, wenn er über die Bewertung der Überreste Athens und Spartas durch nachfolgende Generationen spricht: „Denn angenommen, die Stadt der Spartaner verödete, übrig blieben aber die Heiligtümer und von den anderen Bauten die Grundmauern, so würde, glaube ich, nach Verlauf langer Zeit den späteren Menschen starker Zweifel an ihrer tatsächlichen Macht im Verhältnis zu ihrem Ruhm kommen …“ (Thukydides I 10, 2ff.).
Auch aus der Spätantike und dem Mittelalter sind vereinzelt Ausgrabungen belegt. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um zufällige Funde. Gezielte Grabungen fanden nun zum Vorteil und Nutzen der christlichen Kirche statt. Das „mythische“ Vorbild der Helena, der Mutter Konstantins, die im 4. Jh. n. Chr. auf der Suche nach dem Heiligen Kreuz fündig geworden sein soll, wirkte insofern nach, als immer wieder nach Reliquien gegraben wurde. Der Erfolg war dabei in besonderem Maße von der „Vermarktung“, die die ergrabenen Gegenstände erfuhren, abhängig.
Ein Beispiel einer solchen Grabung ist etwa die zu Beginn des 12. Jhs. bei der Stadterweiterung von Köln erfolgte Freilegung von Gräbern, die aufgrund einer Vision als Gebeine von Jungfrauen interpretiert wurden, die dem Martyrium zum Opfer gefallen waren. Das Interessante an diesem Vorgang ist nicht so sehr die Auffindung und Deutung, sondern die Dauer und Intensität der Grabungstätigkeit. Ein halbes Jahrhundert nach der Auffindung der ersten Gräber wurde die Suche 1155–1164 systematisiert. Die vorgefundenen spätantiken Inschriften ließen für die Ausgräber keinen Zweifel an ihrer Identität als Märtyrergräber. Spuren der mittelalterlichen Grabungen traten bei archäologischen Untersuchungen im Jahre 1942 zutage.
Solche und ähnliche Tätigkeiten dienten allerdings ebenso wenig wie ihre Vorläufer aus der Antike der Ergründung der Vergangenheit. Selbst wenn man gezielt nach konkret definierten, antiken Überresten suchte, handelte es sich doch eher um Schatzsuche, keinesfalls aber um wissenschaftlich motiviertes Forschen.
Veränderte Vorzeichen
Eine bedeutende Zäsur in der Beschäftigung mit der griechischen und römischen Kunst bildete die Christianisierung des römischen Imperiums seit dem 3. Jh. n. Chr. Den Christen – so viel sie auch von der antiken Kultur, der sie ja selbst angehörten, ohne Probleme übernahmen – galten die meisten der Bildwerke als Zeichen der überwundenen heidnischen Kulte. In der Spätantike und im frühen Mittelalter geriet deshalb das Wissen um die Kultur der Antike mit der Zeit zunehmend in Vergessenheit. In Dichtung und Malerei lag dies vorrangig in der durch das Christentum tabuisierten Vorstellungswelt des Heidentums begründet. Besonders asketisch eingestellte Kirchenführer und Mönche beließen es nicht nur bei der Schließung der Heiligtümer und Tempel, sie begannen ein bis dahin nie dagewesenes Zerstörungswerk, dem viele Kunstdenkmäler zum Opfer fielen.
Abb. 3: Die Überreste der sog. Schlangensäule, von Konstantin I aus Griechenland nach Konstantinopel gebracht, befinden sich auch heute noch in Istanbul, als Teil des At Meidani an der Stelle des antiken Hippodroms. Sie war über die Jahrhunderte fester Bestandteil der Platzgestaltung, wie mittelalterliche islamische Miniaturen beweisen, die das Monument noch mit den zugehörigen Schlangenköpfen zeigen. Ein Teil eines dieser Köpfe wurde 1848 entdeckt.
Fragmente antiker Kunstwerke hingegen konnten durchaus ein Eigenleben führen, das ihr Bestehen sicherte. Wenn sie nicht der Zerstörung anheimfielen, wurden die mit dem christlichen Verständnis nicht vereinbaren Skulpturen und Bauwerke neu verwendet, umgedeutet oder umgearbeitet. Die Nutzung der antiken Denkmäler trieb dabei zuweilen merkwürdige Blüten. So berichtet Magister Gregorius im 12. Jh. von einem großen Haufen zerschlagener Statuen im Bereich des ehemaligen Nervaforums, darunter auch Kopf und Rumpf einer Pallas-Statue. Sie diente dem Nachweis, dass die heidnische Antike endgültig überwunden war. Gleichzeitig strömte aber auch ein Hauch von Furcht und Ehrfurcht von diesem „Trümmerdenkmal“ aus.
Die schrittweise Etablierung einer eigentlich „christlichen“ Kunst brachte auch die ästhetische Auseinandersetzung mit den Bildwerken der Antike beinahe zum Erliegen. In einigen Bereichen baute sie zwar formal auf antiken Traditionen auf. Die Bildwelt allerdings wurde systematisch christianisiert. Dies betraf die Genres der Malerei und des Mosaiks, im Mittelalter auch der Skulptur. Andere Bereiche jedoch, die unverdächtig waren, heidnische Vorstellungen zu transportieren, tradierten die Kunstformen der Antike oder nutzten Kunstwerke für ihre Belange. Für die Gestaltung zeitgenössischer Architektur etwa spielten die Bauwerke der Vergangenheit eine bedeutende Rolle. Sie gerieten in der Regel zu Lieferanten von Baumaterial – oder dienten als „Gerüst“ für Umbauten. Spolien wurden zur repräsentativen Verschönerung öffentlicher Bauten z. T. von weit her herbeigeschafft.
Hier stehen die mittelalterlichen Baumeister in der Tradition der Spätantike. Nicht erst seit der Errichtung des Konstantinsbogens in Rom dienten Werkstücke älterer Bauten als willkommene Ergänzung zu den speziell angefertigten Teilen. Besonders beliebt als Spolien waren im Mittelalter Säulen und Kapitelle, deren hohe Qualität die Bauten aufwertete. Aber auch andere Denkmäler wurden genutzt. Zahlreiche Reliefs wurden in Wände verbaut, Sarkophage in Brunnen verwandelt.
Auch in anderen Bereichen lässt sich diese Tendenz beobachten, wie etwa in der Einbeziehung von Gemmen, Kameen und anderen Schmuckformen in die Gestaltung von liturgischem Gerät. Nur in den seltensten Fällen spielte bei der Nutzung die Kenntnis der ursprünglichen Bedeutung oder der Herkunft eine Rolle. Dennoch wurden die jeweiligen Stücke in der Regel kaum aus praktischen Erwägungen und nur selten aus profan ästhetischen Gründen verwendet. Zumeist spielten die „wundersamen Kräfte“ des Steins oder ins Christliche gewendete Interpretation der dargestellten Inhalte die entscheidende Rolle für ihre Wiederverwendung.
Vom Licht im Dunkel
Bedenkt man den Grad der Eliminierung antiken, als „heidnisch“ verstandenen Kulturgutes seit der Christianisierung Europas, so scheint es erstaunlich, dass es trotz des inzwischen angewachsenen zeitlichen Abstands durch das gesamte Mittelalter hindurch dennoch immer wieder auch eine inhaltliche Beschäftigung mit der Antike gab. Die Auseinandersetzung mit dem antiken Erbe fand v. a. im Bereich der Literatur und der Philosophie statt. Antike Denkmäler wurden nicht erforscht, sie wurden aber – wie oben erwähnt – wahrgenommen, „benutzt“, ja sogar bewundert.
Wie nicht anders zu erwarten, konzentrieren sich die seltenen Fälle einer konkreten Auseinandersetzung mit der Kunst der Antike auf Rom. Die mittelalterlichen Romführer, an deren Anfang der sog. „Graphia-Libellus“ (um 1030) stand, sind eine beredte Quelle für die Beziehung der mittelalterlichen Menschen zu den sie umgebenden Antiken. Finden sich in den Ausführungen des Magister Gregorius z. T. negative Beurteilungen antiker Kunstwerke – er bezeichnet den berühmten „Dornauszieher“ als „höchst lächerlich“ (simulacrum valde ridiculosum) –, so werden in den späteren Romführern die Hinterlassenschaften der Römer als Sehenswürdigkeiten aufgeführt (s. Info). Die antiken Monumente werden zunehmend zu „Mirabilia“, bewundernswerten Werken der Vergangenheit, die zu betrachten sich lohnt: „Diese und viele andere Tempel und Paläste der Kaiser, Konsuln, Senatoren und Präfekten, welche zur Zeit der Heiden in dieser goldenen Stadt gewesen sind, so wie wir in den alten Annalen lasen und mit unseren Augen es gesehen und von den Alten es gehört haben, wie gar schön sie von Gold, Silber und Erz, Elfenbein und Edelsteinen glänzten, haben wir durch die Schrift zum Andenken der Nachkommen, so viele wir konnten, deutlicher zu machen uns bemüht“ (Narratiodeumirabilibus urbis Romae 32).
Abb. 4: Seit der Renaissance hatte das imposante Reiterstandbild des Marc Aurel seinen Platz auf der von Michelangelo konzipierten Piazza del Campidoglio, dem Kapitol. Um es vor weiteren witterungs- und umweltbedingten Zerstörungen zu schützen, wurde das heute in den Kapitolinischen Museen gezeigte Original durch eine detailgetreue Kopie ersetzt.
Der Erhalt antiker Denkmäler geschah im Mittelalter v. a. durch die christliche Umdeutung. Die Verwertung antiker Kunst zum eigenen Nutzen führte jedoch in keinem Fall zu einer tiefgreifenden Auseinandersetzung. Das Standbild des Marc Aurel auf dem Kapitol verdankte z. B. seinen Erhalt und seine Berühmtheit weniger seiner Zugehörigkeit zu den „Mirabilia“ als vielmehr der Tatsache, dass man in dem Abgebildeten Kaiser Konstantin erkannte – oder zumindest erkennen wollte (Abb. 4). Die Wirkung, die es erzielte, war immens.
Ab dem 12. Jh. verlor die bis dahin tradierte Deutung als Konstantin an Sicherheit. Eine erste Umdeutung erfuhr die Statue durch Deutsche: Die in Italien wirkenden Staufer widmeten es in ihrem Sinne in einen Theoderich um. Mit dem Erscheinen der ersten Romführer wurden Zweifel an den überkommenen Deutungen auch schriftlich diskutiert. Im Gegensatz zu vielen seiner Vorgänger war der erwähnte Magister Gregorius bewandert in Fragen antiker Kunst – und so verwarf er die meisten der vorgeschlagenen Deutungen als falsch. In seinen Ausführungen sind eine ganze Reihe beinahe archäologischer Beobachtungen zu den besprochenen Stücken zu finden. Zum einen zieht er antike Texte zur Erklärung heran, zum anderen bemüht er sich um eigene Anschauung. Dabei geht er systematisch und konsequent vor und versucht in den besprochenen Stücken ihren eigentlichen Kontext zu ergründen. Dass viele seiner Deutungen fehlgehen – auch die der Marc Aurel-Statue –, liegt an der Ausgangslage. Die monumentalen Reste des alten Rom befanden sich zu seiner Zeit in der Regel nicht mehr an ihrem ursprünglichen Ort.
Zwischen Repräsentation und Vergessen
Die Kombination von scheuer Bewunderung für die „ehrwürdigen“ Antiken, einem ausgeprägten Repräsentationswillen und dem Streit um Besitzansprüche konnte sogar auch zu denkmalschützerischen Maßnahmen führen. Eines der antiken Wahrzeichen Roms, die Trajanssäule – in den Mirabilia Urbis Romae ist ihr ein ganzes Kapitel gewidmet – schützte ein Senatsbeschluss aus dem Jahre 1162. Unter Androhung der Todesstrafe und der Konfiszierung des Familienbesitzes wurde bestimmt, dass sie im gegenwärtigen Zustand „bis ans Ende der Welt erhalten bleiben solle“ (integra et incorrupta permaneat, dum mundus durat).
Das Verhältnis des Mittelalters zur Antike war – nicht nur in Rom – hochgradig ambivalent. Die bewusste Rückwendung zeigt sich nicht nur in der Verwendung antiker Denkmäler oder Spolien. In einigen Fällen wird der Rückgriff auf antike Traditionen besonders evident.
Die sog. Casa dei Crescenzi aus der Mitte des 12. Jhs. (Abb. 5) verwendet nicht nur Teile eines römischen Architravs zum Schmuck, sondern ergänzt diesen durch Eigenproduktionen von Friesen mit bacchantischen Szenen, die ihre Herkunft von römischen Vorbildern eindeutig zeigen. Im Bauschmuck dieses Gebäudes drückt sich auch ein „bürgerliches“, ja „republikanisches“ Selbstverständnis aus, das dem päpstlichen Machtanspruch auf Rom seine Grenzen aufzeigen will. Die Inschriften verweisen dabei deutlich auf die Traditionen des antiken Rom. In einer dieser Inschriften wird explizit die Absicht geäußert, durch das Bauwerk das alte Rom zu erneuern (verum quod fecit hanc non tamen vana coegit gloria quam Rome veterem renovare decorem). Das Gebäude selbst ist als Amtslokal „dem römischen Volk zu Ehren“ (adsum Romanis grandis honor populis) errichtet.
In der Form noch deutlicher sind die Rückbezüge auf die Antike im Falle des staufischen Kaisers Friedrichs II. (1197– 1250): An kaiserzeitliche Tradition anknüpfend ließ dieser im Jahre 1231 eine neue Goldmünze prägen. Diese bezeichnenderweise Augustalis genannte Emission trug als Beischrift IMP[erator] ROM[anorum] CESAR AVG[ustus] und als Bild eine Büste des Kaisers mit Lorbeerkranz und Feldherrnmantel.
So sehr das Bemühen um einzelne „nützliche“ Denkmäler im Mittelalter vorhanden war: Maßnahmen wie der Senatsbeschluss zur Rettung der Trajanssäule blieben die Ausnahme. Hier handelt es sich letztlich um kommunale Entscheidungen, die erst in fernerer Zukunft Wirkung zeigten. Der Erhalt von Brücken und Toren folgte nicht dem Interesse an der antiken Architektur, sondern v. a. praktischen Erwägungen: Man schätzte ihre bauliche Qualität. Und so erscheinen die antiken Reste Roms gewissermaßen als Solitäre in einer fremden Umgebung.
Einen gewissen Eindruck vom Bestand an antiken Denkmälern im mittelalterlichen Rom vermitteln – freilich einige Jahrhunderte später – etwa die Skizzen und Stiche von Künstlern wie Marten van Heemskerk (1498–1574) oder Jean-Baptiste Leprince (1734–1781); sie bezeugen jedoch im gleichen Atemzuge auch die großen Lücken zwischen den einzelnen Ruinen, die von den Bewohnern nur allzu gerne als Viehweiden genutzt wurden (Abb. 6).
Die Beschreibung einer Venusstatue durch Magister Gregorius zeigt, dass der Autor Kenntnis von den antiken Mythen besaß und auch seinen Homer – offenkundig in lateinischer Übersetzung – gelesen hatte. Der erotischen Anziehungskraft der Statue konnte er sich allerdings kaum entziehen:
„Die Römer hatten diese Statue der Venus geweiht. Sie ist so dargestellt wie in dem Bericht über den leichtsinnigen Wettstreit mit Juno und Pallas, als sich Venus dem Paris nackt zur Schau stellte. Und der leichtsinnige Schiedsrichter, der sie betrachtete, sagte:,Nach unserem Urteil besiegt Venus sie beide‘. Diese Statue aus parischem Marmor ist mit einer so wunderbaren und unerklärlichen Kunstfertigkeit geschaffen, dass sie eher wie ein lebendes Geschöpf, nicht wie eine Statue erscheint. Denn sie hat mit Purpurrot übergossene Wangen, wie wenn sie wegen ihrer Nacktheit erröten würde. Und wer sie aus der Nähe betrachtet, meint, in ihrem schneeweißen Gesicht fließe Blut. Wegen ihrer wunderbaren Schönheit und wegen einer magischen Beeinflussung wurde ich dreimal gezwungen, sie wiederzusehen, obwohl sie zwei Stadien von meiner Herberge entfernt war.“
Magister Gregorius, Narratio de mirabilibus urbis Romae 12
Abb. 5: Der heute unscheinbar wirkende Backsteinbau der Casa dei Crescenzi ist ein Musterbeispiel für die Verwendung von Spolien in der mittelalterlichen Architektur. Sie sollten dezidiert auf die einstige Größe Roms verweisen.
Nicht nur Rom, auch das andere bedeutende Zentrum antiker Kultur, Athen, lag im Dämmerschlaf. Hatte es bereits im Verlauf der römischen Epoche zunehmend an Bedeutung verloren, so war es in byzantinischer Zeit zu einem unbedeutenden Provinznest herabgesunken. Alle Blicke konzentrierten sich auf Konstantinopel. Und so kann Michail Choniatis – bezeichnenderweise ein Kirchenmann des späten 12. Jhs. – über die einstige Weltmacht sagen: „O Stadt des Jammers, wo sind deine Tempel hin?“ (Michail Akominatos [Choniatis], Patrologia Graeca 140, 298 f.). Und es kam noch viel schlimmer: Durch die Eroberung des gesamten Balkans durch das Osmanische Reich gerieten auch die Hinterlassenschaften der griechischen Antike bis weit in das 19. Jh. aus dem Blickfeld. So war es den Antiken im Westen des Mittelmeers vorbehalten, als Anschauungsmaterial für die Rückbesinnung auf die griechische und römische Kultur zu dienen.
Abb. 6: Der Blick auf das heute bestens ergrabene Forum Romanum lässt vergessen, dass im Mittelalter neben den drei Säulen des Castor-Tempels, dem Erkennungszeichen des Forums, Vieh weidete. Der regelmäßig dort abgehaltene Viehmarkt verschaffte dem ehemaligen politischen Zentrum Roms die Bezeichnung „Campo Vaccino“.