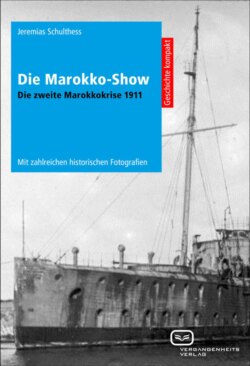Читать книгу Die Marokko-Show - Jeremias Schulthess - Страница 6
Der deutsche Platz an der Sonne
ОглавлениеDie Weltpolitik Deutschlands zielte unter dem jungen Kaiser Wilhelm II. zusehends auf eine Weltmachtstellung, getragen vom Grundgedanken einen „Platz an der Sonne.“7
Kaiser Wilhelm II., Fotografie von ca. 1910
Voraussetzung für diesen Anspruch stellte ein erstes deutsches Wirtschaftswunder dar – Deutschland bildete nicht mehr die Nachhut, sondern drängte in die erste Reihe der führenden Wirtschaftsmächte. Ein überschwängliches Selbstbewusstsein prägte die politischen und gesellschaftlichen Prozesse. Es entstand eine neue Landschaft von Industriestädten, Werkstätten verwandelten sich in Weltkonzerne, neue Arbeiter- und Fabrikkulturen entwickelten sich. Jahrzehnte später schrieb Stefan Zweig über jene Zeit unmittelbar vor dem Kriegsausbruch:
„Je kühner, je großzügiger ein Unternehmen angelegt wurde, umso sicherer lohnte es sich. Eine wunderbare Unbesorgtheit war damit über die Welt gekommen, denn was sollte diesen Aufstieg unterbrechen, was den Elan hemmen, der aus seinem eigenen Schwung immer neue Kräfte zog?“8
Die „alten“ Industriezweige, wie Eisen- und Stahlproduktion, schnellten in den Jahren bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs in rasantem Tempo empor. Die Produktivität der Roheisenerzerzeugung verdreifachte sich von 1887 bis 1912, im Vergleich dazu hatte England einen Anstieg von nur 30 Prozentpunkten. „Neue“ Wirtschaftszweige, wie die chemische oder Elektroindustrie, kurbelten die deutsche Ökonomie weiter an. Bayer, AEG, Siemens und Bosch hießen die führenden Unternehmen der „New Economy“. Für seine Magnetzünder weltbekannt geworden, exportierte Bosch mehr als 80 Prozent seiner Produktion ins Ausland. Gleichzeitig stiegen die deutschlandweiten Einfuhren aus dem Ausland von 5,7 Mio. Mark im Jahr 1872, auf 161,3 Mio. Mark 1910.9 Der Welthandel florierte. Eine erste Globalisierungswelle lief an. Hand in Hand mit dieser ökonomischen Entwicklung ging eine zunehmende Abhängigkeit mit dem Ausland einher, die sich nun mehr auf die überseeische Welt ausweitete.
Neue Produktionsweisen der Schwerindustrie ermöglichten auch eine Ausweitung der militärischen Rüstung. Insbesondere der Flottenbau hatte unter Wilhelm II. eine neue Dimension angenommen. Die Firma F.A. Krupp lieferte einen neuen Typ von Panzerplatten, die eine einzigartige Abwehrkraft garantierten. Deutschland hatte sich in ein Wettrüsten mit England hinein gestürzt, bei dem der Flottenbau ein herausragendes Moment darstellte.10
Das neue deutsche Selbstbewusstsein zeigte sich auch in Form eines nationalistischen Gedankenguts rechtskonservativer Kreise. Der deutsche Imperialismus speiste sich ideologisch aus einer hierarchischen Vorstellung von Völkern. Man war den vermeintlich unterentwickelten Völkern überlegen, ergo stand man in einer zivilisatorischen Pflicht und konnte sich Kolonien aneignen, um den deutschen Weltmachtanspruch zu verwirklichen. Bei der Verteilung der Welt war Deutschland jedoch zu spät gekommen, was nun revidiert werden sollte.
In der Anfangsphase des neu gegründeten Kaiserreichs, in den 1870er Jahren, lag die Stoßrichtung der deutschen Außenpolitik vorwiegend in Europa. Auf eine Landkarte Europas deutend bemerkte Bismarck vielsagend: „Das ist meine Karte von Afrika.“11 Erst im Jahr 1884 begann das koloniale Abenteuer von deutscher Seite, mit dem Erwerb von Landstrichen in West- und Südafrika. Später kamen Kolonien an der afrikanischen Ostküste, Kiautschou (China), sowie kleinere Südseeinseln dazu. Es war ein sehr bescheidenes Kolonialreich, das die Deutschen aufbauten, in keiner Weise vergleichbar zu dem, was Engländer und Franzosen unter ihrer Gewalt hatten.
Es kristallisierten sich in dieser Zeit erste Interessengruppen für koloniale Angelegenheiten im Deutschen Reich heraus, die von der Fantasie angetrieben waren, mit den Kolonien nicht nur territorial an Geltung zu gewinnen, sondern auch wirtschaftlich zu profitieren. Die Deutsche Kolonialgesellschaft oder die Deutsch-Ostafrikanische-Gesellschaft vertraten direkte Wirtschafts- und Siedlungsinteressen in den neu erworbenen Kolonien. Mit der Gründung des Allgemeinen Deutschen Verbandes (ab 1894 Alldeutscher Verband) formierte sich eine breite Bewegung, die heterogene Gesellschaftskreise unter der Idee eines „völkischen Gedankens“ miteinander verband.12 Der Alldeutsche Verband (ADV) trat „für eine energische Kolonialpolitik“ des deutschen Kaiserreichs ein.13Er war ein Sprachrohr für viele rechtskonservative, nationalistische Stimmen und agierte abseits der politischen Bühne als antiparlamentarisches Propagandaorgan.
Für den Staat bedeuteten Kolonien einen immensen finanziellen Aufwand, der sich kaum durch wirtschaftliche Erträge aufwog. Von daher waren Kolonien größtenteils Prestigeobjekte einer Regierung, die im Kabinett der Großmächte und vor der eigenen Bevölkerung etwas vorweisen wollte. Für einzelne Wirtschaftsunternehmen hingegen konnten sich koloniale Errungenschaften durchaus auszahlen, etwa wenn reiche Bodenschätze auf dem Gebiet zu vermuten waren.
Zur Erschließung von Rohstoffvorkommen stellte der Eisenbahnbau einen entscheidenden Faktor dar. Keine Goldmine und keine Baumwollplantage konnte ertragreich ausgeschöpft werden, wenn nicht vorher Transportwege eingerichtet wurden. Es waren vorwiegend Banken, die in den kolonialen Eisenbahnbau investierten. Die deutsche Hochfinanz beteiligte sich in großem Umfang an einem Bahnprojekt von Deutschland über Südosteuropa bis in den Mittleren Osten. Die „Berlin-Bagdad-Bahn“ hatte nicht nur Prestigecharakter, sie stellte auch einen Kontrollfaktor durch Einflussmöglichkeiten auf Handels- und Transportwege dar. In Zentralafrika gab es ähnliche Projekte, die den Austausch und Abbau von Gütern durch Eisenbahnverbindungen fördern sollten. Die Deutsche Bank hatte Bergwerkskonzessionen im Gebiet um Katanga im Belgischen Kongo erworben und war daran interessiert, den Bahnbau in der Region voran zu treiben – eine „Transafrikanische Eisenbahn“, die den Kontinent von der Ost- und Westküste her erschließen sollte, war das längerfristige Ziel.14
Engagements deutscher Unternehmen gab es auch in Marokko, wo erhebliche Erz- und Kupfervorkommen vermutet wurden. Vertreter aus schwerindustriellen Kreisen liebäugelten seit den 1890er Jahren mit dem Gedanken, in Marokko Fuß zu fassen. Eine marokkanische Kolonie mit Deutschland als Schutzmacht zu errichten, hätte bedeutet, der eigenen Industrie den Vorzug vor ausländischen Montanunternehmen geben zu können. Den Franzosen, die als Kolonialmacht über Marokko verfügten, lag allerdings viel daran, diesen Status zu verteidigen. Konflikte waren hier vorprogrammiert sollten die Deutschen derlei Ziele verwirklichen wollen.
Dennoch war der Ruf nach Marokko Anfang des 20. Jahrhunderts zu hören und der Kaiser sah Handlungsbedarf, den Franzosen, die ihre Hand auf Marokko legten, in ihrer Kolonialpolitik einen Riegel vorzuschieben. Mit einem Besuch in der nordmarokkanischen Hafenstadt Tanger landete der Kaiser am 31. März 1905 einen demonstrativen Coup, der für internationales Aufsehen sorgte. Was hatte ein deutscher Kaiser auf feindlichem Kolonialgebiet verloren, fragten sich internationale Diplomaten. Für sie war die Landung des Kaisers in Marokko eine provozierende Geste, was auch von deutscher Seite so intendiert war – man wollte schlichtweg auf sich aufmerksam machen und gleichzeitig die Reaktionen der Großmächte prüfen. Die deutsche Provokation entwickelte sich zur ernst zu nehmenden Krise. „Es ging in der Marokko-Sache weniger um die Stellung des Reiches in diesem afrikanischen Staate, als mehr um die Deutsche Weltstellung“, schrieb der bayrische Gesandte, Graf von Lerchenfeld, im Rückblick auf diese erste Marokkokrise.15
Bündnispolitische Überlegungen standen in diesem Kräftemessen auf der Agenda. Das Feindbündnis, die „Entente cordiale“, die seit 1904 zwischen Frankreich und England bestand, sollte ausgetestet und allenfalls gesprengt werden. Wie würde der Bündnispartner England auf ein forsches Auftreten des Deutschen Reichs reagieren? Die Antwort kam postwendend: Anstelle bündnispolitischen Auseinanderrückens von England und Frankreich, die sich das Auswärtige Amt erhofft hatte, wurden die Bündnispartner enger an einander geschmiedet. Deutschland stand einem monolithischen Block der europäischen Großmächte gegenüber, die allesamt den deutschen Vorstoß in Marokko verurteilten.
Die erste Marokkokrise entwickelte sich zu einer außenpolitischen Farce für die deutsche Außenpolitik. Die deutschen Weltgeltungsansprüche wurden im Keim erstickt. Mit einem deutsch-französischen Abkommen, dem „Algecirasvertrag“, fand die Krise 1906 vorerst ein Ende. Der koloniale Status Frankreichs über Marokko war zwar faktisch aufgelöst, durch die Kontrolle des Finanz- und Polizeiwesen blieb Frankreich allerdings die Hintertür in Marokko offen. Eine Souveränität Marokkos war aufgrund des asymmetrischen Beziehungsverhältnisses zu Frankreich sowieso von vornherein zum Scheitern verurteilt. Frankreich blieb der dominierende Faktor in dem nordafrikanischen Land.
In der Folgezeit zeigten sich deutsche und französische Montanunternehmen darum bemüht, den Abbau von marokkanischen Erzvorkommen zu fördern. Politische Rückendeckung war für wirtschaftliche Engagements in Marokko schließlich nicht Voraussetzung. Die Firma F. A. Krupp unternahm den Versuch, mit der französischen Schneider-Creusot eine deutsch-französische Interessengemeinschaft herbei zu führen. Daraus entstand die Union des Mines Marocaines. Andere Interessenten, wie die Gebrüder Mannesmann, die an den gleichnamigen Röhrenwerken nur noch beteiligt waren, blieben außen vor. Für die Mannesmanns bedeutete eine Einflussnahme in Marokko eine dringende Notwendigkeit – sie bezeichneten es als „das einzige Land, in dem [...] noch Eisenlager in erheblichem Umfang vorhanden sind.“16 Eine Beteiligung an der Union des Mines lehnten sie allerdings ab. Sie suchten auf direktem Weg mit dem marokkanischen Sultan Bergbaurechte zu verhandeln. Der Versuch scheiterte. Als einzige Möglichkeit blieb die politische Einflussnahme – man wandte sich an das Auswärtige Amt.
Nach dem unglimpflichen Verlauf der ersten Marokkokrise fand sich in der Wilhelmstraße, dem Sitz des Auswärtigen Amts in Berlin, vorerst kein Befürworter, die Marokko-Angelegenheit neu aufzurollen. Der neue Staatssekretär des Äußeren, Kiderlen-Wächter, stellte fest, „dass wir, solange die Marokkofrage in der Luft schwebt, überall auf der ganzen Welt in allen Fragen England auf Frankreichs Seite finden werden.“17