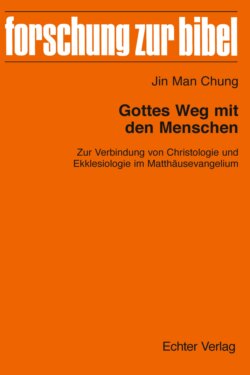Читать книгу Gottes Weg mit den Menschen - Jin Man Chung - Страница 7
Оглавление1. Fragestellung
Der Evangelist Matthäus beschreibt in seinem Evangelium den Weg Jesu, der von Galiläa nach Jerusalem und durch das Leiden zur Auferstehung führt. Dieser „Weg“ wird bei Matthäus nicht als historisch-geographisches Itinerar, sondern als Weg Gottes dargestellt. Jesus geht den Weg, den Gott ihn sendet; er lehrt aber auch den „Weg Gottes“, den zuvor schon Johannes der Täufer verkündet hat (Mt 22,161 par. Mk 12,14), um den Willen Gottes zu erfüllen. Dieser Weg steht unter Gottes Leitung; er entspricht dem Willen Gottes und verwirklicht ihn.2 Deshalb ist er den alttestamentlichen Schriften gemäß. Für Matthäus erfüllt sich die Verheißung Gottes, die durch die Propheten verkündet ist, in der Person und im Wirken Jesu – aber so, dass mit Jesus nicht das Ende der Heilsgeschichte erreicht, sondern ein neuer Anfang gesetzt ist. Durch den Weg, den Jesus geht und in seinem Verkündigungsdienst vorzeichnet, kommt nach Matthäus Gott zu den Menschen. Sein universaler Heilswille erreicht zuerst das Gottesvolk Israel und durch Israel alle Völker bis an das Ende der Welt (Mt 28,16-20).
Auf seinem Weg zeigt Jesus, wie nahe Gott immer schon ist – gerade denen, die es am wenigsten vermuten. „Vater“ und „Sohn“ sind klar unterschieden; aber Matthäus betont, dass in Jesus – nicht erst durch den Auferstandenen, sondern bereits durch den Irdischen – Gott selbst handelt. Dafür steht das Immanuel-Motiv (Mt 1,23; 18,20; 28,20). Es verankert die matthäische Christologie biblisch-theologisch. Über das Immanuel-Motiv erschließt der Evangelist Matthäus den Weg Jesu als den Weg Gottes zu den Menschen. Dieser Weg ist ein Heilsweg, weil Gottes Wille Heilswille ist. Jesus macht sich auf seinem Weg nach Matthäus nicht von der Zustimmung der Menschen abhängig, zielt aber auf sie. Dass Jesus – als Immanuel – Menschen in seine Nachfolge beruft, hat den Sinn, dass sie an seiner Sendung teilhaben und den Heilsweg Gottes mitgehen. Sie werden als Sünder berufen, sie bedürfen der Umkehr und Vergebung, sie stehen auch als Gesandte, Lehrer und Mittler unter dem Gericht Gottes. Aber sie sind beauftragt und bevollmächtigt, Menschen zu Gott zu führen, damit diese ihren Weg mit Gott gehen können. Deshalb werden sie von Jesus mit auf seinen Weg genommen, so dass sie ihn selbst gehen können – in seiner Nachfolge.
Dadurch, dass Matthäus den Weg Gottes mit den Menschen in der Geschichte Jesu als Heilsweg fokussiert, wird das Evangelium, die erzählte Geschichte Jesu, zur narrativen Christologie und Ekklesiologie. Jesus geht nach Matthäus als Immanuel den „Weg der Gerechtigkeit“ (Mt 21,32), der ihn ins Leiden führt, aber im Tod seine universale Heilsbedeutung kulminieren lässt; die Jünger sollen Jesus auf diesem Weg folgen und nach Ostern für ihren Herrn diesen Weg der Nachfolge allen Menschen aufzeigen. Durch das Wegmotiv kommt nicht nur die Dynamik des Heilswillens Gottes zum Ausdruck, sondern auch sein Prozesscharakter: dass schon hier und jetzt, unterwegs, nicht erst am Ziel, Entscheidendes geschieht und angestoßen wird, damit es sich entwickeln kann. Dadurch, dass Matthäus durch die Immanuel-Christologie den Gottesglauben mit der Heilserwartung Israels verknüpft, konkretisiert er den universalen Heilswillen Gottes in der Geschichte Jesu, die ihrerseits in die Heilsgeschichte Israels und ihre – von Matthäus betonte – genuine Universalität hineingehört. Gottes heilende Zuwendung wird also in der Verbindung zwischen Jesus und seinen Jüngern vergegenwärtigt. Er geht den Weg, auf dem sie ihm nachfolgen sollen, damit sie nach Ostern in seiner Gegenwart als Erhöhte neue Wege gehen können; sie gehen in der Nachfolge Jesu so zu den Menschen, wie er sie gesandt hat, und führen deshalb alle, die sie zu Jüngern machen, in die Nachfolge ein, die als Heilsweg Gottes definitiv in Galiläa begonnen hat – im Raum der Verheißung Israels.
1.1 Die Problematik
1.1.1 Die leitende Frage
Damit der Weg Gottes als Weg Jesu und der Weg Jesu als Weg Gottes bei Matthäus herausgestellt werden kann, muss der theologische Anspruch des Matthäusevangeliums im Kommunikationsfeld der Erinnerung an Jesus und dem Bekenntnis zu ihm methodisch erschlossen und hermeneutisch reflektiert werden. Als Leitmotiv dient die ImmanuelVerheißung, die den irdischen Jesus und den erhöhten Herrn in einen inneren Zusammenhang stellt und mit den Verheißungen Israels verbindet (Mt 1,23; 28,20): Für Matthäus ist Jesus nicht nur der Irdische, sondern auch der Erhöhte. Er ist der messianische Gottessohn, der die Verheißung des rettenden Beistandes Gottes erfüllt. Nach der Auferweckung setzt er seine Allmacht ein (Mt 28,18-20), „nicht um die Menschen zu überwältigen, sondern um ihnen beizustehen“3. Die durch die Propheten zugesprochene Heilstreue Gottes beginnt sich mit der Geburt Jesu eschatologisch zu erfüllen (Mt 1,18-25) und verwirklicht sich mit seiner Sendung, die in seinem Tod kulminiert und durch seine Auferstehung eschatologisch transformiert wird.
Weil Matthäus den Weg Jesu als den Heilsweg Gottes erschließt, stellt sich die Frage der Kommunikation: Wie kann auf dem Weg Jesu das Heil Gottes diejenigen erreichen, die gerettet werden sollen? Die Frage stellt sich nicht nur im Rückblick auf die Geschichte Jesu, sondern auch im Blick auf die Gemeinde des Matthäus und im Ausblick auf die Zeiten bis zur Vollendung. Deshalb ist nicht nur die Erinnerung an das Wirken und Leiden Jesu wesentlich, an die Art und Weise, wie er das Evangelium verkündet und geradezu verkörpert hat, es ist vielmehr auch wesentlich, wie er nach Matthäus die Distanzen in Raum und Zeit überwindet, die sich notwendigerweise in der Spannung zwischen dem Einen, den Gott gesandt hat, und den Vielen, die er retten will, auftun. Das entscheidende Mittel, das Jesus nach Matthäus wählt, ist die Sendung seiner Jünger. Vorösterlich weitet er durch sie seine Präsenz in Israel aus (Mt 10), nachösterlich für alle Zeit auf alle Völker (Mt 28,16-20). „Die Jünger erfahren den Beistand des allmächtigen Gottes in der Person Jesu Christi nicht so, dass ihre eigene[n] Allmachtsphantasien beflügelt, sondern so, dass sie auf den Weg der Nachfolge geführt werden: wenn sie das Vaterunser beten; wenn sie sich, und seien es nur zwei oder drei, im Namen Jesu versammeln (Mt 18,20); wenn sie sich um die Armen kümmern, mit denen Jesus sich identifiziert (Mt 25,31-46).“4 Die Jünger leben nach Matthäus allezeit von der Immanuel-Verheißung; sie tragen sie weiter, indem sie dem Nachfolgeruf Jesu folgen und durch ihre Sendung ihn als Heiland verkündigen und repräsentieren. In unbedingter Bindung an die Person und die Lehre Jesu erlangen die Jünger die „überfließende Gerechtigkeit“ (Mt 5,20) und realisieren die rettende Gegenwart Gottes. Im Rahmen ihrer Kräfte prägen sie „Modelle gelebten Glaubens für alle Zeiten“5, sie bilden die „Kirche“, die von Jesus auf dem Felsen Petrus gebaut ist (Mt 16,18). Für das Matthäusevangelium sind die Christologie des Immanuel und die Ekklesiologie der Nachfolge konstitutiv. Die vorliegende Arbeit ist auf die Dynamik der Verhältnisbestimmung zwischen Jesus und seinen Jüngern fokussiert, wie sie im Evangelium nach Matthäus erzählt wird, hat aber die Gegenwart der matthäischen Gemeinde im Blick, die zur Wirkungsgeschichte dessen gehört, was Matthäus in seinem „Buch“ (Mt 1,1) beschreibt, und sich deshalb kritisch und konstruktiv auf diesen Anfang beziehen muss, um ihre Sendung zu entdecken.
Zu untersuchen ist deshalb, wie Matthäus Christologie und Ekklesiologie, basaler: die Sendung Jesu und die seiner Jünger unter dem Aspekt verbindet, die Gegenwart der Kirche mit der Verheißung und dem Anspruch Jesu zu konfrontieren. Die entscheidende Verbindung ist jene, mit der Matthäus den Weg Jesu als Weg Gottes zum Heil Israels und der Völker darstellt. Es ist ein Weg; deshalb ist Nachfolge wesentlich. Es ist ein Heilsweg; deshalb ist die Teilhabe der Jünger an der Heilssendung Jesu entscheidend. Es ist der Weg Jesu selbst; deshalb ist das Wirken Jesu durch seine Jünger der Schlüssel.
Dieses Wirken Jesu durch seine Jünger ist im Matthäusevangelium nicht nur instrumentell, so als ob die Jünger nur Mittel zum Zweck wären; der Ruf in die Nachfolge ist vielmehr selbst der intensivste Ausdruck gerade jener Gottesverkündigung, mit der Jesus das Heil Gottes nahebringt. Die Jünger sind auf dieses Wort der Erwählung und Sendung angewiesen, weil sie sich nicht selbst senden und erlösen können, sondern der Bevollmächtigung und der Vergebung bedürfen. Jesus seinerseits geht über die Jünger mit ihren Fragen und Schwächen, Hoffnungen und Erfahrungen nicht hinweg, weil er in seiner Sendung gerade die Armen seligpreist (Mt 5,3-12).
Matthäus hat die Beziehung Jesu zu seinen Jüngern und der Jünger zu ihm genau gestaltet, intensiver als Markus, von dessen Evangelium er ausgeht. Auf der einen Seite hat er die Vollmachtschristologie durch das Immanuel-Motiv in einer Weise weiterentwickelt, dass die bleibende Gegenwart Jesu im Jüngerkreis theologisch gedacht werden kann. Auf der anderen Seite hat er die Beziehung der Jünger zu Jesus in größerer Differenziertheit und Farbigkeit als Markus gestaltet; im Spannungsfeld von Kleinglaube und Nachfolgebereitschaft zeichnet sich ab, wie die Jünger bleibend auf Jesus angewiesen sind, aber gerade deshalb Jesu Heilssendung weiterführen können.
1.1.2 Die Problematik des Themas
Die Frage nach dem Verhältnis zwischen Christologie und Ekklesiologie ist prekär, nicht nur, weil gegenwärtig in vielen Regionen die Kirchenbindung schwindet und das Christusbekenntnis in der Öffentlichkeit verblasst. Entscheidend ist vielmehr, dass sich ein theologisches Grundproblem stellt, das nicht ohne Weiteres aufzulösen ist. Die katholische Theologie betont traditionell die Kooperation zwischen Jesus und der Kirche6 – nicht als gleichberechtigte Partner, die einander ergänzen, aber als Wirken Jesu durch die Kirche. Die Kirche ist keineswegs mit Jesus gleichzusetzen; Jesus ist aber in der Kirche wirksam gegenwärtig. Die Kirche kann nur ein Werkzeug Gottes bei der Vermittlung des göttlichen Heils für die Menschen sein; aber ihr Wesen und ihre Sendung ist es, dieses Sakrament zu sein. Mit Anspielung auf die Deuteropaulinen schreibt Walter Kasper: „Durch die Kirche und in ihr bezieht Gott in Christus das All in sein Pleroma ein.“7 Bei der Betonung der untrennbaren Verbindung zwischen Jesus und der Kirche in der katholischen Ekklesiologie bleibt aber die Frage nach dem qualitativen Unterschied zwischen Jesus, dem Erlöser, und der Kirche, der Gemeinschaft der auf Hoffnung hin Erlösten, der gerechtfertigten Sünder, notorisch unbestimmt. Ohne die Differenzierung würde aber ein ekklesialer Triumphalismus herrschen, der blasphemisch wäre.
Die evangelische Theologie betont demgegenüber traditionell die Differenz zwischen Christus und der Kirche8 – nicht als Gegensatz, aber in der Weise, dass die Kirche gerade das „extra nos“ des Heiles bezeuge. Eine Heilswirksamkeit der Kirche wird damit nicht ausgeschlossen. Aber der Fokus liegt angesichts des Christusbekenntnisses, das, wenngleich im Kern identisch, geschichtlich bedingt und zeitlich variabel ist, beim Wirken des Heiligen Geistes in den einzelnen Gläubigen. Bei der Betonung der Differenz zwischen Christus und der Kirche bleibt die Frage nach der qualitativen Verbindung in der evangelischen Theologie notorisch unterbestimmt. Ohne die Verbindung würde aber ein Individualismus herrschen, der die gemeinschaftsstiftende Funktion des Glaubens unterschätzt und damit ihn selbst halbiert.
Die spezifisch konfessionellen Differenzen können im Rahmen einer Matthäusexegese nicht rekonstruiert und transformiert werden. Sie zeigen aber die Zusammenhänge und Hintergründe, die in die Matthäusforschung hineinspielen und mit denen sich die Auslegung des Matthäusevangeliums theologisch befassen muss. Die Aufgabe besteht darin, das Verhältnis zwischen Christologie und Ekklesiologie differenziert zu bestimmen, so die essentielle Differenz ebenso wie den essentiellen Zusammenhang zu erhellen.
1.1.3 Das Beispiel des Matthäusevangeliums
Das Matthäusevangelium ist eine wegweisende Reflexion über die Sendung der Kirche in der Nachfolge Jesu. In der systematischen Theologie wird die matthäische Theologie in ihrem spezifischen Profil kaum je reflektiert. Daraus, dass der Evangelist Matthäus unter den Evangelisten als einziger den Begriff ἐκκλησία (Mt 16,18; 18,17)9 verwendet, lässt sich aber das besondere Interesse dieses Evangeliums an der „Kirche“ erkennen. Die ekklesiologische Konzeption des Evangeliums orientiert sich an der Jüngerschaft. Die „Jünger“ sind bei Matthäus nicht nur eine historische Größe in ihrer Beziehung zu Jesus; indem sie den vorösterlichen Nachfolgekreis Jesu bezeichnen, gehen sie vielmehr über „eine geschichtliche Kontinuität“10 mit der nachösterlichen Kirche hinaus. Matthäus verbindet mittels des Missionsauftrags des Auferstandenen (Mt 28,18-20) den vorösterlichen Jüngerkreis mit dem nachösterlichen, so dass die Jünger als „Ausdruck einer inhaltlichen Programmatik“11 den erweiterten Horizont für die Glaubensgeschichte der Kirche öffnen. Sie repräsentieren die Kirche, die Jesus selbst gebaut hat (vgl. Mt 16,18), „ihre Darstellung ist transparent für die Gegenwart der Gemeinde (Mt 18,1-35)“12. Die vorösterliche Jüngerschaft hat nach Matthäus eine fundamentale Bedeutung für die Kirche durch die Mission, wie der österliche Missionsbefehl abschließend bekräftigt: „Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe“ (Mt 28,20). Die Jünger werden nach dem Matthäusevangelium vorösterlich für ihre nachösterliche Aufgabe befähigt, indem sie von Jesus lernen. Sie sind die (ersten) Adressaten der Lehre Jesu. Sie haben die fünf großen Reden, die von Matthäus zusammengestellt sind (Bergpredigt [Mt 5-7], Aussendungsrede [Mt 10], Gleichnisrede [Mt 13], Gemeinderede [Mt 18], Gerichtsrede [Mt 24f.]), als „Grundlage für die Existenz in der Nachfolge und der Nachfolgegemeinschaft“13 gehört und – jedenfalls im Ansatz – so verstanden (Mt 13,51), dass sie andere lehren können.
Die Ekklesiologie ist bei Matthäus in der Christologie begründet (vgl. Mt 16,18). Ohne Jesus gäbe es die Kirche nicht. Die Christologie ist bei Matthäus so entwickelt, dass die Schnittstelle zur Ekklesiologie deutlich wird. Besonders hervorgehoben ist im Matthäusevangelium die Immanuel-Christologie. Έμμανουήλ (Mt 1,23 [Jes 7,14]) ist ein Hapax legomenon des Neuen Testaments, im Matthäusevangelium stark betont. Seine Bedeutung liegt nicht nur in der christologischen Kennzeichnung des Irdischen, sondern erweist sich auch darin, dass es einen Bogen schlägt zu dem letzten Wort des Auferstandenen (Mt 28,20), so dass es zum Schlüsselwort für das ganze Evangelium wird.14 Das Matthäusevangelium veranschaulicht Jesus als den Immanuel, dessen Geschichte sich als Konsequenz der bleibenden Verheißungstreue und des immerwährenden Beistandes Gottes erweist. Mit der Geburt des Immanuel (Mt 1,23) erfüllt sich die Heilszusage Gottes, die ihren genuinen Ort in Israel hat, von Matthäus aber so transformiert wird, dass sie für die Zustimmung aller Völker offen ist. Gott ist in seinem Volk gegenwärtig; Jesus ist Gottes Gegenwart bei seinem Volk auf dem Weg durch die Geschichte. So ist Jesus – als Immanuel – die leibhaftige Bestätigung der Verheißungstreue Gottes. Der nachösterliche Missionsauftrag des Auferstandenen garantiert der Kirche unter allen Völkern die Treue Gottes: „Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“ (Mt 28,20). Das Matthäusevangelium bezeugt nicht nur eine historische Erinnerung des Evangelisten (und seiner Traditionen), sondern weist die durch den Immanuel fortbestehende Verheißungstreue Gottes auf und die darin begründete Verwurzelung der Ekklesia in Israel.
1.2 Der Stand der Forschung
Die unverkennbare Bedeutung sowohl der Immanuel-Christologie als auch der Jüngerthematik im Matthäusevangelium hat zahlreiche Einzelstudien hervorgerufen. Es gibt auch verschiedene Ansätze, beides miteinander zu verbinden, aber meist unter methodischen Voraussetzungen, die nicht mehr dem Stand der Forschung entsprechen, und nur unter speziellen Aspekten, speziell ethischen, aufgezeigt werden. Die relevanten Einzelstudien müssen unter methodischen und thematischen Gesichtspunkten sorgfältig reflektiert werden, damit der Ausgangspunkt der vorliegenden Studie genau bestimmt werden kann.
1.2.1 Zur Methodendiskussion
Die Methodenfragen schlagen auf die inhaltliche Erschließung des Zusammenhanges zwischen Christologie und Ekklesiologie durch. Je nach der Untersuchungsperspektive, die sie wählen, treten der historische Ort, die geschichtliche Wirkung oder die literarische Form des Evangeliums vor Augen.
Redaktionsgeschichte
Eine größere Aufmerksamkeit für die matthäische Theologie ist in der historisch-kritischen Exegese erst durch die Redaktionsgeschichte geweckt worden. Die redaktionsgeschichtliche Methode hat u. a. Willi Marxsen (1919-1993)15 in die Evangelienforschung einbezogen. Er erprobte die redaktionskritische Arbeitsweise programmatisch am Markusevangelium, um besonders die markinische Eschatologie unter dem Gesichtspunkt der Zeitgebundenheit dieses Evangeliums hervorzuheben. Das Arbeitsgebiet der redaktionsgeschichtlichen Exegese wurde dann auf die übrigen Evangelien sowie die Apostelgeschichte erweitert. Für die Exegese des Matthäusevangeliums war Günther Bornkamm (1905-1990)16 wegweisend. Die von ihm gewählte Methode setzten u. a. Wolfgang Trilling (1925-1993)17, Georg Strecker (1929-1994)18 und Reinhart Hummel (1930-2007)19 fort. In der redaktionsgeschichtlichen Matthäus-Forschung gibt es allerdings stark divergierende Positionen. Einerseits markieren Bornkamm und Hummel einen judenchristlichen Standort des Matthäusevangeliums. Der Evangelist Matthäus habe als Judenchrist eine große Nähe zum Judentum gehabt; er schreibe das Evangelium mit einem stark jüdischen Akzent; seine primären Adressaten seien judenchristliche Gemeinden. Andererseits interpretieren Trilling und Strecker das Matthäusevangelium als eine heidenchristliche Schrift. Für sie gehört die matthäische Gemeinde nicht mehr zum Judentum. Matthäus distanziere sich eindeutig vom Judentum (Trilling) und bearbeite judenchristliche Traditionsbestände mit hellenistischen Elementen (Strecker), um so das Heidenchristentum zu erreichen. Beide konträren Positionen sind für das Verhältnis von Christologie und Ekklesiologie ebenso voraussetzungs- wie folgenreich. Deshalb muss es – mit heutigen Methoden – neu bestimmt werden.
Die redaktionskritische Methode entwickelt die historisch-kritischen Antworten auf die Einleitungsfrage weiter, dass Matthäus weder Augenzeuge noch der älteste Evangelist ist, sondern von Traditionen abhängig, die er aufgenommen und neu verbunden hat. Zu den Voraussetzungen gehört gleichfalls die historisch-kritische Analyse der beiden literarischen Vorlagen, von denen das Matthäusevangelium hauptsächlich abhängig ist: nämlich dem Markusevangelium und der Logienquelle. Darüber hinaus aber hat Matthäus auch Sondergut in sein Evangelium aufgenommen.20
Durch die Arbeit der redaktionsgeschichtlichen Schule ergibt sich aber ein Perspektivwechsel in der Art, dass nicht mehr nur nach den ältesten Überlieferungen gefragt wird, sondern dass die Komposition und Intention des ganzen Evangeliums in den Blick kommen, so dass man auch von einer eigenständigen matthäischen Theologie im Unterschied zu einer markinischen und lukanischen sprechen kann. Die Redaktionsanalyse tritt gegenüber der vorwiegend formgeschichtlichen Schule in den Vordergrund. Diese untersucht die sprachliche Gestalt des vorliterarischen Textmaterials im Prozess der Überlieferung, um nach seinem „Sitz im Leben“ zu fragen. Vor dem Hintergrund der Formgeschichte hat die redaktionskritische Methode den „Anspruch, in einem abschließenden, synthetischen Arbeitsschritt die theologische Aussage des Redaktors umfassend zu erheben“, dabei richtet sich der Fokus besonders auf „die Erklärung der Veränderungen, die der Redaktor am Text und am Kontext seiner Vorlagen vorgenommen hat“21 und die damit als Schlüssel zur matthäischen Intention angesehen werden können. Die Unterscheidung zwischen Tradition und Redaktion, die die theologische Aussage des (endgültigen) Textes profiliert, ist in dieser redaktionsgeschichtlichen Methode entscheidend.
Die Redaktionsgeschichte bleibt insofern exegetisch grundlegend, als das Interesse an der typisch matthäischen Konzeption die Besonderheiten des Evangeliums eruieren lässt und im Zuge dessen auch die Genese des matthäischen Textes einen Zugang zur Auslegung eröffnet. Für das Thema bleibt aber die nachösterliche Perspektive des Matthäusevangeliums, die von der Redaktionsgeschichte gefüllt worden ist, wesentlich, weil der Zusammenhang zwischen Christologie und Ekklesiologie genau an dieser Stelle Probleme aufwirft und nach einer Lösung verlangt. Weil nach dem Weg Gottes mit den Menschen in der Nachfolge Jesu gefragt wird, hat die vorliegende Studie ein theologisches Verhältnis zur Diachronie, die methodisch im Interesse der Redaktionskritik steht. Der Weg Jesu und der Weg seiner Jünger, der im Matthäusevangelium dargestellt wird, hat sich in seinem Verlauf und seinen Stationen aus der Jesusüberlieferung entwickelt, die genau an der Verbindung zwischen Christologie und Ekklesiologie interessiert war, insofern sie die Erinnerung an Jesus schärfen und die Orientierung der Kirche ermöglichen wollen.
Allerdings hat die Redaktionsgeschichte die Diachronie nicht mit der Synchronie koordiniert, die aber, wie die Methodendiskussion gezeigt hat, einen Primat haben muss22, wenn die Erzählung und die Theologie des Matthäusevangeliums in den Blick kommen sollen. Dass mittels dieses Arbeitsgangs die literarische und theologische Eigenleistung des Redaktors ins Spiel kommt, ist unverkennbar. Aus diesem Grund werden in dieser Arbeit klassische Instrumente der Diachronie verwendet, aber nicht in einer hermeneutisch dominanten Position, sondern in reflektierter Zuordnung zu synchronischen Untersuchungen.
Wirkungsgeschichte
In der Matthäus-Exegese ist die Methodik über die Redaktionsgeschichte hinaus weiter entwickelt worden. Ulrich Luz postuliert in seinem vierbändigen Matthäuskommentar23 neben der historischen Kritik methodisch den wirkungsgeschichtlichen Ansatz. Dieses exegetische Verfahren ist zumindest für das letzte Jahrhundert beispiellos.24 Seine Versuche, die Auslegungs- und Wirkungsgeschichte in die Exegese zu integrieren, sind von der Problematik der historisch-kritischen Exegese angeregt, dass „sie einen Text in seiner eigenen Zeit und in seiner eigenen Ursprungssituation isoliert und ihn so daran hindert, etwas zur Gegenwart zu sagen“25. Luz räumt dem Problembewusstsein der Wirkungsgeschichte einen besonderen Stellenwert ein. Nach seinem Begriffsverständnis sei Wirkungsgeschichte „das Gesamte der Spuren, welche ein Text in seiner Nachgeschichte durch seine Lektüren hinterlassen hat, und zwar in allen Bereichen des Lebens, also z. B. in der Theologie, in der Kunst, in der Politik, im Recht, in der Frömmigkeit, in der Literatur, in der Philosophie usw.“26. Im Unterschied zur Rezeptionsgeschichte, die die aktive Rolle der Rezipienten bei der Sinngebung betont, zeichne die wirkungsgeschichtliche Exegese die Wirkkraft des Textes und dessen Wirkungen im Wandel der Zeit nach. Sie zeuge von möglichst allen Auslegungsmöglichkeiten, die durch den Text (und dessen Lektüre) freigesetzt sind. Demgegenüber fokussiere die Auslegungsgeschichte sich restriktiv auf die mannigfaltigen Interpretationen in Kommentar- und Predigtwerken im Verlauf der Geschichte. So sei die Wirkungsgeschichte unter die Auslegungsgeschichte subsumiert.27
Entsprechend seiner hermeneutischen Interessen begreift Luz die Texte „nicht so sehr als Reservoir, sondern als Produzenten von Sinn in neuen Situationen“28, und die damit „als das Ganze der Relektüren, Rezeptionen und Aktualisierungen des Evangeliums in neuen geschichtlichen Situationen“29 verstanden werden. Durch die textorientierte Aufarbeitung der matthäischen Texte versucht er, „ihre eigenen Aussagen, ihre Offenheiten und ihre Sinnpotenzen herauszuarbeiten und ihren Richtungssinn im Gespräch mit der Wirkungsgeschichte und im – oft nur impliziten – Blick auf die eigene heutige Situation vorsichtig zu positionieren“30. Dabei dient die historisch-kritische Exegese, die in der biblischen Forschung über hundert Jahre lang vorherrschend war, nicht als ein marginaler Gegenstand, sondern bleibt Teil der wirkenden Geschichte. Die Wirkungsgeschichte hilft das Defizit der historischen Kritik auszugleichen, insofern sie nicht nur die historisch-kritisch zu untersuchende Aussage des Textes hervorhebt, sondern seinen Wortsinn in jeweils neuer Situation erschließt und damit ihn an die Gegenwart übermittelt. Ihre Beziehung zur historisch-kritischen Exegese kann daher „im Sinne einer Erweiterung des Methodenangebotes“31 gedeutet werden.
Durch die wirkungsgeschichtlich orientierte und dadurch exegetisch bereicherte Textauslegung wird das Problembewusstsein der Exegese geschärft. Die wirkungsgeschichtliche Exegese gewinnt ihre Bedeutung nicht im bisherigen Paradigma von Diachronie und Synchronie32. Sie richtet sich „gegen alle mithilfe von Textinterpretationen legitimierten Absolutheitsansprüche“33 und weist eine Vielfalt von Interpretations- und Applikationsmöglichkeiten nach. Das gesamte Spektrum aller möglichen Deutungsvarianten zeigt die Erweiterung des Verstehenshorizonts. Positiv heißt das, dass die Auslegungsgeschichte sich nicht nur mit der Vergangenheit beschäftigt, sondern schon im Prozess der Textauslegung immer auch auf die Zukunft ausgerichtet ist. Die Texte werden in einer jeweils neuen Erfahrungswelt des Interpreten rekontextualisiert und reaktualisiert. Sie werden auf eine dialogische Kommunikationsebene der wirkenden Geschichte gehoben, die nicht nur Potenziale auslotet, sondern Bedeutungen generiert.
Wirkungsgeschichtliche Exegese bringt aber nicht nur die positive Seite der Textauslegung hervor. Sie hat auch den Nachteil, dass die kritische Funktion des Textes gegenüber der Auslegung strukturell reduziert wird. Insofern jeder einen Text anders interpretieren kann, gibt es nicht nur keine endgültig richtige Auslegung; es stellt sich auch die Frage, ob und wie richtige von falschen Auslegungen unterschieden und missbräuchliche Verwendungen biblischer Texte kritisiert werden können. Für die Unterscheidungen sind bestimmte Kriterien nötig, so dass wirkungsgeschichtliche Spurensuche nicht als bloßer Stimmenwirrwarr angesehen werden kann. Vor der Debatte um die Normativität und Relevanz der Textauslegungen diskutiert Ulrich Luz, wie die verschiedenen Interpretationsweisen der dreidimensionalen Wahrheitsfrage gerecht werden: 1) Inhaltlichtheologisch sind neutestamentliche Texte Christuszeugnisse. Christus gibt der Textinterpretation die Leitlinie. 2) Für die Identität der Kirche wird eine ekklesiologische Deutungshoheit für Interpretationen beansprucht. 3) Die Wahrheit biblischer Texte ist mit der Frage nach ihren Folgen verbunden. Pragmatisch beschäftigt sich die Textinterpretation mit den Auslegungen, die die Nachgeschichte der Texte hinterlassen hat.34 Alle drei Aspekte sind für die Fragestellung dieser Studie virulent und müssen kritisch in ein konstruktives Verhältnis zueinander gebracht werden.
Das Matthäusevangelium ist bereits ein Teil der Wirkungsgeschichte der Jesus-Überlieferung, mit der die Auslegungsgeschichte der Kirche einsetzt.35 Es gibt aber keinen wirkungsgeschichtlichen Versuch in der Weise, dass das Verhältnis von Christologie und Ekklesiologie an den entscheidenden Stellen im Licht der Auslegungstradition erschlossen wird. Denn die Problematik ist eine spezifisch moderne, die nur unter den Bedingungen der historischen Kritik in voller Schärfe aufbricht. Aber indem die Studie das Verhältnis von Christologie und Ekklesiologie erörtert, geht sie an den Anfang dessen, was überhaupt „Wirkungsgeschichte Jesu“ genannt werden kann, zurück. Sie fragt nach den – der Überlieferung zufolge – von Jesus selbst gegebenen Impulsen, die zuerst dem Jüngerkreis überliefert und von diesem dann weitergegeben wurden. Auf diesen Anfang muss sich die vorliegende Studie beschränken.
Eine weitgehend offene Frage ist das Verhältnis der wirkungsgeschichtlichen zur historisch-kritischen Exegese. Die bei Ulrich Luz angefertigte Dissertation von Moisés Mayordomo-Marín36 bringt am Beispiel des Prologs des Matthäusevangeliums (Mt 1-2) den Ertrag einer konsequent rezeptionskritischen Fragestellung ein. Die Position der historisch-kritischen Exegese verbindet er mit literaturtheoretischen und rezeptionsästhetischen Entwürfen. Mayordomo-Marín unternimmt allerdings diese stark leserorientierte Arbeitsweise37 „keineswegs als Ersatz für historisch-kritische Exegese, sondern viel eher als einen Versuch, die Möglichkeiten auszuloten, die verschiedene moderne literaturwissenschaftliche Rezeptionsmodelle für eine Methodenintegration bieten können“38. Mit seiner rezeptionskritischen Untersuchung erweitert sich der Raum für die methodenkritischen Reflexionen, so dass eine Pluralität der hermeneutischen Disziplinen zur Bibelauslegung ermöglicht wird. Aber angesichts der Fokussierung auf die Leserwelt bleibt die Frage nach dem geschichtlichen Sinn des Textes.
Narratologie
Als Gegenbewegung zur historisch-kritischen Arbeitsweise der Exegese entstand die stark synchron orientierte Methode, u. a. die narrative Analyse. Dieser Methodenschritt verfolgt einen „Primat der Synchronie“ gegenüber der Diachronie. Er untersucht nicht den Ursprung der Texte; er sieht von ihrer Entstehungsgeschichte und -situation ab. Gegen die situative Orientierung der Exegese richtet sich sein Augenmerk „auf die literarische Integrität der Endfassung, d. h. kanonische Form der Texte, und auf die Textwelt“39. Die in sich abgeschlossenen, erzählerisch-literarisch kohärenten Texte sind Gegenstand dieser Erzählforschung. Ebenso wie das Markusevangelium wird auch das Matthäusevangelium mit Hilfe narratologischer Analyseverfahren aus der modernen Sprach- und Literaturwissenschaft exegesiert, vor allem im englischsprachigen Raum entwickelt und verbreitet.40
Beachtenswert ist in der deutschsprachigen Exegese für das Matthäusevangelium eine narratologische Studie von Uta Poplutz.41 Sie arbeitet in ihrer Untersuchung den narrativen Charakter des Evangeliums heraus. Sie liest – angeregt durch Luz’ Werk „Die Jesusgeschichte des Matthäus“ – das Matthäusevangelium in erster Linie „als kontinuierliche Erzählung, mit anderen Worten als die Geschichte Jesu, welche einen sinnvollen Spannungsbogen bildet“42. Für sie ist die narratologische Theoriebildung der Ausgangspunkt für ihre Auslegung des Evangeliums. Sie zeigt Vorzüge des narratologischen Ansatzes für die Bibelexegese auf. Die erzähltheoretische Lektüre könne „mit einem vergleichsweise geringen methodischen Aufwand und ohne weitere Hilfsmittel“43 durchgeführt werden. Die narrative Analyse weist auf die Notwendigkeit hin, die Logik der Erzähltexte zu erhellen. Dafür sei die Grundkenntnis der Sprache unbedingt relevant – weniger die wissenschaftlichen Bemühungen. Erzählungen reichen über die geschichtliche Realität hinaus. Sie fungieren „als ein vordergründiger, auf den ersten Blick objektiv erscheinender Tatsachenbericht: Erzählungen stellen Gegenwärtigkeit her – sie nehmen die Leserin und den Leser mit in das Geschehen hinein. Damit erfüllen sie eine wichtige Funktion zur Erzeugung von Kohärenz“44. Poplutz nimmt aber auch die Grenze dieser Verfahrensweise wahr, die nicht zu übersehen ist, nämlich die immanente Struktur der erzählten Textwelt. Die Narratologie funktioniert synchronisch, konzentriert sich also auf die kohärent strukturierte Größe des Evangeliums. Als komplementäre Methoden müssen aber historisch-kritische wie wirkungsgeschichtliche Exegese in Betracht gezogen werden. So entsteht ein neuer „Methodenkanon“45. Er weist den Erzählungen einen festen Platz in der zeit- und sozialgeschichtlichen Situation ihrer Entstehung zu, so dass die Texte in ihrem Kontext gelesen und analysiert werden können. In diesem Netzwerk kann die Fragestellung der Narratologie sachgemäß erweitert und präzisiert werden.
Die Lücke, die zwischen der historisch-kritischen Methode und der narrativen Analyse besteht, versucht die in jüngster Zeit erschienene Dissertation von Sönke Finnern46 zu füllen. Wie der Titel besagt, ist sie eine narratologische Studie. Finnern zeigt in seiner Arbeit eine geschichtliche und theoretische Ausführung zur Erzählanalyse, deren Ertrag am Beispiel der matthäischen Ostergeschichte (Mt 28) erprobt wird. Finnern verabsolutiert dabei aber die Narratologie nicht. Er gibt die strenge Unterscheidung von Diachronie und Synchronie auf. Von ihm wird eher ein „kognitiv ausgerichtetes Modell“47 als das neue, umfassende Konzept zur Erzählanalyse vorgestellt. Der reale Rezipient kann demnach die Texte erst aufgrund seines (historisch und kulturell variablen) Vorwissens und seiner kognitiven Verstehensschemata verstehen. Die statischen und dynamischen Situationen der Leser verändern sich. Sie führen bei der Analyse von Erzählungen zu Verhaltensänderungen. Die Kommunikationsebene der Texte ist damit variabel. Die Untersuchung von Finnern kommt zu dem Ergebnis, dass die Erzählanalyse aus der Sicht der „kognitiven Wende“ mit dem historisch-kritischen Methodenensemble vereinbar ist. Sie bietet in der Kombination von Erzählanalyse und historisch-kritischer Methode einen integrativen Ansatz der biblischen Exegese.
Die Bochumer Habilitationsschrift von Robert Vorholt48 versucht, „mit exegetischen Mitteln aufzuzeigen, inwiefern theologische Grundparadigmen der Rede von der Auferweckung des Gekreuzigten durch das neutestamentliche Osterkerygma eine erzählerische Entfaltung erfahren haben, und zugleich zu begründen, weshalb die narrativen Elemente der österlichen Botschaft zum Kern und Wesen des Osterglaubens selbst gehören“49. Vorholt will die Ostererfahrung, die am Anfang des Osterglaubens steht (z. B. das leere Grab und die Erscheinungen des Auferstandenen), nicht nur historisch und theologisch einholen. Er hat auch das Ziel, „zu klären, was es theologisch bedeutet, dass sich diese österliche Erfahrung elementar in Erzählungen äußert“50. Diese narratologische Studie widmet sich allerdings nicht allein der Hervorhebung der matthäischen Theologie. Sie zeigt vielmehr den gesamten Sinnhorizont der Osterereignisse auf, die von allen vier Evangelisten in großer Übereinstimmung, aber auch mit unterschiedlichen Aspekten berichtet werden. Vorholt nimmt als ein hermeneutisches Defizit der Narratologie wahr, dass die Frage nach dem geschichtlichen Sinn der Geschehnisse ausgeblendet wird. Die narratologische Methodik wurde anhand fiktionaler Literatur entwickelt. Die kanonischen Osterevangelien werden hingegen „unter dem Anspruch formuliert, historische Wirklichkeit festzuhalten und somit beglaubigenden Zeugnischarakter zu haben“51. Vorholt konfrontiert mit der Herausforderung der Exegese, „Modus und Gehalt des Ostergeschehens auf der Grundlage des biblischen Zeugnisses zu beschreiben und es in seinem Wirklichkeits- und Wahrheitsanspruch vor dem neuzeitlich geprägten Forum der Vernunft kategorial wie inhaltlich zu bestimmen“52. Seine Untersuchung genügt diesem Anliegen, indem einerseits die Fundamente des Osterglaubens methodisch und inhaltlich abgesichert, andererseits die narrativen Strukturen der Osterevangelien untersucht werden. Für Vorholt sind historisch-kritische Exegese und narratologische Analyse integrierbar. Er entwickelt und kombiniert in seiner Studie geschichtshermeneutisches und narrationsanalytisches Verfahren.
Ergebnis und Ausblick
Die aktuelle Ausrichtung der Bibelexegese zeigt eine mittlerweile stark synchrone Orientierung. Das heißt nicht, dass die herkömmlichen Methoden in der Auslegung des Evangeliums bedeutungslos geworden wären.53 Der neue Trend der Bibelexegese verzichtet auf die eindeutige Trennung von Diachronie und Synchronie, versucht vielmehr in vielfältiger Weise54 beide in ein kommunikatives Beziehungsverhältnis zu setzen. Auch für die Kennzeichnung der Theologie des Matthäus wird nicht ein methodisches Instrumentarium gebraucht, sondern eine Integration beider exegetischer Zugangsweisen von Diachronie und Synchronie bevorzugt. Es bleibt aber umstritten, inwiefern dieser integrative Ansatz im Textfeld zugänglich ist und durchgeführt werden kann.
Die vorliegende Arbeit gewährt der narrativen Analyse eine wichtige exegetische Position, weil ihre Grundlinie sich orientiert an der Erzählung. Der Weg Gottes mit den Menschen wird im Rahmen des Evangeliums erzählerisch entfaltet. Die Erzählung wird zumal in die matthäische Tradition eingeordnet, weil gerade die Verbindung des Weges Jesu mit dem seiner Jünger untersucht werden soll. Die Erzählung wird konsequent auf den Jünger bezogen, von dem erzählt wird. Es handelt sich um die qualifizierte Wirkung Jesu, die in die Kirche ausstrahlt, aber vom bestimmenden Anfang her erschlossen werden soll.
1.2.2 Zu den Themen
In der Matthäus-Forschung ist das Kirchenverständnis ein wichtiges Thema.55 Eine Reihe von Aufsätzen und Monographien untersucht, welche Bedeutung ἐκκλησία (Mt 16,18; 18,17) bei Matthäus hat. Sie setzen sich mit der Fragestellung auseinander, wie sich die Kirche und Israel zueinander verhalten und wie in dieser Beziehung das Volk Gottes bestimmt ist. Das Verhältnis des Matthäus zum Judentum und sein Missionsverständnis sind dafür entscheidend. Ein Schwerpunkt ist die Darstellung der Jünger als Nachfolger Jesu; die „Jünger“ (μαθηταί) sind nach Matthäus für die nachösterliche Gemeinde die wichtigsten Identitätsfiguren (vgl. z. B. Mt 18,1-35). Sie sollen nach dem Sendungsauftrag des Auferstandenen zu seiner Nachfolge aufrufen und zur universalen Mission aufbrechen (vgl. Mt 28,16-20). Aber die Untersuchungen zum matthäischen Kirchenbild bleiben unzureichend, wenn die Begründung in der Christologie56 nicht genau beachtet wird. Matthäus spricht in seinem Evangelium keineswegs von der Kirche im Allgemeinen, sondern von der Kirche, die Jesus begründet hat (vgl. Mt 16,18). Die Jünger folgen dem Nachfolgeruf Jesu und partizipieren an seiner messianischen Sendung, so dass sie Jesu Person und Wirken repräsentieren. Die ekklesiologischen Elemente müssen auf der Grundlage der Christologie bestimmt werden.
Die Kirchenvorstellung des Matthäus ist mit der Ethik untrennbar verbunden. Dies ist für die christologische Begründung der Ethik nicht unwichtig – allerdings bereits untersucht, so dass diese Spur in dieser Studie nicht eigens verfolgt zu werden braucht. Durch Identifizierung der nachösterlichen Gemeinde mit den Jüngern wird Jesu Lehre in der Geschichte weitergetragen, welche sich in den großen Redekompositionen, besonders in der Bergpredigt (Mt 5-7), inhaltlich-sachlich entfaltet; sie orientieren das menschliche Handeln am „Willen des Vaters“ (Mt 7,21; 12,50), so dass jene, die Jesus nachfolgen, den „Weg der Gerechtigkeit“ (Mt 21,32) nicht verfehlen, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer ihn verfehlen, wenn sie die „überfließende Gerechtigkeit“ (Mt 5,20), die Jesus lehrt, nicht erkennen. Die Matthäus-Exegese erforscht die Bergpredigt als Programmtext der Ethik Jesu, um den Jüngern (und der christlichen Gemeinde) das wahre Ethos der Nachfolge als Norm zu vermitteln.57 Für die Bildung der Gemeinde sind die ethischen Weisungen Jesu verbindlich. Sie verdanken sich dem (alttestamentlichen) Gesetz. Dieses wird in göttlicher Vollmacht ausgelegt (vgl. Mt 5,17-20). So liefert die Christologie des Matthäus den Schlüssel zum Verständnis des Gesetzes und damit zum Leben der Kirche. Allerdings ist die Forschung kontrovers. Zur Diskussion steht die Grundfrage nach der Übernahme oder Ablehnung der Tora, ihrer Verbindlichkeit oder Ablösung.58
Offenbar ist die Christologie das Fundament des Matthäusevangeliums. Die matthäische Theologie ist von der Überzeugung bestimmt, Jesus als der Sohn Gottes sei der erwartete Messias, der die Heilsverheißung Gottes erfüllt.59 Die Christologie hat somit einen herausragenden Stellenwert im Matthäusevangelium. Die Matthäusforschung beschäftigt sich dagegen aber mehr mit dem matthäischen Schlusstext (Mt 28,16-20)60 und den christologischen Titeln (z. B. der Gottessohn, der Menschensohn)61 als mit der narrativen Struktur der Jesusgeschichte im gesamten Evangeliumszusammenhang.62 Wie Donald Senior hervorhebt, „one should view the whole narrative and its impact on the reader as the medium for communicating Matthew’s theology“63. Er versteht die Christologie als „the summation of the meaning it assigns to the life, ministry, destiny, and person of Jesus“64. Die Exegese steht also vor der Herausforderung, dieses thematische Defizit in der matthäischen Forschung aufzuarbeiten.
Die vorliegende Arbeit widmet sich weder allein der Ekklesia-Thematik noch der Christologie, sondern setzt sich darüber hinaus mit der theologischen Fragestellung auseinander, wie Christologie und Ekklesiologie im Matthäusevangelium miteinander verbunden sind. In diesem Forschungsfeld gibt es Ansätze, die aber unterschiedliche Perspektiven und Akzentuierungen zeigen.
Günther Bornkamm
In einem redaktionsgeschichtlich programmatischen Beitrag „Enderwartung und Kirche im Matthäus-Evangelium“ (1956)65 zeigt Günther Bornkamm den Zusammenhang von Eschatologie, Ekklesiologie und Christologie auf. Er setzt dabei voraus, Matthäus habe die urchristliche Überlieferung, also die literarischen Quellen, so sorgfältig und planmäßig bearbeitet, dass seine theologische Konzeption anhand dieser Veränderungen dargestellt werden kann. Als Kennzeichen des Matthäusevangeliums gelten u. a. die Redekompositionen; aus ihrer Analyse ergebe sich, dass das Kirchenverständnis des Matthäus von der Erwartung des kommenden Gerichts geprägt sei. Die matthäisch spezifische Komposition zeige also eine „eigentümliche Verbindung von Enderwartung und Kirchengedanken“66. Die Klammer zwischen beiden bestehe „im Verständnis des Gesetzes und damit der neuen Gerechtigkeit, die die Jünger Jesu von Pharisäern und Schriftgelehrten unterscheidet, zugleich aber der Maßstab ist, nach dem die Glieder der Kirche selbst von dem kommenden Richter erst gerichtet werden“67. Das Matthäusevangelium entstand laut Bornkamm im jüdischen Milieu, sein Gesamtentwurf zeige damit eine stark jüdische Ausprägung. Vor diesem Hintergrund sei das Gesetz nicht unwichtig, um den jüdischen Charakter des Evangeliums zu bezeichnen. Nach Bornkamm versteht Matthäus das Gesetz nicht im Gegensatz zum Judentum, sondern „stellt sein Gesetzesverständnis bewusst in die jüdisch-schriftgelehrte Tradition“68. Die Frage nach der rechten Gesetzesauslegung sei aber strittig. Matthäus polemisiere gegen das Konzept der Gesetzesauslegung und die Diskrepanz zwischen Lehren und Tun bei den Gegnern Jesu. Er gewinne damit „sein radikales Verständnis des Gesetzes, indem er es sub specie principii, im Licht des in der Schöpfung kundgewordenen Willen Gottes, aber erst recht sub specie iudicii, im Sinne des universalen Weltgerichtes versteht, dem alle und gerade auch die Jünger entgegengehen“69. Diese konsequente und radikale Rezeption des Gesetzes bestimme das Kirchenverständnis bei Matthäus, sie sei aber in seiner Christologie begründet. Im Matthäus-evangelium erscheine Jesus als ein zweiter Mose, dessen Geschichte von der Erfüllung des Gesetzes (Mt 5,17) bestimmt wird. Seine messianische Würde werde von der Autorität der Schrift ausgewiesen.
Die Fülle christlicher Aussagen werde, so Bornkamm, nicht schon mit einer Reihe von ekklesiologischen Begriffen und Motiven ausgeschöpft. Aber es sei möglich, dass die Jüngerschaft die Messianität Jesu und seine Lehre vertrete. Der „Jünger“ habe im Matthäusevangelium nicht dieselbe Position wie der Schüler eines jüdischen Lehrers. Seine Identität werde von der Berufung in die Nachfolge und der Beauftragung zur Verkündung der Gottesherrschaft (Mt 10,7) und zur Lehre der Gebote Jesu (Mt 28,20) begründet. Die nachösterliche Jüngerschaft stehe mit Jesus nicht so in Verbindung, wie man in Verbindung mit einem Rabbi der Vergangenheit verbunden sein könne, sondern werde von der Beistandszusage des erhöhten Kyrios begleitet (Mt 28,20; vgl. 18,20). Das Kirchenverständnis des Matthäus habe auf diese Weise in der Christologie seine Entsprechung und Begründung (vgl. Mt 16,17-19 im Kontext von 16,13-28).
Auswertung: Bornkamms Untersuchung, die redaktionsgeschichtlich angelegt ist, zeigt großes Interesse am matthäischen Kirchenbild. Die Kirche ist eschatologisch ausgerichtet, wie die spezifisch matthäischen Redekompositionen ausweisen. Sie richtet ihren Blick auf den letzten Tag, wobei die Gerechten sich von den Ungerechten nach dem Maßstab der „besseren Gerechtigkeit“ (Mt 5,17-19) unterscheiden werden. Das Gesetz kommt durch die messianische Lehre Jesu zur Geltung. Jesus bestimmt gleichzeitig das Wesen der Kirche mittels seiner vor- und nachösterlichen Verbindung zur Jüngerschaft. Bornkamm arbeitet das Verständnis der Kirche bei Matthäus im eschatologischen und christologischen Zusammenhang heraus. Demgegenüber wird in dieser vorliegenden Studie die Aufmerksamkeit in erster Linie auf die direkte Verbindung von Christologie und Ekklesiologie gerichtet. Die Eschatologie wird nicht in direkter Verbindung zur Ekklesiologie behandelt, sondern ist in die christologische und ekklesiologische Themendarstellung mit einbezogen. Ihre große Bedeutung im Matthäusevangelium (z. B. Mt 24-25) ist aber keineswegs zu unterschätzen.
Georg Strecker
Die Habilitationsschrift von Georg Stecker „Der Weg der Gerechtigkeit“ (1962) hat neben dem einleitenden Teil zwei Hauptteile, nämlich einen christologischen und einen ekklesiologischen. Diese klare Arbeitsgliederung zeigt an, dass Strecker für die theologische Konzeption des Evangelisten den Fokus insbesondere auf die Christologie und Ekklesiologie richtet. Beide Perspektiven sind davon geprägt, dass er Matthäus in der Darstellung Jesu eine historisierende Tendenz zuschreibt, deren theologische Qualität bei Strecker in Verbindung mit der Eschatologie und der Ethik gewonnen wird; so entstehe eine Vorstellung von Heilsgeschichte.
Strecker hebt hervor, das Evangelium sei „als Darstellung des Lebens Jesu seinem Wesen nach primär christologische Aussage“70. Seine Untersuchung widmet sich daher zunächst – und umfänglich – der Christologie des Matthäus, die dann durch die historischen und die eschatologischen Bezüge herausgestellt wird. Nach Strecker deutet Matthäus unter der Bestimmung einer Historisierungstendenz seine Christologie historisch, wie es sich in der Zeitanschauung, den geographischen und den sachlichen (Israelthematik und Jesus als Davidssohn) Vorstellungen zeigt71. Er hebe die Zeit Jesu als einen einmaligen Ausschnitt aus der Vergangenheit hervor. Er blicke von seiner Gegenwart auf den besonderen Zeitabschnitt Jesu in der Vergangenheit. Er zeichne eine kontinuierliche Linie von der Geburt bis zum Tod und zur Auferstehung, um der Biographie Jesu den historischen Charakter zu verleihen. Seine christologische Aussage als „ein der Vergangenheit angehörendes, zeitlich und räumlich fixierbares ‚Objekt‘“72 schließe jedoch nicht mit einem in sich geschlossenen Teil des Zeitablaufes, sondern deren Deutungshorizont werde dadurch erweitert, dass einerseits die Geschichte Israels als eine Vorgeschichte des Evangeliums vorgestellt (Mt 1,1-16) wird und andererseits eine neue Epoche, die Zeit der Kirche und ihrer Mission, nach der Auferstehung angedeutet ist (Mt 28,16-20). Der Zeitabschnitt des Lebens Jesu habe auf der historischen Ebene eine besondere Bedeutung, sei aber zugleich „von dem noch ausstehenden, Gericht und Heil bringenden Ende der Geschichte deutlich abgehoben“73. Die theologische Bedeutung Jesu sei nicht allein auf der Grundlage der Historie zu beschreiben. Jesus sei nicht nur der historische, sondern der eschatologische Kyrios, der gekommen ist. So werde sein Leben nicht zuletzt durch die Verkündigung gekennzeichnet, die sich als ethische Belehrung versteht, also als „Forderung, die durch den Blick auf das Eschaton motiviert ist, daher eschatologischen Anspruch erhebt“74. Der historische Moment werde jedoch nicht dem eschatologischen untergeordnet, umgekehrt aber auch nicht. Die Christologie des Matthäus sei nicht durch die Alternative „historisch“ oder „eschatologisch“ zu erschließen, sondern durch die Zusammenschau beider Aspekte. Insofern könne man das Leben Jesu „in den Kategorien der ‚Heilsgeschichte‘ begreifen, in der die lineare Periodisierung mit der eschatologischen Heilsbedeutung der Zeit zur Einheit verbunden ist“75. In der Mitte dieser Heilsgeschichte werde die eschatologische Forderung verkündet und vorbildhaft durch das Handeln Jesu praktiziert – z. B. bei seiner Taufe und seiner Passion.
Die Zeit Jesu, die von den Propheten vorausgesagt war, weite sich nach der Ablehnung der Vorrechte Israels mit der Zeit der Kirche aus. Daher beginne mit der Auferstehung eine neue Periode der Heilsgeschichte, die von der Zeit Jesu abgehoben ist. Sie stehe allerdings in Verbindung mit der Vergangenheit. Sie bekomme vom Leben und Werk Jesu Sinn und Aufgabe. Die christologische Aussage finde in der ekklesiologischen einen Niederschlag. Matthäus charakterisiere seine Ekklesiologie durch die „Jünger“; sie bezeichneten die geschlossene Gruppe, die dem Herrn gegenübersteht. Sie bildeten zugleich die spätere Gemeinde im Voraus ab. In der Historisierungstendenz des Evangelisten sei der μαθητής-Begriff den Zwölf vorbehalten. Sie seien die Augen- und Ohrenzeugen des Lebens Jesu. Sie würden in der Aussendungsrede mit ihm parallelisiert, da sie durch ihre Machttaten das Eschaton vergegenwärtigen. In der Darstellung ihrer Gestalt spiegele sich die historisierende Akzentuierung wider, die aber durch das Petrusbild in ekklesiologischem Sinn typologisiert wird. Die Sendung der Jünger an alle Völker (Mt 28, 16-20) sei der Anfang der Kirche, so dass die Verbindung mit der heilsgeschichtlichen Periode gesichert ist. Die Ekklesiologie erlange eschatologische Qualität dadurch, dass die Gemeinde sich an den ethischen Forderungen Jesu ausrichte; sie solle in der Nachfolge Jesu die eschatologische Gerechtigkeit erfüllen. Sie sei aber fortwährend von der Versuchung der Sünde bedroht. Ihre christliche Existenz werde „durch eine ständige Bewegung zwischen Bejahung und Verneinung, Erfüllung und Nichterfüllung des eschatologischen Imperativs“76 charakterisiert. Für die Vollkommenheit hat deshalb dieses corpus mixtum die Paränese notwendig.
Auswertung: Streckers Untersuchung zielt auf die Rekonstruktion der Heilsgeschichte ab. Das irdische Leben Jesu – von der Geburt über sein öffentliches Wirken bis zum Tod und zur Auferstehung – vollzieht sich auf der historischen Ebene. Das Heilsgeschehen durch Jesus entfaltet sich mit der Sendung der Kirche weiter, jedoch unter der Voraussetzung der Ablehnung Jesu durch Israel. Die Zeit der Kirche ist am letzten Gericht Gottes orientiert. Die ethischen Forderungen an die Jünger als Gegenstand der Basileia-Verkündigung Jesu sind schon eschatologisch ausgerichtet. Bei Strecker ist die Heilsgeschichte von der Historisierungstendenz bestimmt. Christologie und Ekklesiologie bewegen sich auf der historischen Ebene. Die Geschichte Jesu beruht aber m. E. nicht nur auf der historischen Erinnerung, sondern hat einen bleibenden Gegenwartsbezug. Sie gewinnt ihre Bedeutung dadurch, dass sie durch die Sendung der Kirche fortbesteht und damit transparent bleibt.
Eduard Schweizer
Die Frage, welches Verhältnis von Christologie und Ekklesiologie im Matthäusevangelium besteht, leitet auch Eduard Schweizer für seine Matthäus-Forschung77. Im Vorwort erwähnt er explizit, ihn habe besonders der „Zusammenhang der Ekklesiologie des Matthäus mit seiner Christologie interessiert“78. Als Schwierigkeit erkennt Schweizer jedoch, dass „Matthäus nie seine Theologie oder Christologie bewußt darlegt“, während bei Markus „schon der Aufriß des Evangeliums als ganzes eindeutig auf die Christologie zugespitzt“79 ist. Nach Schweizer zeige das Matthäusevangelium mehr das ekklesiologische Interesse als das christologische. Er sehe das Verständnis der „Gemeinde“ (Mt 16,18; 18,17) als sein zentrales Thema an.
Vor dem Hintergrund, dass das Matthäusevangelium eine stark judenchristliche Prägung hat, denkt Schweizer an eine Gemeinde, „die in einem noch ganz vom Judentum bestimmten Bereich lebt und die jüdische Synagoge quer über der Straße stehen sieht“80. Die christliche Gemeinde sei an die Stelle Israels getreten, aber nicht so, dass sie sich als das „neue Israel“ verstände, sondern als das „andere Volk, dem jetzt der Weinberg Gottes übergeben ist“81. Sie sei die (neue) Gemeinde Jesu, die Jüngerschaft, die angehalten ist, den Willen des himmlischen Vaters zu tun. Sie höre niemals auf, sondern gehe mit der Verheißung des Auferstandenen (Mt 28,20) durch die Zeit weiter. Die Zugehörigkeit zu ihr bedeute aber nicht die Garantie des Heils. Die „Gemeinde“ sei ihrem Wesen nach ein corpus mixtum, eine Größe, in der Gute und Böse zusammenleben. Die Gemeindeglieder bedürfen deshalb der ethischen Weisung des Gesetzes Gottes in den Geboten Jesu und der Vergebung der Sünden, so dass sie – im Unterschied zu Israel – Früchte bringen. Ansonsten drohe auch ihnen das letzte Gericht Gottes, wenn der Menschensohn als Richter kommt.
In seiner Untersuchung legt Schweizer das Hauptgewicht auf die Darstellung des Wesens und der Rolle der Gemeinde. Er erklärt die Ekklesiologie des Matthäus durch seine Christologie. Nach ihm bestehe im Aufriss des Evangeliums eine „enge Zusammengehörigkeit des Schicksals und Handelns Jesu mit dem seiner Jüngerschar“82. Matthäus stelle Jesus als den kommenden Menschensohn-Richter und als die „inkarnierte Weisheit“83 vor. Insofern aber Gottes Weisheit in Israel mit dem Gesetz gleichgesetzt worden ist (vgl. Sir 24,23; Bar 4,1), sei in Jesus Gottes Gesetz Fleisch geworden. Nach Schweizer macht Matthäus allerdings keine Aussage über Jesu Präexistenz wie Paulus und Johannes. Er spreche von Jesu „Tätigkeit als des vollmächtigen und abschließenden Interpreten des Willens Gottes, wie dieser im Gesetz schon ausgedrückt ist“84. Jesus ermögliche durch sein Vorausgehen die Nachfolge. Die Ekklesiologie sei ihrerseits Christologie, wenn die „Gemeinde“ in der Nachfolge Jesu durch ihren prophetischen Verkündigungsdienst das Gesetz, das Gebot der Liebe, wirklich erfüllt.
Auswertung: Schweizer legt eine stark ekklesiologisch orientierte Arbeit vor, wobei besonders das matthäische Gemeindeverständnis im Mittelpunkt steht. Dennoch gibt er seine Aufgabe, den Zusammenhang von Christologie und Ekklesiologie zu erschließen, nicht auf, sondern kommt ihr nach, indem er die Ekklesiologie in einen deutlichen christologischen Bezug stellt. Die „Gemeinde“ gewinnt ihre existenzielle Identität in der Nachfolge Jesu dadurch, dass sie – wie die Jünger – in Beziehung zu ihm steht. Die thematisch-sachliche Entfaltung der Arbeit geht darauf zurück, dass die matthäische Christologie gegenüber der markinischen abgewertet wird. Aber die Tatsache, dass Schweizer die Christologie des Matthäusevangeliums wenig beachtet, ist zu kritisieren. M. E. enthält das Matthäusevangelium gegenüber dem Markusevangelium eine hohe, eigenständige Christologie.
Georg Künzel
Die Erlanger Dissertationsschrift von Georg Künzel „Studien zum Gemeindeverständnis des Matthäusevangeliums“85 weist in ihrem Titel darauf hin, dass diese Abhandlung sich dem ekklesiologischen Thema widmet. Welches Gemeindeverständnis im Matthäusevangelium vorherrscht, ist die Grundfrage der redaktionsgeschichtlich angelegten Arbeit. Die Darstellung der matthäischen Ekklesiologie bezieht sich auf 1) das Selbstverständnis, 2) die Funktion und 3) die Vollmacht der Gemeinde.
Zu 1): Der Autor legt dar, die Gemeinde lebe „zwischen zwei Polen: der Offenbarung des Gottesrechtes, die sich im Jesus-Geschehen vollzogen hat, und der Durchsetzung des Gottesrechtes, die sich bei der Ankunft des Menschensohnes vollziehen wird“86. Sie werde von den „Jüngern“ repräsentiert. Sie ständen dem Volk gegenüber, insofern sie die Basileia-Verkündigung Jesu verstehen. Das „Verstehen“ komme ihnen zu; es bedeute „die Einsicht, die dazu befähigt, anders als das Volk, dem die Erkenntnis der Geheimnisse des Himmelreiches nicht gegeben ist, das Wort vom Reich zu hören und Frucht zu bringen“87. Die Jüngerschaft sei an der Verbundenheit mit Jesus erkennbar. Durch Nachfolge, Leidensbereitschaft und Gehorsam gewinne sie ihr Kennzeichen.
Zu 2): Die Gemeinde als die Jüngerschaft Jesu habe eine doppelte Funktion. Einerseits habe sie die prophetische Wirksamkeit (Mt 10,41; 23,34), die „im Kontext der Bemühung um die Verwirklichung der mt verstandenen δικαιοσύνη geschieht und die Konsequenz der Verfolgung zu übernehmen bereit ist“88. Andererseits fungieren die Gemeindeglieder als christliche Schriftgelehrten (Mt 13,52), die um das Gerechtsein ringen, das Wort vom Reich verstehen und damit Frucht bringen.
Zu 3): Die „Wirkungsformen der Gemeinde“89 würden an den Petrustexten vorgeführt. Es handele sich um die Geschichte des Petrus von seinem Glauben (Mt 14,29), seinem Bekenntnis (Mt 14,33; 16,16), seinem Kleinglauben (Mt 14,31) und Versagen (Mt 16,23; 26,69ff.). Diese Aussage erhalte „eine seelsorgerlich relevante Modell-Funktion“90. Die matthäische Gemeinde finde in Mt 16,19 und 18,18 „Ursprung und Urbild der von ihr geübten lehrmäßigen und disziplinarischen Vollmacht“91. Sie werde von der Vollmacht der Vergebung, dem charismatischen Handeln und der missionarischen Vollmacht weiter geformt und belebt.
Offenbar ist das Gemeindebild im Matthäusevangelium das Zentralthema der Arbeit. Da Künzel aber „das Geschichtsverständnis des Matthäus-Evangeliums als Rahmen für das matthäische Gemeindeverständnis aufzeigen will“92, braucht seine Untersuchung ein weiteres Bezugsfeld der Geschichtstheologie. Dieser Arbeitsschritt rechtfertige sich mit der Beobachtung, dass Matthäus „nicht nur an der gegenwärtigen Situation der Kirche interessiert ist, sondern als Theologe die Existenz der Kirche Jesu vor dem Hintergrund der Geschichte des at. Gottesvolkes reflektiert“93. Das geschichtstheologische Konzept im Matthäusevangelium sei aber zuerst durch die Person und die Geschichte Jesu ausgelegt. Die alttestamentlich-prophetischen Zeugen fänden ihre göttliche Beglaubigung im Jesusgeschehen. Der Heilsweg Gottes zu allen Völkern hin beginne mit dem Leben und Werk Jesu, insofern das Volk Israel sich der Sendung Jesu verschließt. Die Christologie, die in einem Aufriss des Jesusgeschehens ausgeführt wird, sei als kritische Norm für die Beurteilung des Gemeindeverständnisses in der Glaubenspraxis wirksam. Unter der Berücksichtigung der theologisch bestimmten Gesamtschau deutet Künzel die Geschichte der Gemeinde als solche, die „die Erfahrung der heilsamen Zuwendung Gottes in Jesus, dem Immanuel, zur Voraussetzung hat und von da aus das Jesusgeschehen zum Maßstab für schon geschehene, gegenwärtige und noch ausstehende Geschichte nimmt“94. Im Rahmen der geschichtstheologischen Geschichtsschau erweist sich die Verbindung von Christologie, Ekklesiologie und Eschatologie als konstitutiv für das Matthäusevangelium.
„Von den Reflexionszitaten bis zu den Aussagen über Ende und Vollendung des Äons bietet das erste Evangelium einen zielgerichteten Aufriß.“95
Auswertung: Künzels Betrachtung gilt der Beschäftigung mit der matthäischen Ekklesiologie, worauf der Arbeitstitel bereits hinweist. Wie das Gemeindebild im Matthäusevangelium dargestellt wird, ist die Grundfrage der Arbeit. Künzel aber stellt keine rein ekklesiologische Arbeit vor, seine Überlegungen werden vielmehr durch christologische Erläuterungen begründet. Die „Gemeinde“ wird in einen geschichtstheologischen Horizont der alttestamentlichen Geschichte Israels gestellt, deren Auslegung und Erfüllung sich in der Jesusgeschichte finden. Jesus selbst ist die Norm für das Gemeindeverständnis. Sein Leben und Werk prägen das Gemeindebild. Die Ekklesiologie wird von der Christologie bestimmt. Die geschichtstheologische Auffassung des Evangelisten bildet bei Künzel den Rahmen für Christologie und Ekklesiologie.
Charles E. Carlston
Abschließend soll der Aufsatz von Charles E. Carlston „Christology and Church in Matthew“96 vorgestellt werden. Dieser verdankt sich der großen Aufmerksamkeit des Autors darauf, dass Christologie und Ekklesiologie durchgängig wesentlich für die Matthäus-Exegese sind, allerdings der Zusammenhang zwischen beiden in der Forschung nur nachlässig behandelt worden ist.
Als Interpretationsgrundlage bringt Carlston, wie von Strecker vorgegeben und von Künzel variiert, „salvation-history“ ins Gespräch. In heilsgeschichtlicher Hinsicht werde die Gottesgeschichte Israels mit der Jesusgeschichte fortgesetzt, aber im eschatologischen Hinblick auf das letzte Gericht Gottes. Die geschichtliche Kontinuität durch das Heilsgeschehen Jesu erweise sich in der matthäischen Verwendung der christologischen Titel (Messias/Christus, Davidssohn, Gottessohn, Knecht, Menschensohn) und Konzeption (Prophet, Mose, Weisheit), die mit Ausnahme von „Gottessohn“ eine jüdische Wurzel haben und tatsächlich in den Schriften belegt seien. Durch die jeweils knapp durchgeführte Analyse von christologischen Titeln und Konzeptionen beschreibt Carlston die Christologie des Matthäusevangeliums.97
Nach Carlston soll die Kirche durch die im Leben Jesu dargestellten Christusbilder (humility, suffering, service) geprägt worden sein. Da aber eine zeitliche Lücke zwischen Jesus und der matthäischen Gemeinde besteht, werde die heilsgeschichtliche Kontinuität problematisch. Die matthäische Gemeinde „has (probably) broken irrevocably with Judaism and established its own rudimentary organizational forms“98. Sie stehe trotzdem in kontinuierlicher Verbindung mit der Geschichte Gottes mit dem Volk Israel. Ihre Identität werde weder von ihr selbst noch von der jüdischen Tradition bestätigt, sondern allein von der Beziehung zu Jesus. „This is so self-evident for Matthew that nowhere in the gospel is the church given any self-designation, as, e.g., the Qumran community and the early Christian church were. Its self-definition is rather presumed than argued.“99 Jesus selbst gewähre der Gemeinde ihre Position als Jüngerschaft. In Mt 18 halte Jesus eine paränetische Rede, in der er die Struktur der Kirche aufzeige (Mt 18), so dass die (matthäische) Gemeinde vor dem Missbrauch eines gegebenen Privilegs bewahrt werde und so die Heilsgeschichte durch Jesus fortsetzen könne.
Carlston richtet seine Aufmerksamkeit auf die Institution der Ekklesia, „Matthew’s portrait of the church as institution, which is neither amorphous nor leaderless“100 – aber ohne die Amtsfrage zu berühren. Die Jünger erhalten in der Kirche jedoch eine besondere Position. Für Carlston sind sie einerseits die historischen Begleiter Jesu, indem sie die Brücke zwischen Jesus und der matthäische Gemeinde bilden, andererseits die transparenten Figuren, die die Jüngerschaft in allen kommenden Zeiten repräsentieren. Matthäus bezeichne die Jünger nicht als eine ideale Gestalt, sondern als corpus mixtum, mit dessen realer Wirklichkeit die Kirche dargestellt wird. Die Jünger haben die Schriftgelehrten als Modell für die Nachfolge Jesu, weil zum einen ihre Lehrautorität nachgeahmt werde (vgl. Mt 28,20) und zum anderen „the continuity with a long-established practice“101 bewahrt werden muss. Wie im Alten Testament fungieren im Matthäusevangelium die Jünger als die prophetischen Lehrer, die „the chain of tradition and announce the future“102 bilden und deren Autorität allein in der Beziehung zu Jesus begründet ist. Nach Matthäus sei Petrus der Prototyp der Jüngerschaft. Wenn diese Signifikanz nicht beachtet wird, kann es zur Historisierung führen, d. h. „either to generalizations about his high standing in a particular early community – with the negative statements simply portraying his humanity or, worse, representing ‘accurate’ reminiscence – or to the assumptions of ‘conflicting traditions’, possibly representing different communities toward the end of the first century”103. Im Spiegel des Petrusdienstes erfüllten die Leiter der matthäischen Gemeinde ihren Dienst, als „real leaders, offering real direction, but their authority in legal and disciplinary matters is as subject to temptation as Peter’s was“104.
Carlston unterstreicht die Gründung der Kirche durch Jesus. Ihre Autorität erhält sie durch das Vorbild Jesu (humility and service). Ihre Aktivitäten werden durch den fortdauernden Beistand dessen garantiert, der die Menschen beruft und sendet (Mt 1,23; 18,20; 28,16-20). Diese Gegenwart sei für Matthäus „Christological; it is also ecclesiological, in that it provides a bond among the disciples and gives meaning as well as authority to their mission“105. Nach Carlston sind Christologie und Ekklesiologie untrennbar miteinander verbunden. „Matthew’s ecclesiology is Christologically determined“106, wie er seine Untersuchung im Schlusssatz zusammenfasst.
Auswertung: Wie Christologie und Ekklesiologie im Matthäusevangelium zusammenhängen, beleuchtet Carlston im Horizont der Heilsgeschichte. Die Jesusgeschichte steht in geschichtlich-kontinuierlicher Verbindung mit der Gottesgeschichte Israels. Daran anschließend entfaltet die Kirche die Heilsgeschichte weiter, insofern sie von der Beziehung zu Jesus bestimmt ist. Ohne Christologie kann es keine Ekklesiologie geben. Die Ekklesiologie des Matthäus wird durch seine Christologie geführt und begründet. Die Bindung der Kirche an Jesus wird auf der geschichtlichen Ebene gezeigt, aber deren Bedeutung ist schon theologisch. Trotz dieser großen Bedeutsamkeit der Christologie zeigt Carlstons Untersuchung eine äußerst starke Konzentration auf die Ekklesiologie. Die relativ unzureichende Darstellung der christologischen Begründung der Kirche scheint eine Nacharbeit107 nötig zu haben. Offenbar hat die matthäische Christologie einen Bezug zur alttestamentlichen Theologie des Volkes Gottes. Aber ihre Beziehung zur Ekklesiologie sollte nicht nur in heilsgeschichtlicher Hinsicht – gleichsam rückwärtsgewandt – entfaltet werden, sondern von der Grundkonzeption der Jüngerschaft her, wie sie von Jesus grundgelegt wurde und transparent ist in die Zukunft der Kirche hinein durch die Sendung der Jünger für alle Zeiten.
Ergebnis und Ausblick
Die Aufarbeitung der Forschungsergebnisse bestätigt den Eindruck, dass Christologie und Ekklesiologie für die theologische Konzeption des Matthäusevangeliums in Abhängigkeit zueinander stehen. In den letzten zwei Jahrzenten aber findet sich keine Arbeit mehr, die diese Zusammenhänge thematisiert. Die meisten Untersuchungen zeigen vielmehr ein größeres Interesse an der ekklesiologischen Konzeption (mit Ausnahme von Strecker). Die Frage nach dem Kirchenverständnis steht im Mittelpunkt der Untersuchungen. Christologie dient eher dazu, die dargestellten Kirchenbilder zu beleuchten und zu begründen. Christologie und Ekklesiologie liegen (nach Strecker, Künzel und Carlston) auf der historischen Ebene, die heilsgeschichtlich zu aktualisieren sei. Beide werden durch die Reflexion der alttestamentlichen Gottesgeschichte geschichtlich-kontinuierlich miteinander verbunden. Die Jesusgeschichte ist allerdings nicht als bloße Historie zu verstehen (wie bei Strecker). Sie hat vielmehr einen bleibenden Gegenwartsbezug, weil sie durch die Sendung der Jünger in der Zeit der Kirche weiterwirkt. Den ekklesial transparenten Jüngerbegriff arbeiten Künzel und Carlston heraus, anders als Strecker, der die „Jünger“ als historische Gestalten bestimmt, die der unwiederholbaren Vergangenheit zugehören.
Das Defizit in der bisherigen Forschung wird mit der vorliegenden Studie gedeckt. Die Christologie dient bei Matthäus nicht nur der Begründung der Ekklesiologie, sondern sie entfaltet eine hohe Eigenständigkeit, was auch im Vergleich mit Markus und Lukas deutlich wird. Dass Matthäus auch ein ekklesiologisch relevantes Konzept enthält, ist unverkennbar. Seine Ekklesiologie basiert aber auf der Grundlage der Christologie. Christologie und Ekklesiologie sind so miteinander verbunden, dass der Gesamtentwurf des Evangeliums herausgearbeitet werden kann: Der Weg Gottes mit den Menschen, von dem Matthäus erzählt, wird durch den Weg Jesu mit den Jüngern sichtbar. Dieser setzt sich fort, wenn die Jünger den Weg der Nachfolge gehen. Gottes Zuwendung zu den Menschen durch die Sendung Jesu ist programmatisch auf Israel konzentriert (Mt 15,24; vgl. 10,5f.). Sie zeigt aber die universale Öffnung für alle Völker zu allen Zeiten, indem die Beistandsverheißung Gottes sich mit dem erhöhten Herrn erfüllt und durch die nachösterliche Mission weitergetragen wird (Mt 28,16-20). Die Zusage des Immanuel (Mt 1,23; 28,20) bildet den literarischen Rahmen der erzählten Geschichte Jesu. Sie geht aber über die Zeit Jesu hinaus und eröffnet den geschichtlichen Horizont, in dem die Heilsgegenwart Gottes durch die Sendung Jesu und seiner Jünger zu den Menschen weiterwirkt. Die Jesusgeschichte erfüllt also die Verheißungsgeschichte Gottes an Israel, die durch das Wirken der Propheten vorbereitet wurde, und entfaltet sich zugleich in die Zeit der Kirche hinein. Die historisch verankerte Geschichte Jesu wird transparent durch die Sendung der Jünger zu allen Völkern: „Geht zu allen Völkern, und macht alle Menschen zu meinen Jüngern.“ (Mt 28,19).
1.3 Die Anlage der Untersuchung
1.3.1 Zur Methode
Die vorliegende Arbeit fragt nach dem Verhältnis zwischen Jesus und seinen Jüngern im Matthäusevangelium, wodurch gleichzeitig Gottes Heilsweg zu den Menschen grundgelegt ist. Wie Jesus sich in seiner Einheit mit dem Vater seinen Jüngern zuwendet, ist eine Grundfrage der Christologie, Soteriologie und Ekklesiologie, die nicht schon durch die Analyse von Hoheitstiteln beantwortet ist, sondern eine Analyse der vom Evangelisten erzählten Beziehung erfordert. Die konvergierende Frage, wie die Jünger sich zu Jesus und durch ihn zum himmlischen Vater verhalten, damit sie den Menschen das „Evangelium des Himmelreichs“ (Mt 4,23; 9,35; vgl. Mt 10,7) verkünden können und dadurch ihre eigene Gottesbeziehung sowie ihr eigenes Handeln grundlegend bestimmen, bindet die Ekklesiologie und Ethik an die Christologie. Wiederum liefern nicht schon die wenigen Stellen, an denen Matthäus den Begriff ἐκκλησία (Mt 16,18; 18,17) einbringt, den Schlüssel dafür, sondern die durchaus komplexen Beziehungen der Jünger zu Jesus, wie sie vom Evangelisten erzählt werden.
Diese Untersuchung basiert darauf, dass der Evangelist Matthäus eine Geschichte Jesu „erzählt“: Das Matthäusevangelium ist – wie auch die anderen Evangelien – gattungsmäßig als eine zusammenhängende Erzählung zu verstehen, welche einen Spannungsbogen aufweist, in dem sie über einen Höhepunkt am Ende zu einer Lösung kommt (plot). Aufgrund der kontinuierlichen Entfaltung der gesamten Erzählung kann das Evangelium von Anfang bis zum Ende lückenlos gelesen werden.108 Die zweigliedrige Gesamtstruktur, die die vorliegende Studie zeigt (Jesus auf dem Weg der Gerechtigkeit – die Jünger auf dem Weg der Nachfolge), beruht auf der Kommunikationsebene des erzählten Evangeliums und zeichnet die enge Verbundenheit Jesu mit seinen Jüngern nach. Bei der Analyse von einzelnen Textabschnitten helfen die narratologischen Verfahren. Die narrative Analyse hat die Aufgabe, einerseits die Inhalte der Erzählung mit den erzählten Ereignissen, den handelnden Personen und ihren Situationen zu betrachten (story), andererseits darzulegen, „wie der Erzählinhalt dem Leser präsentiert wird und wie der Leser in seinem Urteil über den Inhalt gelenkt wird“109 (discourse). Aus dieser textimmanenten Analyse auf der Inhalts- und Ausdrucksebene ergibt sich die Kernaussage, deren Deutung aber durch andere methodische Reflexionen ergänzt wird.
Auf der Ebene der primär synchronisch angelegten Methodenarbeit kommen in Frage die Analysen des Kontextes und der Struktur einer Texteinheit. Diese methodischen Schritte gehen vom vorliegenden Text des Matthäusevangeliums aus, d. h. von der vom Evangelisten (als Endredaktor) gestalteten Endfassung des Textes:
1) Die Kontextanalyse erfasst einzelne auszulegende Texteinheiten als Teile der größeren Gesamtschrift, in die sie integriert und zu größeren Sequenzen verbunden sind. Die Kontextanalyse hat die Aufgabe, den Einzeltext vom Kontext abzugrenzen und den Standort und Stellenwert der zu untersuchenden Texteinheit in ihrem näheren und weiteren literarischen Textumfeld zu bestimmen. Sie „sucht die Sinnhinweise aufzuspüren, die sich aus der Verankerung eines Einzeltextes (sei er traditionell oder nicht) in den Makrotext des Gesamtwerkes ergeben“110. Dadurch öffnet sich der Blick „auf den Aufbau, die Gliederung und den thematischen Verlauf der Gesamtschrift; auf die Anlage, die Thematik und die Gedankenführung des engeren Kontextes; schließlich auf die Verbindungslinie vom Einzeltext zu seinem engeren und gesamtschriftlichen Kontext“111. Dieser Methodenschritt ist der elementare und fundamentale Arbeitsgang, die Komposition des Evangeliums zu untersuchen, die dadurch Rückschlüsse auf die theologische Intention des Evangelisten zulässt.
2) Die Strukturanalyse – bzw. Formanalyse – sucht die sprachliche Gestalt einer Texteinheit aufzuzeigen. Sie „schreitet fort von der Laut- und der Wortebene über die Ebene der Sätze, die aus ihnen gebildet werden, bis hin zur Ebene größerer Textabschnitte und ganzer Texte“112. Aus diesem analytischen Verfahren ergeben sich Textgliederung, Personenkonstellationen, Handlungsabläufe und Spannungsbögen, die die Sinnlinie und das Sinngefüge des Textes aufzeigen.
Da die synchronisch orientierte Auslegungsweise bei der Frage nach der theologischen Aussage des Redaktors und Evangelisten methodisch gefordert ist, muss bei der Textanalyse der Primat der Synchronie vor der Diachronie gewahrt bleiben. Die synchrone Exegese wirft jedoch ein nicht zu unterschätzendes Problem auf, wenn die historische Verankerung des Matthäusevangeliums berücksichtigt werden muss.
Der Verfasser des Evangeliums wendet sich an die Gemeinde, die von jüdischen Traditionen geprägt war; sie hat die Gesetzesfrömmigkeit hochgeschätzt (Mt 5,17-19).
Angesichts des äußerst stark jüdischen Anteils führt das in eine Krise, weil sie einerseits mit innergemeindlichen Konflikten konfrontiert wird, andererseits sich mit Konkurrenten im Verhältnis zum zeitgenössischen Judentum auseinandersetzen muss.113 Diese matthäische Gruppe kannte wohl andere (mündliche und schriftliche) Überlieferungen. Die Niederschrift des Matthäusevangeliums ermöglichte vor allem Jesusüberlieferungen, die dem Evangelisten Matthäus zur Verfügung standen. Nach der Zwei-Quellentheorie ist sowohl das Markusevangelium als auch die Redequelle als primäre Quellen des Matthäusevangeliums vorausgesetzt. Dazu kommt auch das sog. „Sondergut“114. Im Matthäusevangelium – sowie in anderen biblischen Literaturen – gilt daher „Traditionsabhängigkeit als Markenzeichen und selbst die Übernahme ganzer Textpassagen von Vorgängern nicht unbedingt als Makel, sondern in vielen Fällen als Vorzug authentischen Schreibens“115. Aus der literarischen Abhängigkeit von vormatthäischen Traditionen, dem Markusevangelium und der Redequelle, ergeben sich sprachliche und thematische Übereinstimmungen; Matthäus folgt im Wesentlichen der Grundstruktur des Markusevangeliums (z. B. Jesu Basileia-Verkündigung in Wort und Tat, die Berufung, Schulung und Sendung der Jünger, Auseinandersetzung mit den Gegnern, Jesu Auferstehung). Der Redequelle entnimmt er die thematischen Schwerpunkte seines Evangeliums (z. B. Seligpreisungen, Gerichtspredigt, Jüngerschaft in der Nachfolge Jesu). Matthäus überliefert aber die Jesusgeschichte aus den ihm vorliegenden Traditionen nicht ohne eigene Bearbeitungen, er schafft vielmehr eine neue Struktur für sein Evangelium, indem er zum einen durch die Kompositionsarbeit neue thematische und formale Einheiten (z. B. die fünf großen Reden Jesu) erstellt, zum anderen weitere Traditionen – bei denen es auch Kürzungen gibt – übernimmt und neu zusammenstellt. Daraus ergeben sich erhebliche Differenzen im Umfang, teilweise im Aufbau und auch häufig im Wortlaut zu seinen Vorlagen. Das Matthäusevangelium, das auf vielerlei Vorlagen zurückgreift, lässt in seiner Endfassung des Gesamttextes die traditions- und redaktionsanalytische Arbeit noch erkennen.
Für die Exegese ist nicht zu verkennen, dass das Matthäusevangelium als zusammenhängende Erzählung multireflektionell ist. Sie hat einen konstitutiven Bezug zur Geschichte Jesu, der allerdings jenseits eines bloßen Historismus liegt. Matthäus flicht permanent und programmatisch die alttestamentlichen Reflexionszitate ein, die zeigen sollen, dass die Jesusgeschichte nur in einem Horizont erzählt werden kann, der durch die Gottesgeschichte Israels eröffnet ist und von Jesus vergegenwärtigt wird. Die Jesusgeschichte, die von Matthäus erzählt wird, erweist sich daher als die Erfüllung der Gottesgeschichte, deren Niederschlag sich in den Schriften Israels findet. Die alttestamentlichen Zitate, auf die in der vorliegenden Untersuchung besonders Bezug genommen im Hinblick auf die Geburt Jesu (Mt 1,23; Jes 7,14) und seine messianische Sendung als Gottesknecht (Mt 12,17-21; Jes 42,1-4) und Friedenskönig (Mt 21,4f.; Sach 9,9; Jes 62,11), haben ihren eigenen geschichtlichen Standort und Wortsinn auf der Ebene des Alten Testaments. Sie erhalten aber im matthäischen Zusammenhang einen neuen Stellenwert und einen neuen Sinn. Der Vergleich mit ihren ursprünglichen Aussagen erschließt diese matthäisch spezifische Schriftkonzeption.
Aus dem Thema der Arbeit, Gottes heilsame Zuwendung zu den Menschen durch die Sendung Jesu und seiner Jünger, folgt der synchrone Methodenansatz. In methodischer und thematischer Hinsicht geht die Studie den Weg von der synchronen Textanalyse zur theologischen Interpretation. Der Evangelist übernimmt seine Texte aus einer Tradition von „damals“; sie sind nach einer langen Entwicklungsphase schließlich zum „Matthäusevangelium“ geworden. Ihre Entstehungsgeschichte gibt ein geschichtliches Verständnis wieder, welches auf dem alttestamentlich und neutestamentlich fundierten Offenbarungsverständnis beruht. Die Offenbarung Gottes in Jesus ist das unersetzbare Zeugnis, an dem die christliche Kirche festhalten muss. Das Evangelium nach Matthäus ist ein Zeugnis der Offenbarung Gottes nicht nur „damals“, sondern auch für „heute“; es ist nach wie vor eine Quelle für den christlichen Glauben, dem die Verkündigung dient.116 Insofern dieses Evangelium zum Kanon der Heiligen Schriften gehört, zeigt es „die konstitutiven Richtlinien für die Identität des Christentums“117. Wenn es vorgetragen oder gesprochen wird, wird sein Anspruch zur präsenten Wirklichkeit.118
Die Verbindung der verschiedenen exegetischen Methoden ermöglicht es, die Transparenz der Jesusgeschichte als Geschichte Gottes mit den Menschen so zu erkennen, wie Matthäus sie gestaltet hat. Die Lektüre der erzählten Geschichte Jesu fordert die Beschäftigung mit dem Endtext (synchron). Dieser aber würde seine Geschichtlichkeit verlieren ohne diachronische Reflexion. Dass die Menschen an Jesus Christus glauben, ist für sie ein persönlicher Vorgang, der aber in einem geschichtlichen Ereignis verankert ist. Das Heilshandeln Gottes in Jesus ist nicht eine einmalige vergangene Geschichte, sondern wird durch den Verkündigungsdienst der Kirche zur Heilsgeschichte in der Gegenwart. Dass Gott in der Sendung Jesu und seiner Jünger für die Menschen handelt, ist Gegenstand des Matthäusevangeliums.
1.3.2 Zur Anlage der Untersuchung
Aus der Bestimmung des Arbeitsthemas über den Heilsweg Gottes zu den Menschen, der nicht nur durch die christologischen Elemente, sondern auch durch die ekklesiologischen bestimmt und veranschaulicht wird (1.1), ergibt sich die zweigliedrige Gesamtstruktur der Arbeit: Jesus auf dem Weg der Gerechtigkeit und die Jünger auf dem Weg der Nachfolge. In der Christologie des Immanuel und der Ekklesiologie der Nachfolge entfaltet der Evangelist erzähltechnisch und theologisch die Theozentrik Jesu im Rahmen seines Evangeliums. Diese Themenkreise bilden die Grundlage für die vorliegende Untersuchung, die auf der Ebene des Matthäusevangeliums eruiert, wie Jesus und seine Jünger die Erfüllung des Heilswillens Gottes suchen. Die christologische und ekklesiologische Ausrichtung sind aber voneinander zu unterscheiden, um die Dynamik des Verhältnisses zwischen Jesus und seinen Jüngern herauszustellen.
Der christologische Teil (Jesus auf dem Weg der Gerechtigkeit) sucht die Gottessohnschaft Jesu und sein Wirken als Lehrer der Gerechtigkeit zu bestimmen. Jesus als Erlöser wird programmatisch bei der Verleihung des Namens (Mt 1,21) angekündigt (2.1). Der verheißene Beistand des Immanuel (Mt 1,23 [Jes 7,14]; 18,20; 28,10) ist den Seinen zugesagt, so dass die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel als die Geschichte Jesu mit den Jüngern und mit den Menschen transparent gemacht wird (2.2). Die Sendung Jesu als Gottesknecht (Mt 12,18-21 [Jes 42,1-4]) und als Friedenskönig (Mt 21,5 [Sach 9,9; Jes 62,11]) ist der „Weg der Gerechtigkeit“ (Mt 21,32). Dieser Weg wird bei der Taufe Jesu programmatisch aufgezeigt (Mt 3,15). Jesus erfüllt durch seine messianische Sendung die Gerechtigkeit Gottes. Zu dieser Sendung sind auch seine Jünger berufen. Jesus lehrt sie Gerechtigkeit, so dass auch sie den Weg der Gerechtigkeit verkünden können (2.3). Die Proexistenz Jesu wird von der Theozentrik begründet (2.4). Im christologischen Teil dieser Arbeit werden diese wesentlichen Aussagen des Matthäus auf folgende Fragen hin untersucht: Wer ist Jesus nach dem Matthäusevangelium? Was hat er getan? In welchem Verhältnis steht er zu seinem Vater und zu seinen Jüngern? Wie erfüllt der Sohn des Vaters den Willen des Vaters?
Im ekklesiologischen Teil (die Jünger auf dem Weg der Nachfolge) ist eine sachgerechte Antwort auf folgende Fragen erforderlich: Wer sind die Jünger? Welches Verhältnis zu Jesus haben sie? Wie sind sie charakterisiert? Welche Probleme gibt es innerhalb der Jüngerschaft? Wie erfüllen die Jünger ihre Sendung? – Sie folgen der Berufung durch Jesus in ihrer Bereitschaft zur Nachfolge. Die Identität der Jüngerschaft wird aber nicht von den Jüngern, sondern allein von Jesus bestimmt. Sie werden von ihm in die Nachfolge gerufen und bevollmächtigt, zu tun, was er getan hat (3.1). Diese Nachfolger Jesu bilden die Glaubensgemeinschaft, die Ekklesia. Die Jünger bleiben aber trotz ihres Bekenntnisses zu Jesus Kleingläubige. Jesus überwindet ihren Kleinglauben, indem er sie belehrt, so dass ihr Glaube wachsen kann (3.2). Die Jünger haben aber keine kontinuierliche Gemeinschaft mit Jesus. In der Bergpredigt definiert er seine Jünger als „Salz der Erde“ und „Licht der Welt“ (Mt 5,13-16). Er richtet damit ihren Blick über Israel hinaus in alle Welt, in die sie gesandt werden sollen, um alle Völker zu Jüngern Jesu zu machen, indem sie sie taufen und lehren (Mt 28,18-20). Die nachösterliche Sendung der Jünger findet ihre Begründung im erhöhten Herrn (3.3). Die Jünger bleiben in der Gemeinschaft mit Jesus, indem sie seinem Ruf folgen. Sie sollen nach Jesu Willen untereinander ihre Sünden vergeben und einander dienen. Die Einheit der Jünger ist für ihre Gemeinschaft mit Jesus konstitutiv (3.4).
Da häufig die Beschreibung der Reaktionen der Jünger gegenüber Jesus im Matthäusevangelium nur unklar wiedergegeben wird, ergibt sich die Schwierigkeit, die Position der Jünger (auf der Erzählebene) explizit darzustellen. Sie bleiben jedoch in ihrer Beziehung zu Jesus transparent für seine Worte und sein Wirken. Die erzählte Jesusgeschichte erschließt sich dem Leser als das Evangelium Gottes nach Matthäus.
1 Die Bemerkung der pharisäischen Gegner Jesu in Mt 22,16 wird positiv gedeutet bei A. Sand, Das Evangelium nach Matthäus, Leipzig 1989, 441 („sie rühmen seine souveräne Unabhängigkeit“); D.A. Hagner, Matthew 14-28 (WBC 33B), Dallas 1993, 635. Negativ dagegen bei U. Luz, Das Evangelium nach Matthäus. Mt 18-25 (EKK I/3), Zürich u. a. 1997, 257; J. Gnilka, Das Matthäusevangelium. II. Teil. Kommentar zu Kap. 14,1-28,20 und Einleitungsfrage (HThK I/2), Freiburg i. Br. 21992, 247.
2 Vgl. A. Sand, Das Matthäus-Evangelium (EdF 275), Darmstadt 1991, 92f.
3 Th. Söding, Der Tod ist tot, das Leben lebt. Ostern zwischen Skepsis und Hoffnung, Ostfildern 2008, 94.
4 Ebd.
5 U. Schnelle, Theologie des Neuen Testaments (UTB 2917), Göttingen 22013, 419.
6 Hier gibt es bei allen weiteren Differenzen eine grundlegende Übereinstimmung z. B. zwischen J. Ratzinger (Benedikt XVI.), Gesammelte Schriften. Kirche – Zeichen unter den Völkern. Schriften zur Ekklesiologie und Ökumene. Erster Teilband, Freiburg i. Br. 2010, 128-139 und W. Kasper, Katholische Kirche. Wesen – Wirklichkeit – Sendung, Freiburg i. Br. 2011, 190-201.
7 W. Kasper, Katholische Kirche, 191.
8 Hier gibt es bei allen weiteren Unterschieden eine grundlegende Übereinstimmung zwischen J. Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes. Ein Beitrag zur messianischen Ekklesiologie, München 1975, 83-93 und W. Pannenberg, Systematische Theologie. Band III, Göttingen 1993, 142-155.
9 Lukas zeigt seine Beschäftigung mit der Ekklesia-Thematik in der Apostelgeschichte.
10 J. Roloff, Die Kirche im Neuen Testament (GNT 10), Göttingen 1993, 154. (Hervorhebung im Original)
11 Ebd., 155. (Hervorhebung im Original)
12 U. Schnelle, Theologie, 419.
13 F. Hahn, Theologie des Neuen Testaments. Bd. I: Die Vielfalt des Neuen Testaments (UTB 3500), Tübingen 32011, 534. Vgl. auch U. Luz, Das Evangelium nach Matthäus. Mt 1-7 (EKK I/1), Zürich u. a. 52002, 38: „Die fünf großen Reden sind zum ‚Fenster ‘ der matthäischen Jesusgeschichte hinaus gesprochen. Sie sind direkte Anrede an die Leser/innen und direkt für sie gültiges Gebot Jesu.“ (Hervorhebung im Original)
14 Vgl. M. Mayordomo-Marín, Den Anfang hören. Leserorientierte Evangelienexegese am Beispiel von Matthäus 1-2 (FRLANT 180), Göttingen 1998, 204f. Er spricht von einer narrativen Rahmung, die es der Leserschaft ermöglicht, am Anfang die Perspektive des Textes einzunehmen und am Ende wieder aus ihr herauszutreten: „Es besteht also ein dynamisches Wechselverhältnis zwischen dem Phänomen, daß der Anfang ein besonders helles Licht auf die weitere Sinnkonstitution wirft (‚primacy effect‘), und dem entgegengesetzten, daß nämlich frühere Schlußfolgerungen durch den Verlauf der Erzählung revidiert werden (‚recency effect‘).“ (ebd., 205)
15 Der Evangelist Markus. Studien zur Redaktionsgeschichte des Evangeliums (FRLANT 49), Göttingen 21959 (1956).
16 Seine sämtlichen Aufsätze zum Matthäusevangelium und seine Kommentierung des Matthäusevangeliums in Auswahl wurden herausgegeben von W. Zager (Hg), Günther Bornkamm, Studien zum Matthäus-Evangelium (WMANT 125), Neukirchen-Vluyn 2009.
17 Das wahre Israel. Studien zur Theologie des Matthäus-Evangeliums (StANT 10), München 31964 (1958).
18 Der Weg der Gerechtigkeit. Untersuchung zur Theologie des Matthäus (FRLANT 82), Göttingen 31971 (1962).
19 Die Auseinandersetzung zwischen Kirche und Judentum im Matthäusevangelium (BEvTh 33), München 21966 (1963). Im englischsprachigen Forschungsraum z. B. W.C. Thompson, Matthew’s Advice to a Divided Community. Mt. 17,22-18,35 (AnBib 44), Rome 1970.
20 Vgl. U. Schnelle, Einleitung in das Neue Testament (UTB 1830), Göttingen 82013, 298f.
21 Th. Söding, Wege der Schriftauslegung. Methodenbuch zum Neuen Testament, Freiburg i. Br. 1998, 210.
22 M. Theobald, Der Primat der Synchronie vor der Diachronie als Grundaxiom der Literarkritik. Methodische Erwägungen an Hand von Mk 2,13-17/Mt 9,9-13, in: BZ 22 (1978) 161-186.
23 Das Evangelium nach Matthäus, 4 Bde. (EKK I/1-4), Zürich u. a. 52002/1990/1997/2002.
24 Die Wirkungsgeschichte, deren methodischer Ansatz wegbereitend von U. Luz verbreitet ist, ist ein gegenwärtig neues Forschungsthema. Vgl. D.M. Gurtner, The Gospel of Matthew from Stanton to Present: A Survey of Some Recent Developments, in: ders. u. a. (Hgg.), Jesus, Matthew’s Gospel and Early Christianity. Studies in Memory of Graham N. Stanton (LNTS 435), London/New York 2011, 23-38, hier 33-35.
25 U. Luz, Mt I/1, 110. „Erkannte man doch, daß die Konzentrierung auf die historisch-kritische Methode die biblischen Texte einseitig zu literarischen Quellen macht, deren Auslegung allzu leicht im Abstrakten und Unverbindlichen, im historisch rein Informativen bleibt“ (A. Sand, Matthäus-Evangelium, 140f.)
26 U. Luz, Theologische Hermeneutik des Neuen Testaments, Neukirchen-Vluyn 2014, 361.
27 Vgl. ebd., 360f.
28 Ders., Mt I/2, VII.
29 Ders., Mt I/1, VIIII.
30 Ders., Mt I/4, VIII.
31 M. Mayordomo, Wirkungsgeschichte als Erinnerung an die Zukunft der Texte (Hinführung), in: ders. (Hg.), Die prägende Kraft der Texte. Hermeneutik und Wirkungsgeschichte des Neuen Testaments (Ein Symposium zu Ehren von Ulrich Luz) (SBS 199), Stuttgart 2005, 11-14, hier 13.
32 Vgl. ebd., 11.
33 U. Luz, Hermeneutik, 404.
34 Vgl. ebd., 408f.
35 Vgl. J.D.G. Dunn, Matthew as Wirkungsgeschichte, in: P. Lampe/M. Mayordomo (Hgg.), Neutestamentliche Exegese im Dialog. Hermeneutik – Wirkungsgeschichte – Matthäusevangelium [FS Ulrich Luz], NeukirchenVluyn 2008, 149-166.
36 Den Anfang hören. Leserorientierte Evangelienexegese am Beispiel von Matthäus 1-2 (FRLANT 180), Göttingen 1998.
37 Auch H. Frankemölle, Matthäus, 2 Bde., Düsseldorf 1994/1997. Er bietet eine ausführliche Auslegung der Matthäustexte, die methodisch auf die Perspektive der Leser blickt. Dieses Unternehmen der stark leserorientierten Lektüre betrachtet Frankemölle „nicht absolutistisch als die einzig mögliche“, sondern „als sinnvolle Ergänzung zur bisherigen Weise der autororientierten biblischen Textinterpretation“ (Zitat aus dem 1. Bd., 10). Dieselbe methodische Ausrichtung zeigen auch u. a. W. Carter, Matthew. Storyteller. Interpreter Evangelist, Peabody 1996; G. Yamasaki, John the Baptist in Life and Death. Audience-Oriented Criticism of Matthew’s Narrative (JSNTS 167) Sheffield 1998.
38 M. Mayordomo-Marín, Den Anfang, 17.
39 B.H. McLean, Art. Literary Criticism. II. Neutestamentlich, in: LBH (2013) 366f., hier 366.
40 Die Fruchtbarkeit des methodischen Ansatzes des „narrative“ bzw. „literary criticism“ zeigen vor allem J. D. Kingsbury, Matthew as Story, Philadelphia 1986; D.R. Bauer, The Structure of Matthew’s Gospel. A Study in Literary Design (JSNTS 31), Sheffield 1988; D.J. Weaver, Matthew’s Missionary Discourse. A Literary Critical Analysis (JSNTS 38), Sheffield 1990; D.B. Howell, Matthew’s Inclusive Story. A Study in the Narrative Rhetoric of the First Gospel (JSNTS 42), Sheffield 1990; R.A. Edwards, Matthew’s Story of Jesus, Philadelphia 1985; ders., Matthew’s Narrative Portrait of Disciples. How the Text-Connoted Reader Is Informed, Philadelphia 1997.
41 Erzählte Welt. Narratologische Studien zum Matthäusevangelium (BThS 100), Neukirchen-Vluyn 2008.
42 Ebd., 1.
43 Ebd., 141f.
44 Ebd., 143.
45 Ebd., 140f.
46 Narratologie und biblische Exegese. Eine integrative Methode der Erzählanalyse und ihr Ertrag am Beispiel von Matthäus 28 (WUNT II/285), Tübingen 2010. Außerdem ist nennenswert: D.D. Kupp, Matthew’s Emmanuel. Divine Presence and God’s People in the First Gospel (SNTSMS 90), Cambridge 1996.
47 S. Finnern, Narratologie, 53; vgl. ebd., 487.
48 Das Osterevangelium. Erinnerung und Erzählung (HBS 73), Freiburg i. Br. 2013.
49 Ebd., 83f.
50 Ebd., 84.
51 Ebd., 150.
52 Ebd., 83.
53 Vgl. z. B. G. Häfner, Der verheißene Vorläufer. Redaktionskritische Untersuchung zur Darstellung Johannes des Täufers im Matthäusevangelium (SBB 27), Stuttgart 1994; D. Trunk, Der messianische Heiler. Eine redaktions- und religionswissenschaftliche Studie zu den Exorzismen im Matthäusevangelium (HBS 3), Freiburg i. Br. 1994; G. Scheuermann, Gemeinde im Umbruch. Eine sozialgeschichtliche Studie zum Matthäusevangelium (FzB 77), Würzburg 1996; B. Repschinski, The Controversy Stories in the Gospel of Matthew. Their Redaction, Form and Relevance for the Relationship between the Matthean Community and Formative Judaism (FRLANT 189), Göttingen 2000.
54 Ein weiteres Integrationsmodell gibt G.N. Stanton, A Gospel for a New People. Studies in Matthew, Edinburgh 1992. Er ist überzeugt, „that redaction criticism must remain as the basic tool for serious study of Matthew, but its results are more compelling when they are complemented by some (but not all) literary critical approaches and by the carefull use of sociological insights“ (ebd., 7).
55 U. a. W. Trilling, Israel; R. Hummel, Die Auseinandersetzung zwischen Kirche und Judentum im Matthäusevangelium (BEvTh 33), München 21966; R. Walker, Die Heilsgeschichte im ersten Evangelium (FRLANT 91), Göttingen 1967; H. Frankemölle, Jahwe-Bund und Kirche Christi. Studien zur Form- und Traditionsgeschichte des „Evangeliums“ nach Matthäus (NTA 10), Münster 21984; R.A. Edwards, Matthew’s Narrative Portrait of Disciples. How the Text-Connoted Reader Is Informed, Philadelphia 1997; M. Konradt, Israel, Kirche und die Völker im Matthäusevangelium (WUNT 215), Tübingen 2007.
56 J. Czerski, Christozentrische Ekklesiologie im Matthäusevangelium, in: BiLe 12 (1971) 55-66.
57 G. Strecker, Die Bergpredigt. Ein exegetischer Kommentar, Göttingen 21985; H. Weder, Die Rede der Reden. Eine Auslegung der Bergpredigt heute, Zürich 1985; G. Lohfink, Wem gilt die Bergpredigt? Beiträge zu einer christlichen Ethik, Freiburg i. Br. 1988; D. Patte, Discipleship According to the Sermon on the Mount. Four Legitimate Readings, Four Plausible Views of Discipleship, and Their Relative Values, Valley Forge PA 1996; U. Luz, Mt I/1, 251-553.
58 Einen Forschungsüberblick über die durchgängig problematische Gesetzesthematik des Matthäusevangeliums bietet B. Repschinski, Nicht aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das jüdische Gesetz in den synoptischen Jesuserzählungen (FzB 120), Würzburg 2009, 57-70.
59 Vgl. D. Senior, Direction in Matthean Studies, in: D.E. Aune (Hg.), The Gospel of Matthew in Current Study. Studies in memory of William G. Thompson, Grand Rapids u. a. 2001, 5-21, hier 16f. „Attempting to decipher Matthew’s literary and rhetorical strategies without fully engaging the Gospel’s theological convictions will lead interpreters in the wrong direction.“ (ebd., 17)
60 O. Michel, Der Abschluss des Matthäusevangeliums. Ein Beitrag zur Geschichte der Osterbotschaft, in: EvTh 10 (1950), 16-26; J. Lange, Das Erscheinen des Auferstandenen im Evangelium nach Matthäus. Eine traditions- und redaktionsgeschichtliche Untersuchung zu Mt 28,16-20 (FzB 11), Würzburg 1973; J.D. Kingsbury, The Composition and Christology of Matt. 28:16-20, in: JBL 93 (1973) 573-584.
61 J.D. Kingsbury, The Title ‘Son of David’ in Matthew’s Gospel, in: JBL 95 (1976) 591-602; D.C. Duling, The Therapeutic Son of David: An Element in Matthew’s Christological Apologetic, in: NTS 24 (1978) 392-409; B. Nolan, The Royal Son of God: The Christology of Matthew 1-2 (OBO 23), Göttingen 1979; D. Hill, Son and Servant: An Essay on Matthean Christology, in: JSNT 6 (1980) 2-16.
62 J.D. Kingsbury, Matthew: Structure, Christology, Kingdom, London 1976; R. Schnackenburg, Die Person Jesu Christi im Spiegel der vier Evangelien (HThKNT. S 4), Freiburg i. Br. 1993, bes. 91-151.
63 D. Senior, Direction, 16. Die ausführliche Darstellung siehe in: ders., The Gospel of Matthew, Nashville 1997, 53-62, bes. 53.58.
64 D. Senior, Gospel, 53.
65 Seine Erstveröffentlichung in: W. D. Davies/D. Daube (Hgg.), The Background of the New Testament and its Eschatology [FS Charles Harold Dodd], Cambridge 1956 (Nachdr. 1964), 222-260; hier W. Zager (Hg.), Studien (2009), 9-42.
66 G. Bornkamm, Enderwartung, 9.
67 Ebd., 17.
68 Ebd., 23.
69 Ebd., 24.
70 G. Strecker, Weg, 86.
71 Vgl. ebd., 86-122.
72 Ebd., 99.
73 Ebd., 122.
74 Ebd., 185.
75 Ebd.
76 Ebd., 236.
77 Matthäus und seine Gemeinde (BBS 71), Stuttgart 1974.
78 Ebd., 5.
79 Ebd., 13.
80 Ebd., 12.
81 Ebd., 13; vgl. ebd., 35.
82 Ebd., 19. (Hervorhebung im Original)
83 Ebd., 55.
84 Ebd., 56f.
85 Studien zum Gemeindeverständnis des Matthäus-Evangeliums (CThM.BW 10), Stuttgart 1978.
86 Ebd., 122.
87 Ebd., 142.
88 Ebd., 175.
89 Ebd., 180.
90 Ebd., 193.
91 Ebd., 200.
92 Ebd., 5.
93 Ebd., 43.
94 Ebd., 44.
95 Ebd., 257.
96 Christology and Church in Matthew, in: F. Van Segbroeck (Hg.), The Four Gospels 1992 [FS Frans Neirynck] (BEthL 100,1), Leuven 1992, 1283-1304.
97 Den weiteren Aspekt, dass das Gesetz im christologisch festgelegten Bezug die Kontinuität mit dem Alten Testament bewahrt, bringt Carlston nachträglich. Vgl. C.E. Carlston / C.A. Evans, From Synagogue to Ecclesia. Matthew’s Community at the Crossroad (WUNT 334), Tübingen 2014, 327.
98 C.E. Carlston, Christology, 1288.
99 Ebd.
100 Ebd., 1289.
101 Ebd., 1291.
102 Ebd.
103 Ebd., 1301f.
104 Ebd., 1302.
105 Ebd., 1303.
106 Ebd., 1304.
107 Eine ausführliche Darstellung über die christologischen Titel und Traditionselemente siehe in: C.E. Carlston / C.A. Evans, Synagogue, 3-93.
108 Vgl. U. Luz, Die Jesusgeschichte des Matthäus, Neukirchen-Vluyn 1993; U. Poplutz, Erzählte Welt, 1-56.
109 G. Fischer, Wege in die Bibel. Leitfaden zur Auslegung, Stuttgart 320 08, 68.
110 Th. Söding, Wege, 119.
111 A. Weihs, Methoden der Schriftauslegung, in: S. Gillmayr-Bucher u. a., Bibel verstehen. Schriftverständnis und Schriftauslegung (TheoMod 4), Freiburg i. Br. 2008, 133-166, hier 143.
112 Th. Söding, Wege, 131.
113 J. A. Overmann, Church and Community in Crisis. The Gospel According to Matthew (The New Testament Message in Context), Valley Forge 1996.
114 Vgl. D.J. Paul, „Untypische“ Texte im Matthäusevangelium? Studien zu Charakter, Funktion und Bedeutung einer Textgruppe des matthäischen Sonderguts (NTA 50), Münster 2005. Einen forschungsgeschichtlichen Einblick in die Arbeit am matthäischen „Sondergut“ gibt U. Poplutz, „M-Quelle“ oder Konglomerat? Forschungsüberblick zum sogenannten matthäischen „Sondergut“, in: ZNT 36 (2015) 2-11.
115 Th. Söding, Wege, 191.
116 Vgl. Th. Söding, Neues Testament: Komposition und Genese, in: S. Gillmayr-Bucher u. a., Bibel verstehen. Schriftverständnis und Schriftauslegung (TheoMod 4), Freiburg i. Br. 2008, 87-132, hier 97.
117 H. von Lips, Der neutestamentliche Kanon. Seine Geschichte und Bedeutung, Zürich 2004, 183.
118 „Die Kanonisierung des Neuen Testaments ist ein Prozess, der mit der Entstehung der Texte beginnt und mit der formellen Bestätigung von Bücherlisten durch Kirchenlehrer und Konzilien nicht endet, sondern sich bis in die Gegenwart hinein vollzieht, wenn Bibeltexte im Gottesdienst verkündet und in der kirchlichen Lehre als Grundlage herangezogen werden.“ (Th. Söding, Neues Testament, 94)