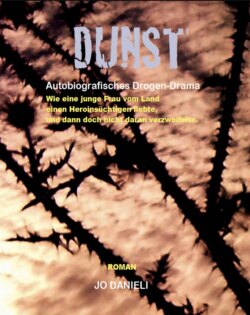Читать книгу DUNST - Jo Danieli - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеEs ist Jahre her.
Kein junges Mädchen kann es sich vorstellen, dass es eines Tages selbst »... damals ...« sagen wird, über fünf, sieben, zehn, fünfzehn Jahre zurückblickend erkennen wird, dass es ebenso alt geworden ist wie seine Nachbarin damals gewesen ist. Damals hat die Nachbarin die Blicke der Schulkollegen auf sich gezogen beim Ausschütteln der Bettwäsche gegen Mittag, und man hat gemunkelt, die Frau hätte wohl einiges hinter sich. Sie kicherte zu schrill, sprach man sie an, trug ein wenig zu grelle Farben und viel zu dick schwarze Farbe um die Augen, stand rauchend am Gartentor und zuckte nicht mit der Wimper, wenn ihre Kinder zum Spielen auf die Straße zwischen vorüber rauschende Autos liefen. Entgegen allen Spekulationen liebte sie aber ihren Mann, behauptete sie jedenfalls. Wahrscheinlich nahm sie es für ihn in kauf, die wirklich böse, fette, herzkranke Schwiegermutter zu pflegen. Man hörte die junge Frau in ihrer Wohnung unter dem Dach mit den Kindern schreien, und das dauerte meist lange. Dann stand sie wieder rauchend am Gartentor und erzählte allen Vorüberkommenden von ihrem Besuch beim Frauenarzt und dass sie das Wetter traurig fände. Die Leute und auch ich waren fasziniert von ihren großen, graugrünen Augen mit so langen Wimpern, dass die Lider durch sie schwer schienen. dass sie nur noch wenige Zähne besaß, übersah man. Später, als die Schwiegermutter gestorben und der kleine Ehemann arbeitslos geworden, verschwand unsere Nachbarin samt den drei Kindern, angeblich schwanger mit einem vierten.
Meine Vermieter munkeln nun vielleicht über mich, mit mir stimme etwas nicht. Ich arbeite nämlich derzeit nicht. Nein, nein, ich bin nicht arbeitslos. Dieses beleidigende Wort haben Beamte erfunden, neidisch auf Nichtbeamte, die zugeben dürfen, sie hätten nichts zu tun. Mein Alltag ist voll und wird immer noch voller ... es ist mein Schicksal, nie zu wissen, was ich denn zuerst anfangen soll. Nichts zu tun würde mich binnen kurzem umbringen. Also male, schreibe, bastele, zeichne, tanze, stricke, schnitze, nähe und häkle, turne und wandere ich. Zudem habe ich viel Nachholbedarf. Und ich bin leider außerordentlich begabt. Für fast alles. Welche Tests auch immer ich beruflich oder im schulischen Sinn gemacht habe, immer war ich unter den Besten. Das habe ich nie angestrebt, es war einfach so. Ich kann singen, dichten, Englisch, Französisch, Italienisch, etwas Suaheli, Noten lesen, fotografieren, malen, schnitzen, schauspielern, kochen, tanzen, reden, zuhören, Akkordeon spielen, Keyboard und ein bisschen Gitarre, klettern, mit Kindern umgehen, handwerken, ich kenne mich in den Grundlagen der Genetik und in der Biologie aus, einigermaßen in der Politik, bin intelligent und umsichtig und vergesse selten etwas. Ich habe nur vor vier Monaten meinen Job als Graphikerin ersatzlos gestrichen, weil ich den geringsten Konflikt nicht mehr locker nehmen konnte.
Ein missgelaunter Arbeitskollege hat mich angeschrien, die Firma mir eine Taxirechnung über läppische neunzig Schilling zurückgeschmissen weil sie eine halbe Stunde früher als erlaubt - nach 22 Uhr, vorher ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren - ausgestellt worden war, und ich bin nie wiedergekommen. Paradox ist, dass in der Zeit, als gefühlsmäßig alles am schlimmsten gewesen ist, mein Alltag in der Öffentlichkeit ganz ordentlich funktioniert hat. Ich hatte zwei Jahre lang durchgehend einen Job, ging regelmäßig einkaufen - mit Hund ist das schon allein seinetwegen Pflicht, habe mich gepflegt, ein Auto gekauft und feste Schuhe. Mein hartnäckiger Widerstand gegen den Zug von hinten hat mich ohne zu stolpern geradeaus gehen lassen. Das habe ich schön gesagt, finde ich. Ja, dieser Satz ist mir gelungen, wie mir meistens gelingt, fröhlich zu wirken, wenn ich es nur will und gewaltsam empfinden möchte. Denn ich weiß, dass andere Menschen abstößt, wer verhärmt wirkt, weil sie insgeheim fürchten, sie würden zu Trostdiensten herangezogen werden. Und wer weiß heute schon noch, wie man tröstet? Wer sieht einen Sinn darin? Wer würde sich die Zeit dazu nehmen? Manchmal möchte ich gefallen, wie früher, als die Leute sich nach mir umgedreht haben. Frisch war ich und ernst und hübsch und still, pikant ... Heute werde ich immer noch beachtet, wohin immer ich auch komme, aber ich weiß Grund dafür nicht mehr. Die Vergangenheit zerrt manchmal mutwillig allzu stark an mir, und das Kunstwerk meines Alltags bröckelt. Jeder rotznasige Knirps kann mich durch einen Blick zum Weinen oder vor Hass Explodieren bringen. Nur wenn ich im Hallenbad herumschwimme oder und mich sehr anstrenge und beim Tanzen, erwische ich mich zuweilen beim Lächeln, wenn ich nicht gerade über die bockigen Pruster fluche, die mich immerzu aus meiner Bahn drängen wollen oder Leute die so wilde, rücksichtslose Wendungen machen, dass sie mich anrempeln. Das schlimmste: Sie merken es nicht einmal. Oft versuche ich, sie im Vorbeischwimmen oder Danebenherhampeln zu treten. Gelingt es mir, entschuldige ich mich nicht. Ähnlich hasse ich es, wenn Leute auf engen Gehsteigen von mir erwarten, dass ich ihnen Platz machte, ohne das sie selbst ihren Kurs auch nur um Zentimeter zu meinen Gunsten abändern.
Neulich hat eine fette Frau an einem Bäckereistand am Ring, hier, in Wien, sich in der Warteschlange zu mir umgedreht und gesagt, ich solle verschwinden. Es ist offensichtlich gewesen, dass sie einen Dachschaden hatte. Früher einmal hätte ich beschämt und mit Herzklopfen weggeschaut. Das Herzklopfen vor Schreck über dieses gehässige, unfaire Anpöbeln ist sofort eingetreten, aber diesmal bin ich von hinten nahe an sie herangetreten und habe ihr etwas sehr Drohendes ins Ohr gesagt, sodass sie sich gehütet hat, mich auch nur noch einmal anzuhusten.
Wie komme ich dazu, stets den Weg freizumachen? Sollen doch auch die anderen ausweichen! Mich anzustrengen, wie beispielsweise beim Schwimmen, hat mir mein Hausarzt empfohlen. Er sagt, der Geist kann nur am verderblichen Grübeln gehindert werden, wenn der Körper erschöpft ist und alle Aufmerksamkeit und Energie beansprucht. Der Mann hat recht. Sommers überfällt mich regelrecht der Schwimm-Wahn, ich laufe auch viel, und ich tue es nicht allein wegen der Figur, obwohl ich sie durchaus besorgt überwache.
... es beruhe wohl alles auf einer gewissen Freiwilligkeit, worin der Mensch sich in seinem Leben verstricke, hat mich neulich ein alter Bekannter telefonisch belehrt, und ich dürfe mich nicht beklagen über mein Schicksal. Es sei wohl anzunehmen, ich hätte angestrebt, was ich erlebt habe, da ich zu nichts gezwungen worden bin.
Nicht gezwungen?
Ich habe einen Mann geliebt, der den Drogen verfallen ist. Bin ich also nicht gezwungen, mich mit Drogen zu beschäftigen?
Es hat mir die Sprache verschlagen vor Hilflosigkeit gegenüber diesem gnadenlosen Abschmettern meines Wunsches nach Verstehen. Ich weiß schon, wenn die Leute einen fragen »Wie geht es dir?« hoffen sie, man möge »Gut« sagen und sofort das Thema wechseln. Steuert man auf die Wahrheit los, haben sie es plötzlich eilig, aufzulegen, zu gehen, oder sie überschwemmen einen mit gedankenlosen »Ja«s und »Ach so«s und »Wird schon«s und fangen an über sich zu reden, sobald man Luft holt. Es beleidigt schmerzhaft, die eigene Chancenlosigkeit unter die Nase gerieben zu bekommen.
Mag sein, ich bin nicht mehr die alte. Aber ich habe dennoch Pläne. Wenn ich beim Tanzen nicht mehr hoffen werde, grell zuckendes Licht möge mein Gesicht nicht völlig enthüllen und wenn nicht mehr versuchen werden, stets in den Schatten auszuweichen, werde ich mich auch wieder mit Leuten verabreden und einer geregelten Arbeit nachgehen. Ja, irgendwann werde ich mein Gesicht wieder in das Licht halten. Wenn jemand mit mir zu flirten versucht, egal, ob Mann oder Frau, erschrecke ich, denn ich argwöhne, er oder sie tue es nur, weil er oder sie glaubt, jemand wie ich müsse ein leichter Fall sein. Oder ich argwöhne, man findet mich hart und hässlich.
Du spinnst ja, pflegt ein »Freund« dazu zu sagen. Warum sagt er mir nicht, wie man es macht, dass man nicht mehr spinnt?
»He,« sage ich mir manchmal selber, »... du bist ganz schön kaputt, Mädchen.« Dann lege ich vielleicht die Red Hot Chili Peppers in den Kassettenrecorder, suche mir »Give it away« heraus und tobe. Oder ich mache so etwas wie Aerobic zu »Primal Chaos« aus einer Technosammlung. Mein Hund hüpft aufgeregt um mich herum, weil ich so wild die Fäuste und meinen Kopf schwinge und mich drehe wie verrückt, und außerdem lache ich dabei. Wenn ich konsequent genug bin, neben dem Toben auch ein bisschen daran zu denken, meine Muskeln zu spannen und sinnvoll in die Knie zu gehen und es auch tue, fühle ich mich nachher ganz gut.
Niemand sonst, außer mir selber, wagt mir zu sagen, ich sei weich in der Birne, weil er sonst mit mir darüber reden müsste. Es ist bequemer zu sagen »Wird schon wieder« als »Erzähl' mir.« Nur meine Hund sieht mich ganz seltsam an, wenn ich schlecht drauf bin und diese Stimmung an ihm auslasse. Hunde können sich nicht verstellen.
Ich bin zur exzessiven Tänzerin in Untergrundschuppen geworden, wo Techno gespielt wird und Jungle und House und Psychedelic Trance. Diese Musik und das Insiehineinfallenlassen sind nun überlebenswichtig für mich. Und in einschlägigen Clubs und auf Raves treffe ich immer wieder dieselben Leute, die mir anscheinend ähneln: Sie tanzen - und wie sie tanzen! Stundenlang. Nächtelang. Zusammen und doch einsam. Neulich habe ich nach einer derartigen erschöpfenden Nacht kichernd vor Überschwang ein Gedicht geschrieben. Es ist einem jungen Mann gewidmet, den ich oft beim Tanzen treffe und den ich weiter nicht kenne. Es heißt »Teufelchen«, hier ein Auszug:
Was muss ich grinsen, schon zu Beginn,
da ich noch gar nicht beim Dichten bin.
»Teufelchen« zu dir zu sagen
ist, als würd' ich frechlings wagen
dich an eine Wand zu malen
um still beglückt dich anzustrahlen.
(...)
Streif' ich durch die Stadt und suche Vergessen,
ist simples Vergnügen mir spärlich bemessen.
Darum bin ich froh über all jene Stunden
die mir einen Tag gar erlebenswert runden.
Nach vielzuviel Mühe vergangener Zeit
bin ich doch gar nicht zum Feiern bereit.
Doch wenn es geschieht, dass Nettes mich streift,
dass fremdes Bestehen mein Sinnen ergreift
statt altes Erinnern, dann fühl' ich verwirrt,
dass neben Vergang'nem noch viel existiert
das schön ist und wichtig und liebenswert gut.
Ich lerne: auch stilles Betrachten macht Mut. (Und so weiter.)
Es ist furchtbar kitschig geraten. Aber es ist auch köstlich ehrlich und vollgestopft mit Laune und Ehrlichkeit. Teufelchen wird es eines Tages von mir zum Lesen bekommen. Warum auch nicht? In einer Welt der Kriege muss es ein leichtes sein, Wildfremden Gedichte zu schenken.
*
Eigentlich ist an mir nichts, was es nicht auch im Lebenslauf anderer Zweiunddreißigjähriger geben könnte oder was eben auch darin fehlt. Ich nehme keine Drogen, obwohl ich ein geradezu erotisches Verhältnis zu ihnen habe. Die Tatsache, dass ich nur zugreifen müsste, um mich ihnen hinzugeben, reizt mich auf. Weder bin ich magersüchtig, noch saufe ich. Ich hasse es, wenn Leute Kühlschränke und Möbelgarnituren einfach in den Wald »entsorgen«, wobei das Zeug natürlich Jahrhunderte lang nicht verrottet. Die Augen tun mir weh von den aufgedonnerten Peinlichkeiten auf Plakatwänden, denen man nicht mehr entrinnen kann. Politiker respektiere ich nicht und winde mich hilflos unter den unsinnigen Regeln, die sie, weltfremd und präpotenzgeschwellt, aufstellen. Die Schlagzeilen in den populären Schmiermedien bringen mich fast zum Kotzen, und ich mag nicht mehr zuhören, was die Leute in den Straßenbahnen reden. Weder bin ich fernsehsüchtig, obwohl ich manchmal unterhalten werden will, noch teile ich blindlings professionelle Meinungen über angeblich großartig Zeitgenössisches oder Vergangenes ...
Man sieht - alles ist irgendwie in Ordnung mit mir. Nur etwas unterscheidet mich eindeutig von meinen Bekannten: Sobald es um Drogen geht, muss ich mich ausklinken, ganz abgesehen davon, dass ich die klischeehaften Ansichten darüber satt habe. Gerade ich könnte doch aufheulen »Um Gottes Willen! «. Statt dessen sage ich »Jeder wie er will ...« Meine Erfahrungen heraufbeschwören, nur weil gewisse Leute reichlich spät und weil es ihnen gerade ins Plauderkonzept passt, daraufkommen, dass ich welche habe, mag ich nicht mehr. Keine Ratschläge sind von mir zu bekommen, nichts Hilfreiches. Bekannte konsumieren Antidrogenfilme, jammern »... ah, wie furchtbar« und schmausen Popcorn, oder sie schütteln den Kopf über die Zustände in der »Szene«, weil - laut gieriger Berichterstattung - wieder ein strafunmündiger türkischer Dealer selber drauf war und in einem U-Bahn-Klo abgekratzt ist.
Auf keinen Fall will ich noch wissen, welche superschlauen Theorien zu Sucht und Entzug sich selbsternannte Fachleute aus den Fingern gesogen haben, Leute, die noch keinen Tag in ihrem Leben entweder süchtig oder einem Süchtigen angehörig gewesen sind. Ich will keine suppendünnen Stories von inkompetenten Zeitgeistjournalisten über Teilzeitjunkies lesen. Es ist nicht toll, wie die Prominenz auf Koks herumzurennen, auch für die Prominenz nicht immer, aber das kommt aus den Geschichten nicht heraus. Und wenn »begnadete« junge Autoren Drogenromane »knallhart« aus der »Szene« schreiben, mit potentiellen, aber feigen Giftlern unter uns Kohle und Berühmtheit gegen seismischen Kitzel im Organ Gefangene Verderbte Lust tauschen, möchte ich zuschlagen. Egal, was ich treffe. Schon gar nicht möchte ich erleben, wie kommerzsüchtige Regisseure das Thema mit viel Musik, tollen Beleuchtungseffekten und superattraktiven Darstellern vor dem ahnungslos lechzenden Publikum breittreten. In Wirklichkeit kotzt der Fixer auf Entzug nicht unter geilen Rhythmen, schaut er nicht zum Anbeißen an, auch wenn er im Arsch ist, sind verluderte Dealerbuden nicht hübsch belebt von Licht-Schatten-Effekten und reiht kein Techniker die Szenen aus dem Leben eines Süchtigen leicht verdaulich aneinander. Die wahre Drogenszene besteht aus Kälte, schleppender Sprache, Angst, verfallenden Körpern, Eile, Missachtung, dem Gestank von Erbrochenem, schlechtem Gewissen, Schmerz, Dämmerung, Hunger, Alleinsein, Schläfrigkeit und dem Gefühl, auf abschüssigem Glatteis ins Schlittern zu kommen oder bis zum Hals in zäher Marshmallow-Paste zu waten.
Tja, wie heißt es in irgendeinem Gedicht? Der Mond ist auch oft nur halb zu sehen und ist doch rund und scheußlich kahl ... oder so ähnlich.
Einen Hund habe ich adoptiert. Er ist nun eineinhalb Jahre alt und greift manchmal große, fremde Rüden an, wenn sie sich uns harmlos nähern. Manche Leute sagen »... süß, wie er das Fraudi verteidigt!« ich weiß aber, an schlechtem Gewissen kauend, dass er oft aggressiv ist, weil ich es auch bin und er das als mein Partner ausbaden muss. Bin ich gut drauf, wedelt er auch andere Rüden an. Geht es mir übel, knurrt er sogar vor jungen Weibchen, die er ansonsten vergöttert. Weil er blindlings an das Gute in Mensch und Tier glaubt, hat er schon ordentlich draufgezahlt in seinem jungen Leben. Überfahren. Gebissen. Getreten. Heißt es nicht in einem Sprichwort »... gleich und gleich gesellt sich gern«? Dennoch ... aus der Haut fahren könnte ich, wenn er leise jammernd fiept, weil er mit dabei sein möchte, wenn ich ausgehe. Auf ihn zu stürze ich dann und schreie ihn an, auch, wenn er um Anteil an Joghurt, Schokolade, Käse oder Mandarinen betteln kommt, dass er ein Scheißvieh sei und mir nur noch auf die Nerven gehe. Verpissen solle er sich! Und er trollt sich demütig. Wenn er aus meinem Wagen mitten auf die Straße springt, ohne dass ich es ihm erlaubt habe, brülle ich, dass ich ihn eines Tages erschlagen würde. Er legt die Ohren an und macht sich klein. An meinen guten Tagen passieren ihm solche Ausrutscher aus der guten Erziehung nicht. Aber meist freue ich mich wie blöd über seine Anwesenheit in meinem Leben. Allerdings glaubt er immer, es wird ganz sicher aufs Herumtollen auf einer Wiese hinauslaufen, wann immer wir ins Auto steigen oder zu Fuß ins Stadtgewühl wandern. Ich sehe ihm an, dass er an nichts anderes denkt, als an sein Vergnügen. Insofern bringt er mich wieder in Rage, denn ich habe es schließlich auch nicht immer, wie ich es mir wünsche. Und seinen vorwurfsvollen Blick hasse ich. Doch es ringt mir Respekt für seinen Spürsinn ab, dass er genau erkennt, wann ich gut drauf bin und sich trotz allem nur vor mir fürchtet, wenn er eine echte Sünde begangen hat. An der Leine zu ziehen erlaube ich zum Beispiel nicht. Er hat soviel Auslauf, dass er die wenigen Male an der Leine ordentlich gehen kann. Von mir verlangt er auch, dass ich pünktlich das Fressen liefere. Zieht er dennoch, reiße ich ihn zurück, dass er sich fast überschlägt. Das funktioniert, denn er wiegt kaum neunzehn Kilo.
Eigentlich ist es seltsam, dass ich niemals erfahren werde, ob der Hund nun wirklich mein Freund oder mir nur untertan und wegen seiner Abhängigkeit von mir nett zu mir ist. Wäre es so, hätte ich mich schon wieder getäuscht in meinem Partner ... Wer immer Freud gelesen hat, wird nun, vermeintlich wissend, nicken. Ich aber glaube Freud nicht viel.
Einen Autounfall hat der Hund ohne Überbleibsel überlebt, aber in meinem Hirn gräbt der Schrecken hartnäckig genüsslich. Er hat am Straßenrand im Gras herumgeschnüffelt, und ich, auf der anderen Straßenseite, habe ein blaues Auto um die Kurve kommen sehen und »Hier!« statt »Steh!« gerufen ...
Willie hat nie nachgefragt, wie es dem Hund oder mir geht. Nur knapp nach dem Unfall hat er gemeint »... er ist doch auch ein bisschen mein Hund.«
Wenn Willie etwas sagt, glaubt man es ihm, egal, wie er es meint. Willie ist ein Blender, ein Mann, der so verschlossen ist, dass man es nicht einmal merkt, weil er im Grunde nie aus sich herausgeht. Das weiß ich heute, mehr als zehn Jahre, nachdem ich ihn kennengelernt habe.
*
Neulich ist er wieder einmal bei mir eingezogen. Nach Monaten einer halbfreundschaftlichen Vakuumphase habe ich ihn bei seiner Mutter - ich hab' ja gewusst, dass er dort ist! - angerufen und gefragt, ob er wieder nach Wien ziehen und die Miete mit mir teilen würde. Mir gehe es derzeit finanziell nicht so gut, und ich wüsste ja, dass er Wohnung und Job suchte ...
Wochenlang haben wir es nett miteinander gehabt. Ich habe oft daran denken müssen, wie es gewesen ist, als wir vor mehr als zehn Jahren zusammen unsere erste Wohnung in Wien bezogen haben - optimistisch und ahnungslos, beide. Er ist ziemlich freundlich, gewesen, nun, bei unserem letzten Beisammensein, zärtlich sogar. Natürlich sind wir wieder miteinander ins Bett gegangen, und es hat sich abgespielt wie immer im letzten Jahr: Als wären wir schwer verliebt ineinander, sind wir übereinander hergefallen, richtig mit Schmusen und so, haben es ein paarmal knapp hintereinander wild getrieben. Und dann war Schluss für Wochen. Nichts mehr. Kein Zeichen körperlichen Begehrens mehr, Nebeneinanderliegen beim Fernsehen, aber niemals wieder ein Griff nach dem Körper nebenan. Es war, als wären wir schlagartig verlegen und uns fremd geworden, als sei alle geballte Erotik zu Staub zerfallen und verweht ...
Wieder mit ihm zu schlafen hat vielleicht eher etwas mit meinen Hormonen zu tun gehabt, als mit ihm ... nein, das stimmt nicht. Er war es, mit dem ich geschlafen habe, nicht sein Schwanz. Ihm wird das egal sein. Beim Fernsehen hat er meine Wange gestreichelt, wir haben schöne Spaziergänge unternommen und Gutes gekocht. Im Kino waren wir auch. dass er mich nie eingeladen hat, habe ich geschluckt, schließlich ist mir klar gewesen, dass er noch weniger Geld als ich haben muss.
Aber wir haben für ein Monat tatsächlich je die Hälfte von Miete, Strom und Einkaufskosten gezahlt. Er ist viel unterwegs gewesen, um sich da und dort vorzustellen, hat gute Jobs in Aussicht gehabt, und wenn er einen Vormittag verschlafen hat, habe ich die Zähne zusammengebissen, möglichst nicht an früher gedacht und bin meiner Wege gegangen. Er hat mich oft angelächelt und »Maus« zu mir gesagt. Und zum Hund ist er nett gewesen. Der Hund vergöttert Willie sowieso. Klar war ich streng mit Willie, es ist schließlich meine Wohnung, und ich bin kein Putzsklave. Eines Tages habe ich gesagt, »... ich gehe einkaufen, und wenn ich zurückkomme, ist die Bude blitzblank!«
Als ich zurückgekommen bin, ist die Bude blitzblank gewesen, und Willie hat mich mit einem Kuss begrüßt.
Irgendwann ist er eine ganze Nacht lang ausgeblieben. Ich bin morgens arbeiten gegangen, ein Aushilfsjob in der Firma einer Freundin, und abends ist er im verdunkelten Zimmer gelegen und hat gestunken. Für mich galt: Zähne zusammenbeißen, kochen, nichts fragen ...
Ein paar Tage später ist er mitten in der Nacht schwankend eingetrudelt. Er hat mich mit trockenem Mund angelallt, gegrinst und gefragt, was ich denn hätte, er sei doch so wie immer. Sein Grinsen, das Lallen haben etwas in mir zum Einstürzen gebracht. Wie damals, als ich Malariaanfälle gehabt habe, ist mir Zittern ausgebrochen, peinlich, fast, aber nicht einzudämmen. Eiskalt war mir, und mein Herz ist durch den Brustkorb bis in die Kniekehlen und ins Hirn gerast, während Willie einfach weiter gegrinst und den Hund gestreichelt hat.
Verschwinde, habe ich gefleht und mich gewundert, weil ich es ernst gemeint habe, von üblem Verdacht gewürgt ... du hast mir genug angetan, ... ich könnte nicht ertragen, wenn alles wieder von vorne begänne. Er kauerte auf dem Boden und grinste mich an.
»... sieht doch ein Blinder, dass mit dir etwas nicht stimmt ... schon wieder nicht stimmt ..« habe ich gewütet. Dieses Lallen und Grinsen. Die Vergangenheit hat mir aus allen Ecken meiner Wohnung hohngelächelt. Willie hatte keine Alkoholfahne!
Es ist halb ein Uhr nachts gewesen als ich ihm befohlen habe, seine Sachen zu packen und zu gehen, ehe ich ausraste. Er hat es getan. Einfach so. Den Schlüssel solle er mir dalassen. Er ließ mir den Schlüssel da, stand in der Tür, groß, tollpatschig, wie immer, seinen Rucksack umgehängt, sein Ohrring hat geschimmert, alle Jacken übereinander angezogen hatte er, still und nicht mehr grinsend ...
»Schau dich nur an!«, hab' ich geheult und gehofft, er würde versuchen, mich zu besänftigten, mir etwas erklären.
»Pah, schau dich lieber an!«
Und er ist gegangen, nicht ohne sanft »Ciao« zu sagen und nachzufragen, ob er mir den Schlüssel auch wirklich schon gegeben hätte. Ich habe vom Fenster aus gesehen, dass er das Gartentor ganz sanft hinter sich zugemacht hat.
Die Stille in der Wohnung war furchtbar. Die ganze Nacht lang habe ich kein Auge zugetan, ihn gerochen, gehört, gewartet, dass er zurückkommt oder wenigstens anruft.
Danach habe ich eine Woche lang versucht, ihn bei Bekannten oder bei seiner Mutter ausfindig zu machen - erfolglos. Mein Reue hat mich fast zum Kotzen gebracht. Aber er ... hätte er nicht mit mir reden können? Nur kurz? Mir erklären?
Als mir das Geld ausging, konnte ich meine Bankomatkarte nicht finden. Meine Kontoauszüge zeigten mir, dass wochenlang, da ich die Karte nicht benutzt hatte, Geld von meinem Konto abgehoben worden war. Nur Willie hat den Code gekannt. Ich bin dahintergekommen, dass er mir sogar den Betrag, den er mir geschuldet hat, mit meinem eigenen Geld zurückgezahlt haben muss. Irgendwann, zu Besuch in Willies Sommerwohnung am Neusiedler See, habe ich Willie mein wieder erstarktes Vertrauen beweisen wollen und ihm den Bankomatcode genannt, für den Fall, dass mir etwas zustoßen sollte ...
Willie ist wahrscheinlich ein Arschloch. Er hat mich in den Wochen unseres Zusammenlebens gestreichelt und bereits meine Bankomatkarte in der Tasche gehabt, wissend, dass ich sie irgendwann vermissen würde. Willie und ich haben besprochen, dass wir sparen müssten, dass es aber schon gehen würde, weil wir ja beide bald wieder einen Job haben würden. Willie hat gewusst, dass kein Geld auf meinem Konto war, gerade eine Nullposition. Sukzessive hat er kleine Beträge mit meiner Karte abgehoben, bis mein Minus groß genug geworden war, dass nichts mehr abzuheben war. Er hat mich »Maus« genannt und meine Kochkünste gelobt, um seinen Diebstahl wissend und vermutlich bereit, ernsthaft mit mir nach meiner Karte zu suchen. Wenn ich ausging, blieb er zu Hause - fernsehen - denn er müsste mit seinem Geld schließlich haushalten. dass es aus anderen Gründen zum Eklat gekommen ist und ich ihn - gefühlsmäßig seltsam misstrauisch - hinausgeschmissen habe, muss für ihn ein Geschenk des Himmels gewesen sein.
»Du bist es nicht wert, dass ich mich deinetwegen aufreibe!« habe ich ihm nachgerufen, an jenem Abend, ahnungslos. Und er hat sich umgedreht, schon im Gehen, genickt und gemurmelt »... nein, ich bin es wirklich nicht wert.«
Nach all den Jahren und zu einer Zeit, da ich ihm nichts weniger als einen derartigen Vertrauensbruch zugetraut hätte, hat Willie sein übelstes Gesicht gezeigt. Ich glaube, er hat einen Weg gesucht, mich so stark zu kränken, dass unsere Verbindung irreparabel zerbricht. Er hat diesen Weg gefunden. Und ich habe getan, was ich nie für möglich gehalten hätte: Ich habe Willie angezeigt.
*
Nennen wir ihn also Willie. Dieser Mensch kann perfekt so tun, als sei nichts interessanter für ihn sein als Gegenüber und das, was jenes spricht und meint. Und nur ich weiß, dass sein schöner, tiefer Blick oft einfach Fassade ist. Er hat es mir selbst gesagt. Von selbst wäre ich nie darauf gekommen. Oft ist sein Blick aber auch hochmütig und irgendwie flach gewesen, und ich habe mich abwenden müssen vor Widerwillen. Den Blick eines Junkies erkenne ich nun bereits aus der Ferne, und will ich mir nervöse Übelkeit einhandeln, muss ich ihn mir nur vorstellen. Früher einmal hat hinter Willies vermeintlichem Interesse eine Maschine auf Hochtouren die Frage nach dem »Woher und wie unauffällig Stoff nehmen ...« behandelt. Was sie heute produziert, weiß ich nicht.
*
... ich gehe viel tanzen und ins Kino und kaufe mir weder neue Schuhe noch teures Essen. Naja, das mit dem Schuhekaufen bedeutet nicht, dass ich keine neuen Schuhe brauche. Um ein günstiges Schuhgeschäft aufzusuchen, müsste ich nämlich ganz gezielt die Fahrt dorthin nicht nur planen, sondern auch durchführen. Und das fällt mir momentan wirklich schwer. Ich war noch nie ein Konsumfreak. Zum Glück. Sonst wäre es uns in den schlechten Jahren noch schlechter gegangen. Willie ist diesbezüglich das Gegenteil von mir. Hat er Geld, kauft er sich teuerste Schuhe, technische Geräte und Sportartikel, lädt alle möglichen Leute zu allem Möglichen ein, und früher hat er bei jeder Gelegenheit Drogen gekauft. Einmal unterwegs Holland ... schnapp, die Kumpels zum Koksen eingeladen und selber aus reiner Nostalgie ein bisschen H geraucht. Und ich bin der Trottel an seiner Seite gewesen, über den man im Insiderkreis mitleidig gekichert und vor dem man alles Verdächtige penibel verborgen hat. Nur das Kiffen hat er nie besonders mögen, mein Willie. Früher, als Teenager, ja, aber als Erwachsener ...
... ich spare und ernähre mich gesund. Ab und zu rauche ich jedoch Zigaretten, obwohl mir schwindelig davon wird, aber es hilft meiner Verdauung und es lässt mich Coolness fühlen. In meiner ersten Zeit mit Willie zusammen in Wien habe ich indische Beedies geraucht, das sind kleine Zigaretten, ganz und gar aus Tabak, außen und innen. Ihr Rauch stinkt erbärmlich. Außerdem sind sie schwer erhältlich - damals auf dem Flohmarkt auf dem Naschmarkt, samstags - und so stark, dass man sowas wie high davon wird, wenn man das Rauchen nicht gewöhnt ist. Ich habe also Beedies geraucht, weil es in einschlägigen Lokalen dadurch so ausgesehen hat, als rauchte ich Haschisch oder Gras oder als hätte ich interessante Verbindungen nach Indien. Dadurch habe ich mich akzeptiert gefühlt von den Leuten. Das Wichtigste daran: Ich habe mir eingebildet, ich sei Willie nun näher.
... und ab und zu ein Glas Rotwein fördert die Blutbildung, sagt meine Oma, die hoffentlich noch lange leben wird. Sie ist vierundachtzig Jahre alt. Manchmal würde ich ihr aber trotzdem gerne ins Gesicht sagen, dass sie sich lieber um mich kümmern sollte, statt ständig nur über die Wehwehchen entfernter Bekannter zu reden und darüber, wie schwer alles für eine alt Frau sei. Das war schon immer so, dass sie nicht wissen hat wollen, was ich so mache. Ich bin schließlich immer »die Große« gewesen. Willie kann sie nicht leiden, sagt sie, punktum, am besten, er kommt ihr nie mehr ins Haus. Aber auch hier fragt sie nicht nach. Sie hat ihren Willen: Er wird ihr vermutlich tatsächlich nie wieder ins Haus kommen.
Die »Große« bin ich deshalb, weil mein Bruder zwei Jahre nach mir zur Welt gekommen ist. Ein Motto lautet seit meinem ungefähr siebenten Lebensjahr: Die »Große«, habe gefälligst vernünftig, also niemals in Gefahr oder in Schwierigkeiten zu sein. Mein Bruder ist als Kind zweimal überfahren worden, hat einige Alkoholvergiftungen überlebt, jede Menge Polizeistrafen gesammelt, ist in Schlägereien geraten, unschuldigerweise auch von einem Polizisten geschlagen worden, hat ein paar Auto- und Mofaunfälle gebaut, einige Ausbildungsarten, die er angefangen hat, wieder aufgegeben und sich viel herumgetrieben.
Meine Eltern haben sich nächtelang angeschrien, während ich meinem Bruder erklärt habe, wie Küssen funktioniert. Wir haben uns gegenseitig die Arme bis zum Einschlafen massiert und gemeinsam unter der Decke geheult, wenn wir den Ehekrach fast nicht mehr ertragen haben. Wir sind beide Vorzugsschüler gewesen. Einfach so. Kein Lernen. Kein Anstrengen. Und wir haben viel Schläge bekommen. Hauptsächlich von unserer Mutter. Sie hat auf uns eingedroschen, weil sie frustriert und unglücklich in ihrer Ehe gewesen ist. Vielleicht hat sie uns auch übelgenommen, dass sie durch uns an meinen Vater gebunden ist.
Mein Vater hat mich als Elfjährige noch mit nacktem Hintern übers Knie gelegt. Oft haben wir auf den scharfen Kanten von Holzscheiten knien müssen, die Arme über dem Kopf erhoben und mindestens eine Stunde lang. Das hat unser Vater verordnet, und unsere Mutter hat nichts dagegen gesagt. Ob es recht ist, das zu erzählen?
Einmal, ich war ungefähr sechzehn Jahre alt, bin ich um ein Haar einer Vergewaltigung entkommen, mit aufgeschürften Knien, blutend und heulend nach Hause gerannt und vor meinem Bett zusammengesackt. Meine Eltern haben einander im Zimmer nebenan alle Gemeinheiten der Welt an den Kopf geworfen, und mein Bruder war unauffindbar. In dieser Zeit habe ich mir fast täglich einen angetrunken.
Natürlich hat es in unserer Kindheit auch schöne Zeiten gegeben. Allerdings haben mein Bruder und ich uns währenddessen immer ein wenig davor gefürchtet, die schlechten könnten jeden Moment wieder ausbrechen. Die Geschichte meiner Jugend ähnelt sicher zahllosen anderen Geschichten der Angehörigen meiner Generation, deren Eltern Kinder der Kriegsgeneration sind, ist also auch nichts Besonders. Der Mensch erlebt eben und wird davon geprägt. In welcher Familie ist schon alles okay? Für Willie bin ich übrigens nie die »Große« gewesen, allenfalls die Blinde, allzu Gutmütige, die immer wieder mit ihm ins Bett hüpft und ihm Geld borgt.
Allerdings habe ich mich schon früh gefragt, was am Menschen eigentlich besser sei als am Tier. Seit ich meinen Hund bei mir habe, frage ich mich das neuerlich.
Mein Bruder ist in Krisensituationen aggressiv bis zur Rage geworden. Dass ich diesen Wesenszug auch in mir trage, habe ich erst in den letzten Jahren entdeckt. Irgendwann bin ich Willie von der obersten Treppe einer Stiege aus mit einem Satz angesprungen, und er ist ganz unten gestanden. Früher bin ich bekannt gewesen für mein ruhiges Nettsein. Seit Jahren könnte ich in Wien auf den Strich gehen, kriminell sein oder selbst schwer drogenabhängig. Von meiner Familie würde kaum jemand gemerkt haben.
Mein Vater hat mir Zwölfjähriger seine Ehekrise täglich ins Genick gekotzt, desgleichen meine Großmutter ihr Missbehagen über die Schwiegertochter und über Opa, mein Opa über meine Katze, die angeblich die Blumenbeete vollschiss und der er zuweilen mit einer Holzhacke nachstellte, meine andere Großmutter über den versoffenen, gewalttätigen Großvater, desgleichen meine Mutter ihr Eheleid und mein Bruder seine Hilflosigkeit. Mein Bruder ist später zur Koryphäe als Organisationsprogrammierer aufgestiegen, im Alter von sechsundzwanzig Jahren an Krebs erkrankt und mit siebenundzwanzig daran gestorben. Damals haben meine Eltern bereits seit Jahren getrennt gelebt, und mein Vater war wieder verheiratet. Er hat meinen Bruder auch während der Zeit seines Dahinsiechens links liegen lassen. Zum Begräbnis ist er gekommen.
Einige ungefähr Gleichaltrige glauben viel über mich zu wissen. Allerdings ahnen sie nicht, wie bitter ich ihnen Ignoranz vorwerfe. Sie haben sich mit mir verabredet und waren froh, mich wieder loszuwerden samt dem schmuddeligen Ruch des Verderbten, sicher Kriminellen, den sie an mir haften spürten, seit ich Willie kannte. Und habe ich, stotternd, sie einzuweihen versucht, nickten sie ernsthaft, vermeldeten Sinniges wie »... dass du dir das antust« und »... wie oft habe ich dir gesagt, lass’ ihn doch«. Und oft habe ich gespürt, wie ihre Gedanken Richtung Uhrzeit abgeschweift sind. Meine Mutter hat höchstens gesagt und sagt es noch immer »... na, du wirst schon sehen«, und damit hat sie gemeint, ich würde schon meine eigenen Entscheidungen treffen. Welche sonst?
Eigentlich verstehe ich die Ignoranten. War ich selbst, als direkt an meinem Erleben Beteiligte, schon hilflos in Gedanken, Worten und Werken - was kann ich da von Außenstehenden verlangen?
Keiner meiner sogenannten Freunde und auch keiner meiner Verwandten hat nur ein einziges Mal erlebt, wenn Willie so richtig »drauf« war oder eben nicht so richtig »drauf«. Denn einen Süchtigen erkennt meist nur dann als solchen, wenn er eben keinen Stoff mehr hat. Als Willie einmal in der Wohnung seiner Mutter herumgelegen ist, bis oben hin zugeknallt mit irgendwelchen Tabletten und sonstwas, habe ich seine Mutter aus dem nahen Gasthaus, wo sie in der Küche gearbeitet hat, zu ihm hin gezerrt, ... geheult habe ich und sie angeschrien, sie solle sich die Schweinerei anschauen! Und Willie habe ich links und rechts ins Gesicht geschlagen, damit er aufwachen sollte. Nach Alkohol hat es kein bisschen gestunken in seinem Umkreis. Seine Mutter hat verlegen gelacht. Hilflos wie ein kleines Mädchen hat sie die Schultern gezuckt und gefragt, was sie denn tun solle. Wird er halt besoffen sein, naja, ... würde schon wieder nüchtern werden, der Willie.
Ich hasse es, wenn Mütter sich den Anschein geben, hilflos wie kleine Mädchen zu sein.
Es geschah, dass Willie Mutter mich mitten in der Nacht in Wien anrief, panisch jammerte, Willie sei verschwunden, und sie mache sich solche Sorgen. Mit dem Schlimmsten der Schlimmen sei er ausgegangen. Jener sei aber angeblich bereits allein wieder nach Hause gekommen. Und Willie ... ? Sie wagte nicht, irgendwo anzurufen. Ich sollte doch etwas tun! Also habe ich von Wien aus die Kärntner Gendarmerie- und Polizeiposten und Krankenhäuser und Willies Freundesadressen telefonisch durchstöbert. Als er dann aufgetaucht ist, ruhig und grinsend, hat niemand mich angerufen, um mich zu beruhigen. Ich habe es ganz zufällig bei meinem nächsten Anruf im Morgengrauen erfahren, mit brennenden Augen und am durchdrehen vor Angst.
Zu diesem Zeitpunkt war ich schon längst nicht mehr ich selber.
*
... die Kinder meines Bruders sind heute liebe kleine Glanzlichter in meinem Leben. Es ist aber sicher ganz gut, dass sie mit ihrer etwas seltsamen Tante nicht allzuviel zu tun haben. Meine Haare gehen nicht mehr so arg aus, und ich bin endlich in eine Wohnung in schöner Lage gezogen. Viel Grün, viel Ruhe, viele Hunde in der Nachbarschaft, nicht teuer, weil es sich um eine Bruchbude handelt, die Willie und ich bewohnbar gemacht haben. Hilfsbereit ist Willie allemal. Und er liebt körperliche und handwerkliche Arbeit. Meine Nachbarin betreibt kosmobiologische Energiearbeit, und neulich habe ich einem wildfremden Gärtner in ihrem Garten ein Ölbild geschenkt, das ich gemalt habe, ein Werk, von dem ich mich eigentlich nie trennen wollte. Einigen ehemaligen Freunden habe ich schriftlich meine Meinung gesagt. Und ich schicke schon wieder Bewerbungsschreiben durch die Stadt. Mein Geld wird mir nämlich bald ausgehen, und wem könnte ich auf der Tasche liegen, wenn ich pleite wäre? Höchstens Willie. Aber Willie ist zur Zeit, da ich dies schreibe, verschwunden. Es ist der Monat eins nach der Bankomat-Aktion ...
Manchmal antworte ich auf nette Kontaktanzeigen. Allerdings treffe ich mich nie mit den Männern, ich will nur wissen, was sie zu sagen haben. Meistens enthüllen sie mir bei ihrem ersten Brief die große Müllhalde in ihrem Inneren. Da lobe ich mir Willie. Er ist durch seinen Vater und durch die Drogen vergiftet worden. Aber sein Innerstes unter dem Dreck ist ganz okay. Daran glaube ich. Und für nächstes Jahr plane ich eine große Reise.
*
Als meine Mutter Willie zum erstenmal begegnet ist, hat sie nur mir zuliebe gelächelt, das weiß ich heute.
»Ja, ... eine wilde Henne,« hat sie gesagt, und ich war erstaunt über die Flapsigkeit ihres Ausdrucks. Auf gut Kärntnerisch sagte sie eigentlich, der Sprachlosigkeit wehrend, »... a wülde Henn' ...« , nichts weiter, als ich auf ihn zeigte, rotwangig vor Aufregung. Langhaarig war er und eindeutig seltsam, gar nicht so, wie die Leute in unserem Bekanntenkreis ausgesehen haben. Meine Mutter hätte sicher lieber ausgerufen, ich sollte augenblicklich die Finger von diesem Kerl lassen, er sähe ja hochgradig verdächtig aus und das in jeder Hinsicht. Aber sie hat mir wohl angesehen, dass nichts mich davon abhalten würde können, ihn kennenzulernen. Nichts und niemand. Später hat sie gesagt, »... ich hab's ja gleich gewusst ...«. Aber geholfen hat sie mir nie viel. In puncto Unterstützung war sie auch keine Ausnahme.
An das Jungesmädchensein erinnere ich mich sehr gut, auch wenn vierzehnjährige Schüler mich beim Spazierengehen mittlerweile grüßen statt mir freche Gesten zu machen. Unter den heutigen Zwanzigjährigen falle ich oft gar nicht auf, das weiß ich, wenn ich einen guten Tag habe. Allerdings wachsen mir schippelweise weiße Haare nicht mehr nur auf dem Scheitel. Meine Schläfen fallen neuerdings auch der Vergreisung zum Opfer. Sieht cool aus, sagt man, mit meinem jungen Gesicht. Mein Inneres hingegen ist uralt. Ich komme erst heute dazu, mir die Nächte um die Ohren zu schlagen. Leider weiß ich nie, ob junge Männer mit mir flirten, weil sie eine reife Frau ihr Ego polieren lassen wollen oder weil sie mich für jünger halten, als ich bin.
Jahre her ist, dass ich innerlich ungefähr so alt war, wie ich äußerlich gewirkt habe. Gott sei Dank spüre ich ihn heute noch deutlich, diesen Zustand des frischen Mutwillens und der spöttischen Kraft, die zu immer neuem Lächeln und Flirten verführt und zum beleidigt Fliehen, um neugierig wiederzukehren. Heute noch bin ich oft kess genug, dass mir die Menschen zugehen würden, ließe ich sie. Teufelchen, der fremde Tänzer in irgendeinem psychedelischen Club, ist der einzige, der mir in der letzten Zeit nahekommen ist. Irgendwann hat er mir beim Tanzen Tee gebracht. Man stelle sich vor, er sagte »... vertrau' mir, es ist nur Tee.« Als würde er meine Geschichte kennen. Ich hab' ihm vertraut, nur, um zu probieren, wie es sich anfühlt. Gesprochen habe ich nie mit ihm, ihn immer nur beobachtet. Beim Tanzen schließe ich die Augen, damit man mich in Ruhe lassen soll. Dem grellen Licht einer Unterhaltung mag ich mich immer noch nicht stellen. Gut, dass die Menschen nicht ahnen, wie sehr ich hassen kann.
*
Es ist mehr als zehn Jahre her, dass der fremde junge Mann am Nebentisch mich so sehr fasziniert hat, als wäre er aus Gold. An jenem Nachmittag war ich eine biegsame, schüchterne Zweiundzwanzigjährige mit dunkler Pagenfrisur, glatter Haut, dünnen Schenkeln und kurzen Fingernägeln, ständig gegen die Lust auf Süßigkeiten kämpfend und bereits beseelt vom Vollbewusstsein der großartigen Abenteuer, die ihrer sicherlich harrten. Unschuldig war ich, ein wenig gemartert von den üblen Verhältnissen in meinem Elternhaus, aber seit Jahren mit Hilfe von Katzen, Bäumen, Fahrrädern und Büchern vermeintlich gefeit gegen wirkliche Erschütterungen. Ich litt, wie jedes Kind in gärenden Ehen leidet, das, längst erwachsen, die kämpfenden Eltern nicht aus den Augen zu lassen wagt, aus Angst, sie könnten einander töten oder sich selbst und das Leben des Kindes noch übler beeinflussen, als sie es ohnehin schon taten.
Mein Bruder, jünger, ist ein Ausbund labiler Feinsinnigkeit gewesen, ein so lieber Bub, dass alle Welt gestaunt hat über seine süße Gescheitheit und sein unbefangenes Geschick in all seiner Versunkenheit in undurchschaubare Träume. Mit den Jahren eines Heranreifenden wurde er zunehmend strenger. Er sollte alles Pech der Welt, ein bisschen Karriere, eine nicht liebende Ehefrau und zwei süße Kinder erleben und jung, qualvoller als vorstellbar, sterben. Er schaute zeitlebens dramatisch offen und naiv in die Welt, dies trotz seiner gewaltigen Intelligenz, die ihn zu einem hilflosen Genie gemacht hat. Sein Sohn hat dieses beschämend klare, traurige Schauen geerbt. Die Krankheit brach in einer Zeit aus, als wir uns - absichtlich - schon ziemlich auseinandergelebt hatten, als die Katastrophen in meinem Privatleben eskalierten und unsere Mutter den Kampf gegen die Alkoholsucht scheinbar zu verlieren im Begriff war.
Seit ich meinen toten Bruder gesehen habe, weiß ich, dass es im Leben nur einen Trost für alles Schreckliche gibt: den, dass man selbst unweigerlich sterben wird. Als ich Willie kennenlernte, hatte mein Bruder noch sieben Jahre zu leben, und er hat mich oft und oft gewarnt vor Willie. Vielleicht nehme ich meinem Bruder übel, dass er sich später aus der Affäre gezogen hat, vielleicht neide ich es ihm. Ich sage nicht »... so einfach aus der Affäre gezogen hat ...«, nein, das sage ich nicht. Denn ich glaube kaum, dass es grausameres Leiden gibt als das seine. Wenn ich heute sage »mein Bruder«, kann ich mir kaum noch etwas unter diesem Begriff vorstellen.
Ich hätte seine Warnungen ernst nehmen und vor seinem Tod einmal, ein einziges Mal wirklich offen mit ihm reden sollen. Es hat sich nie ergeben zwischen uns.
Indien.
An jedem Nachmittag, als ich den Langhaarigen zum erstenmal sah, waren mein Bruder und ich schon keine Geschwister mehr, nur noch Heranwachsende, die unterschiedliche Haltungen gegenüber ihren Eltern einnahmen. Er war immer »der Kleine« gewesen und hatte mich, »die Große«, zuerst bewundert und dann verabscheut, weil ich immer für alles eine Antwort gehabt habe, auch dann, als er seine eigenen Maxime präsentieren wollte. Damals bin ich fast stolz gewesen auf meine Rolle als »die Große«, habe wirklich um Frieden in der Familie gekämpft. Es war ein ungeheuerliches Unterfangen für einen Teenager, völlig aussichtslos. Und doch habe ich alles daransetzen wollen, unsere Familie zusammenzuhalten - auch auf Kosten der Bewunderung meines kleinen Bruders. Für ihn war ich bald nur noch eine zänkische, blöde Gans. Später hat er mich wohl gehasst.
Nach seinem Tod habe ich erfahren, dass er seinen Freunden viel von meinen Abenteuern auf Reisen erzählt hat. Ich habe nicht geahnt, dass er überhaupt davon gewusst hat ...
Wenn ich sage, ich wäre zur Zeit, da Willie in mein Leben trat, trotz allem »unschuldig« gewesen, meine ich weniger die Qualität meiner Lebenserfahrungen als vielmehr meine eigenen Vorstellungen. Ich saß wie eine brütende Henne naiv auf meinem Idealbild, einer Collage aus Edelmut, Liebe und Wahrhaftigkeit. Was immer ich Schlimmes erlebte und bezeugte, ich war sicher, das Gute würde immer wieder über die Menschen hereinbrechen und sie für alles entschädigen. Und ich war geübt im Schwelgen in wunderbaren Abenteuern. Allein im Wald herumspazierend überlies ich mich meiner Phantasie. Heute weiß ich, dass nur sie mir ein zuverlässiger Panzer war. Allerdings hatte mein süßer, fester Panzer ein Ablaufdatum.
Als ich ihn kennenlernte, begann die Macht der immer noch kindlichen Hoffnungsfreude zu erlahmen. Die Frage, wie er zu dem geworden war, der er eben war, stellte sich mir sofort. Was er über unsere gemeinsame Zeit denkt, weiß ich bis heute nicht genau.
An jenem Nachmittag erhob ein Langhaariger sich aus Gläserklirren, Stimmengewirr und den Rauchschwaden um den Nebentisch, marschierte im gelben Gasthauslicht zwischen den Gästen durch den Raum und warf seine dunkle Mähne von einer Schulter zur anderen.
Ich erinnere mich, dass ich meinen Begleiter, meinen langjährigen Freund, gefragt habe »Wer ist das ...?«, und ich habe wohl auf eine Art gefragt, als sei mir Mister Universum höchstpersönlich über den Weg gelaufen, und ich könnte es nur nicht glauben. Und mein Freund, nennen wir ihn “Tommi”, gab brav Auskunft. Er kannte den Geheimnisvollen. Jeder kannte ihn, war er doch einer der übelst beleumundeten jungen Männer der Gegend. Aus wohlhabendem Elternhaus stammte er angeblich, und der Vater hätte seinem ältesten nie etwas Gutes getan, nur an viel Geld hätte er ihn kommen lassen ... sehr verdorben sei Willie und zu allem Überfluss bereits in Indien gewesen. Verdorben, was denn verdorben hieße, fühlte ich sofort den Impuls, ihn zu verteidigen. In Indien gewesen zu sein bedeutete damals, Bekanntschaft mit Rauschgift gemacht zu haben und wahrscheinlich zu eben diesem Zweck überhaupt nach Indien gereist zu sein ...
Mein Interesse schwoll. Nun hatte ich allerdings absolut keine Vorstellung von »Rauschgift« und davon, dass der Typ bekanntermaßen ein »Giftler« sein sollte. Ich verkehrte in den Kreisen von Bienen, Vögeln, Fröschen, Katzen und meinen Freundinnen sowie einigen Burschen mit Mopeds und Sinn für Saufgelage und Herumschmusen, verstand etwas vom Biertrinken und einer Mischung aus Rotwein und Limonade und vom Zeichnen, und damit hatte es sich. Aber Rauschgift ... es klang - irgendwie interessant. Fernsehschauen mochte ich nicht, abgesehen von Filmen über Tarzan oder Dracula, also waren mir die Eigenheiten der Drogenszene bislang entgangen. In meinem Heimatort gab es wohl Gerüchte von verruchten Kneipen, wo angeblich »diejenigen« herumlungerten, vor denen uns unsere Eltern warnten, aber ich hatte mich nie damit auseinandergesetzt.
So schlimm würde es schon nicht sein, glaubte ich fröhlich, überaus angetan von dem attraktiven Burschen mit dem intensiven Blick. Er war größer als alle, die ich kannte, besser gebaut, hatte schönere Haare und Augen und eine Ausstrahlung, die mir Herzflattern bescherte. Ja, ja, er hat was, gibt meine beste Freundin heute immer noch zu, wenn er auch für sie nie als Partner in Frage gekommen ist. Die Art, wie er sich damals umgeschaut und geraucht hat, hatte nichts zu tun mit dem linkischen Habitus der Bubis, die ich kannte. Tommi lief außer Konkurrenz, ihn kannte ich seit Jahren und wusste längst nicht mehr, ob er wirklich der richtige Mann zum Heiraten für mich sei, wie meine Oma immer behauptete. Tommi hatte ich gern.
Etwas in mir seufzte, und ich wetzte auf meinem Sitz hin und her, während ich mit Tommi und meiner Freundin plauderte. Innerlich japsend vor Aufregung versuchte ich mir an Ort und Stelle eine Möglichkeit für ein Wiedersehen mit dem Wunderlichen auszudenken. Er musste ein paar Jahre älter sein als ich. Er schlenderte herum, als seien die anderen Gäste nicht vorhanden und als starrte man ihn nicht an. Er nahm ein Glas auf, irgendeines, trank, sog an seiner Zigarette, ging weiter. Er trug einen Ring und war ungemein breitschultrig, und mir schien, als sei er darauf bedacht, möglichst lässig zu wirken. Immer wieder verschwand er in der Toilette, und er wirkte enorm cool, blieb hier stehen und da stehen, setzte sich wieder, ging neuerlich herum, sprach mit diesem ein paar Worte, schien aufmerksam zuzuhören, erzählte man ihm etwas, warf sein Haar.
Damals schon ist mir natürlich aufgefallen, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Und Tommi vollzog eine Geste, die wohl besagen sollte, bei dem Burschen sei ein Schräubchen locker. Ganz gut sähe er jetzt aus, fand Tommi, man kannte ihn angeblich in schlimmen Zuständen.
Zu Hause setzte ich mich sofort an die Schreibmaschine und schrieb eine romantische Kurzgeschichte über einen geheimnisvollen Indienreisenden, der mich eines Tages ansprach und mitnahm in die Welt hinaus, und es war die große Liebe. Damals habe ich mich wohl schlicht und einfach verknallt in Willie.
Alle paar Tage nehme ich mir heute vor, dass es ab nun nur noch Fröhlichsein für mich geben wird. Gerade an ihm will ich mir ein Beispiel nehmen. Er hat immer nach dem Motto gelebt »Irgendwie wird es schon weitergehen.« Zu Hause hat man ihm nie beigebracht, was Verantwortung für sich und andere bedeutet. Nun möchte ich es mir leicht machen. Willie hat als Knabe seinem Vater während dessen Mittagschläfchen die Fußsohlen massieren müssen. Dieser Vater hat seinem Sohn aber nicht gesagt, dass das allein nicht reichen würde, um sich seinen Respekt einzuhandeln.
Einem verstockten achtzehnjährigen Frauenliebling ein teures Auto zu kaufen und sich dann zu wundern, wenn der Herr Sohn damit zu schnell fährt und Unfälle baut, kann nur einem Mann einfallen, der selbst von Geltungsbedürfnis aufgefressen wird. Und der seinem Sohn Rivale genug ist, um ihm als Strafe für Verkehrssünden das Geld für das Benzin zu entziehen und ihm die stolze, heiß geliebte Haarpracht abschneiden zu lassen und den Buben dieserart seelisch zu verstümmeln.. Willie ist abhängig gewesen von seinem Vater, in dessen Betrieb er gearbeitet hat ...
Es ist immer irgendwie weitergegangen für Willie. Mit Geld umzugehen hat er nicht gelernt, allenfalls, es irgendwie aufzustellen. Aber weitergegangen ist es trotzdem. Durch mich, zum Beispiel. Heute will ich auf die Pauke hauen. Wie Willie weiterkommt ist mir egal - ganz abgesehen davon, dass ich momentan keine Ahnung habe, wo er ist und wie es ihm geht.
Wann Willie angefangen hat, Drogen zunehmen, ist nicht mehr genau zu sagen - die übliche Entwicklung, eben. Saufgelage abzuhalten ist in jedem Milieu in jeder Altersgruppe gang und gäbe in unserem Kulturkreis. Aber im seriösen gesellschaftlichen Kreis eines Fremdenverkehrsortes hatte sich eine spezielle Jugendpartie im Untergrund gebildet, zu der jene gehörten, die provokant lange Haare trugen, Parka und Ringe, die sich in düsteren Kellerdiscos durch David Bowies Drogenhymnen anturnen ließen, durch Alice Cooper und Peter Frampton. Ich und andere standen derweil auf Smokie und die Bay City Rollers. Diese hatten mit jenen nichts am Hut, und jene waren auf jeden Fall die Bösen. Irgendwann hatte jemand etwas zum Rauchen dahergebracht, hat Willie mir erzählt. Jeder hat davon probiert, schon aus Prestigegründen. Trips haben sowieso alle geworfen, soweit Willie sich erinnern kann, und die Orgien mit willigen Weibern wären sagenhaft gewesen.
Willie hat meistens für alle gezahlt, denn das Geld seines Vaters hat für ihn keinen Wert besessen. Hat es Stunk gegeben mit dem Alten, hat Willie sich eben versteckt, bis der Alte ihn aufgestöbert und zusammengeschlagen hat. Die Mutter ist immer hysterischer geworden, hat Beruhigungstabletten, Aufputscher, Kaffee und Zigaretten gemischt und viel öfter weggeschaut als eingegriffen. Willie hat kaum mitbekommen, dass er auch Geschwister hat. Er ist nie gerne daheim gewesen. Irgendwann hat der Vater alles Geld und die Firma im Casino verspielt und die Familie verlassen. Willie hat angefangen es wild zu treiben im Kreise seiner Freunde. Und irgendwo, vielleicht wirklich in Indien, hat ein guter Freund Willie den ersten Schuss Heroin angeboten. Willie hat nicht lange überredet werden müssen. Als sein Vater später mitbekommen hat, dass sein Sohn rauschgiftsüchtig geworden ist, hat er ihn fallenlassen. Seither gibt es keine Verbindung mehr zwischen den beiden. Aber Willie hat, seit ich ihn kenne, immer wieder spontan von seinem Vater zu reden angefangen, ungefragt.
Wie oft habe ich Willie angeschaut und mir gedacht, sein Gesicht kann es doch wohl nicht sein, das mich bei ihm hält. Und wenn ich geheult habe vor Wut und vor Schmerz, aufgestampft, hat Willie mich angegrinst oder angeglotzt und gesagt, ich spinne wohl und solle ihn am Arsch lecken. Nachgelaufen bin ich ihm ... auch wenn er mich an einer Straßenecke mit zitternden Knien stehen hat lassen. Warum ... warum?
Noch jüngst, da er sich ein paar Wochen lang nicht bei mir gemeldet hatte, machte ich mir große Sorgen. Allerdings mischt sich stets auch die verflixte Trauer darunter, dass er sich einen Dreck darum schert, wie es mir geht. Früher ist mir das gar nicht aufgefallen. Wenn ich ihn erreichen konnte, hat das für mich bedeutet, er sei wohl auch für mich da. Und nun ... auch wenn wir nicht mehr zusammen sind, könnte es ihn doch interessieren, was ich mache! Aber dieser Gedanke gehört in die übervolle Schublade »Fehleinschätzung«. Willie hat sich immer darauf verlassen, dass ich komme und nachsehe, wie es ihm geht. Und ich bin gekommen und habe nachgesehen. Und viel übersehen. Absichtlich.
Immerhin haben Willie und ich jahrelang ein gemeinsames Interesse gehabt: ihn.
»Warum, zum Teufel, tust du dir das an?« haben mich immer wieder Leute gefragt.
Warum lässt man einen Drogensüchtigen, durch dessen Kälte und Achtlosigkeit man furchtbar zu leiden hat, nicht in seinem Sumpf versinken? Warum erlaubt man nicht, dass man selbst versagt oder verzweifelt? Weil er der Partner ist, in den man sich einmal verliebt hat? Weil es die Menschlichkeit verlangt? Weil man eine Aufgabe braucht? Hätte ich jemals selbst ruhig leben können, wissend, wie nahe dem Sturz in den Abgrund mein einst Heißgeliebter schon war? Hätte ich ihn aus den Augen verloren, hätte ich mich so lange gefragt, was aus ihm geworden sei, bis ich vielleicht von seinem Tod erfahren hätte. Hilft man, weil der Stärkere den Schwächeren retten muss, wenn er ihn schon nicht fressen kann?
Psychologen haben mir erklärt, ich suchte die Nähe eines Menschen, der tut, was ich mir nicht erlaube: sich gehenlassen. Na fein. Dann müsste ich jahrelang jede Menge Spaß gehabt haben durch Willie. Des Rätsels Lösung heißt aber in Wahrheit:
Früchte.
Jawohl, ich wollte die Früchte meiner Bemühungen selber ernten! Zurückbekommen wollte ich, was ich investiert hatte, in Form von Zuneigung oder Sex oder was weiß ich! Belohnt zu werden, danach habe ich gegiert! Niemand anders sollte ihn so genießen dürfen, wie ich immer wusste, dass er sein kann ... großzügig, nett, liebevoll. Niemandem habe ich den Genuss meines Sieges gegönnt, außer mir selber. Meine frühen Falten, der Verlust meiner Freude, meine Unschuld und meiner Energien sollten einen Sinn haben!
Es ist wie mit einem alten Auto. Wer bereits viele neue Teile einbauen hat lassen, wird das Vehikel nicht verschrotten, wenn noch ein Teil kaputtgeht, sondern auch noch diese finanzielle Anstrengung auf sich nehmen und hoffen, der Wagen würde nun noch lange gute Dienste leisten.
Etwas habe ich nie gemacht: selbst Heroin genommen. Aber um Willies Gefühle im Rausch habe ich ihn immer beneidet.