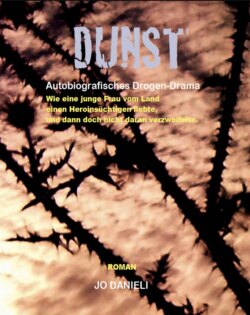Читать книгу DUNST - Jo Danieli - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеDie Suche.
Meine beste Freundin hat sich mit mir gefreut. Als ich ihr erzählte, ich sei unwahrscheinlich verknallt, strahlte sie, als sei sie es auch. Sie gönnte mir den Adrenalinstoß. Ich konnte nicht aufhören, von ihm zu schwärmen.
»Dass du dich nicht fürchtest,« hat sie aber dennoch gestaunt, schließlich war der Bursche ja nicht gerade mit dem besten Ruf gesegnet. Meine Freundin war aber nicht umsonst meine Freundin. Es könnte durchaus sein, räumte sie ein, dass er trotz allem ein lieber Kerl sei, er sähe ja ganz toll aus. Trotzdem: »... ausgerechnet der! Wie sollt ihr zwei denn zusammenpassen?«
Nun galt es, den Wunderbaren aufzustöbern. Wir besuchten Lokale, die wir immer gemieden hatten. Unseren Eltern und weniger toleranten Bekannten erzählten wir nichts davon, denn auch wenn wir volljährig waren, konnten wir uns gehörigen Unfrieden einhandeln, wenn herauskam, wo wir uns neuerdings herumtrieben. In Wien würde eine über Zwanzigjährige ihren Eltern gegenüber längst kein Hehl mehr aus ihrem Umgang machen oder sie gar nicht erst einweihen. Auf dem Land gehen die Uhren anders, jeder sieht, was der andere macht, und jeder hat einen Ruf zu verlieren.
... und eines abends fanden wir Willie halb schlafend, halb betrunken über einem Tresen hängend und vor sich hinbrabbelnd in einer Diskothek. Seltsam schwach in den Knien wurde mir, als ich ihn so groß, so schlapp sah, so hingegeben an seinen Zustand. Vorüberschleichend erlebte ich zum erstenmal seine fremde Wärme und seinen Geruch nach Rauch, Leder und einem eigenartig süßem Rasierwasser. Seine strähnigen, langen Haare wirkten wie lebende Wesen, als warteten sie auf mich, erschöpft und einsam wie der ganze Mensch.
Freunde schleppten ihn aus der lauten Musik von mir fort. In meinem touristischen Heimatort ist es außerhalb der Badesaison absolut nichts besonderes, dass junge Männer betrunken herumhängen. Meine Freundin zuckte zwar vielsagend die Schultern, aber auch ihr blonder Schwarm war nicht selten vollkommen dicht anzutreffen. Damit zu prahlen, wieviel man am Wochenende wieder gesoffen hat, ist schließlich eine Art Sport unter Teenagern, egal, ob auf dem Land oder in der Stadt. Sogar ich, Musterschülerin und naturverbundener Bücherwurm, habe mir, dreizehn- bis sechzehnjährig, gemeinschaftsbetäubt, einen Spaß daraus gemacht, so viele Biere wie möglich in mich hineinzukippen, sodann Schweinereien auszuposaunen und anschließend genüsslich zu kotzen. Jedes Zeltfest, jede Party lief nach diesem Schema ab. Alkohol als gefährliches Rauschgift zu betrachten, ist uns nie in den Sinn gekommen. Jeder besitzt schließlich einen Elternteil, Onkel, Großvater oder auch eine Tante, der oder die als feuchtfröhlich gilt ... Immerhin habe ich als Teenager nie die Pille genommen. Wozu auch? Herumschmusen gab es nicht für mich. Wen ich liebte, dem war ich treu, auch wenn ich nie näher an ihn herankam als auf ein paar Zentimeter in der Schulkantine oder im Bus.
Kein Tag verging mehr, an dem ich nicht an Willie dachte, und ich schrieb ihm einen gewaltigen Liebesbrief. Dieser Schritt war mutig, denn ich musste nun damit rechnen, dass er mich darauf ansprechen würde. Natürlich würde er Nachforschungen zum Brief anstellen. Wer kann schon unbeeindruckt davon bleiben, wenn jemand ihm sein Herz ausschüttet und ihn zum begehrtesten Menschen der Welt kürt?
Wann immer ich Willie zu Gesicht bekam, wirkte er abwesend und auf unerklärliche Weise in Eile, obwohl er minutenlang herumstehen und einfach nur Leute anschauen konnte. Mein Mut fing an in sich zusammenzusacken, denn er wurde mir immer fremder, je öfter ich von ihm hörte und in beobachten konnte. Dieser Mensch wirkte so verloren, dass seine Ausstrahlung mich einerseits anzog, andererseits das Fürchten lehrte, das Fürchten vor seiner dunklen, für mich völlig undurchschaubaren Vergangenheit. Meine beste Freundin und ich diskutieren Nachmittage lang, wie wir es anstellen konnten, Kontakt mit diesem Außerirdischen aufzunehmen. Und wir befanden, es sei das Beste und wohl nichts dabei, ihn einfach anzurufen ...
*
Stets aufs neue balle ich heute innerlich die Fäuste, wenn ich altbekannte Straßen und Gebäude, U-Bahn-Stationen und Geschäfte betrete. Es lässt sich einfach nicht vermeiden, lebe ich doch immer noch in Wien. Ganze Straßenzüge zeigen mir auf Schritt und Tritt alte Bilder. Nervöse Schüttelfröste unauffällig zu überwinden hat noch vor drei, vier Jahren zu meinem Alltag im Großstadttrubel gehört. Oft habe ich bröckelnden Putz als Sinnbild meiner eigenen verfallenden Kraft gesehen, und heute noch stimmt der Anblick eines verfallenden Hauses mich traurig. Ausgemergelte Gesichter an den Knotenpunkten der Drogenszene prangen für mich immer noch unübersehbar in der ansonsten anonymen Masse. Mich erschrecken bettelnde Hände, die sich den Anschein geben, harmlos zu sein und doch durch den Wahn einer Sucht ausgestreckt werden, die mehr vom Alleinsein kommt, als von den Giften. Wiens Nachtlichter wecken oft jähe Erinnerungen.
Erst Wochen nachdem ein Bekannter Willie zu jenem Bauernhof im Gebiet der Buckligen Welt in Niederösterreich gebracht hat, auf dem Willie seine bislang endgültige Therapie absolviert hat, habe ich aufgehört zu verwahrlosen. Als ich Willie vor Wut und Trennungsschmerz zu vergessen anfing, habe ich mich auch selber langsam wieder zu spüren vermocht, meinen Gesichtsausdruck im Spiegel an meiner Stimmung gemessen, mich erschrocken abgewandt, habe mich ordentlicher angezogen, mein Haar gepflegt und meine Schuhe geputzt. Im Übermaß zu rauchen habe ich aufgehört und regelmäßig zu essen angefangen - aufmerksam unterstützt durch eine langjährige gemeinsame Freundin von Willie und mir, die mich vorübergehend bei sich und ihrer Familie aufgenommen hat. Meine Wohnung hatte ich ja durch Willies Zutun verloren - aber dazu später.
Im freien Fall, da ich plötzlich ohne die jahrelange Aufgabe leben musste, Willie zu unterstützen und zu retten, ruderte ich durch das bisschen Leben, das mir geblieben war und wunderte mich, in welchem Zustand ich es vorfand. War das noch ich? Und - wie war ich eigentlich? Wie sahen andere Leute mich? Was ich über mich selbst herausfand, hat mir kein bisschen gefallen.
»Schau dich nur an,« hat meine Mutter öfter getadelt, aber ich war viel zu müde, etwas zu erklären. Mein Bruder war zu diesem Zeitpunkt schon todkrank, Willie weit fort, und es war mir verboten, ihm auch nur zu schreiben. Ich war knochenhart geworden, ausgetrocknet im Geist, und mein Körper schien eine einzige vernarbende Wunde zu sein. Entsprechend sah mein Gesicht aus. Mein eigener wilder Blick erschreckte mich in spiegelnden Schaufenstern. Meine liebe Gastgeberin verkuppelte mich mit einem neuen Mann - einem Polizisten, und ich ließ es dankbar geschehen, ausgehungert nach Menschen, die nicht gefährlich waren. Der Polizist schien die Verkörperung des Guten im Gegensatz zu Willie zu sein, auf der Seite derer, die Drogen bekämpfen, integer und ernsthaft, ehrlich und stark. Ich glaubte aufatmen zu dürfen und nahm mir jede Menge betäubenden Sex von diesem Mann, wollte so die Gedanken an meinen dahinsiechenden Bruder und an Willie auslöschen. Es gelang nicht, brachte mir nur, viel später, schmerzhaft schlechtes Gewissen ein. dass ich nun die andere Seite des Mondes erlebte, tat mir aber nur vorübergehend wohl. Der Undercover-Polizist in Sachen Drogenfahndung erwies sich als boshafter, verantwortungsloser Abenteurer.
Meinen Bruder anzurufen wagte ich in diesem Monaten kaum, wissend, dass es täglich schlimmer stand um ihm. Aus Angst, seiner fremd gewordenen Stimme entnehmen zu müssen, dass er bald sterben werde, verdrängte ich den peinigenden Wunsch, ihm nahe sein zu wollen. Der Gedanke an Tod existierte zwar, doch er konnte unmöglich meinen eigenen Bruder betreffen. Gerade erst war ich dabei, aus dem Nebel der Katastrophe um Willie aufzutauchen, es durfte einfach nicht sein, dass etwas noch Schlimmeres bevorstand. Besuchte ich meine Familie in Kärnten, tat ich so, als gäbe es die Todesgefahr durch seine Krankheit nicht. Tag und Nacht dachte ich an meinen Bruder, aber das wird er nie erfahren. Und als ich es doch nicht mehr ertrug, tatenlos hoffen zu müssen, reiste ich in die Schweiz, um besondere Medikamente der Naturheilkunde zu besorgen, die es in Österreich nicht gab, und von denen wunderbare Heilwirkungen bekannt waren. Mein Bruder hat sie nie eingenommen. Meine Mutter ließ er wissen, er würde sie deshalb nicht versuchen, damit ich, seine »große« Schwester, nicht recht haben sollte. Hätte es das katastrophale Verhältnis meiner Eltern zueinander nicht gegeben und wären wir Geschwister nicht darinnen herumgestoßen und gegeneinander aufgehetzt worden, mein Bruder hätte vielleicht nicht den Zwang empfunden, der früher so schrecklich rechthaberischen Schwester trotzen zu wollen. Unsere Kindheit und die Ärzte haben ihn kaputtgemacht. Zunächst hat ein Orthopäde monatelang seine Sekundärtumore des Nierenkarzinoms an den Rippen für durch einen Rippenbruch eingeklemmte Muskeln erklärt. Dann hat man ihn zugleich mit Interferon, Chemotherapie und Strahlen behandelt, man hat ihm die eine, verkrebste Niere abgeklemmt, sodass er vor Schmerz am Verzweifeln war und ihn mit willenlos machenden Mitteln vollgestopft. Ich habe eine besondere Form der Meditation erlernt, um sie meinem Bruder vermitteln zu können, weil ich gehört und bestätigt bekommen hatte, dass sie die Selbstheilkräfte des Körpers enorm aktivieren. Mein Bruder hat sie nicht anwenden können, denn dazu bedarf es einen klaren Geistes, und mein Bruder lebte nur noch von Schmerzmitteln. Ich selber hätte diese Zeit jedoch ohne zu meditieren nicht durchgestanden. Die Ärzte sagten kein einziges Mal, mein Bruder solle alternative Methoden versuchen, da die Schulmedizin nichts mehr für ihn tun konnte, obwohl sie erkennen hätten müssen, dass mein Bruder, Rationalist und extrem loyal, von dieser Art der »Entlassung« aus der trügerischen Hoffnung abhängig war, um an etwas anderes glauben zu können. Sie haben ihm keinerlei psychologischen Beistand geleistet, ihn gnadenlos als Versuchskaninchen benutzt. Irgendwann werde ich mich dafür rächen.
Ich ließ meinen Bruder meine Qualen nicht wissen, und er weihte mich kaum in die seinen ein, und gegenseitig fragten wir einander nichts, als könnten wir totschweigen, was einfach nicht sein durfte ...
Es gab und gibt Tage, da konnte ich in jeder Minute zu weinen anfangen, machtlos, wie einer der gleichmütigen Spastiker, die zucken und dabei versonnen in den Regen hinausschauen. Der Jargon der Straße scheppert heute noch in meinen Ohren, wenn ich die warmen Räume meiner trügerisch sicheren Höhle verlasse. Unversehens zurückversetzt fühle ich mich oft in meine Gefühle von damals. Es bedarf keinen äußeren Anlasses. Krebshilfesendungen, Drogenreports, Arztserien oder romantische Musik sind für mein Seelenheil aber tabu. Zu meditieren wage ich heute erst wieder zögerlich, denn währenddessen fördert die natürliche Intelligenz meines Körpers unerbittlich in meinem Geist und in Form körperlicher Symptome zutage, was in meinem Inneren gärt. Natürlich ist die Erleichterung nach den schlimmen Visionen der Meditation wunderbar, aber das Wissen um das Wiedersehen mit tief Verdrängtem wiegt zunächst ungleich schwerer in meinem Kopf und macht Angst. Ich habe wirklich Angst vor dem, was mein Geist in seinen Tiefen immer noch bewahrt. Denn ich weiß mich gefährlich. Ich könnte eines Tages fürchterlich ausrasten, ahne ich oder mich vollends aufgeben. Wenn ich meine Mutter Alkohol trinken sehe, muss ich zum Beispiel vor Grauen und Furcht vor der Wiederholung des Schrecklichen fliehen. Wenn jemand mir verzweifelt von der schlimmen Erkrankung eines Verwandten erzählt, kann ich kein Mitleid in mir entdecken. Und was den Anblick Drogenkranker betrifft, habe ich gelernt zu sagen »... ist mir egal.«
Die Drogenkinder in der Realität einer Großstadt wie Wien, auf meinen Reisen oder in Filmen verhöhnen meinen vorgegebenen Gleichmut. Man kann der Szene nicht entgehen, hat man sie einmal gerochen, heißt es. Es ist wahr. Und es betrifft nicht nur ehemals Süchtige. Ich meide heute bestimmte Bahnstationen, wo, wie ich weiß, schrecklich kaputte Gestalten herumstehen. Ich meide sie, um nicht in die Mitte derer zu geraten, die »drauf« sind, wie Willie es war. Sie sollen mich nicht anrühren. Ich mag nicht auch noch ihretwegen zurückdenken. Was habe ich sie oft beneidet! Gerade das ist vielleicht schwer zu verstehen. Ich, die ich jahrelang einen verzweifelten Kampf gegen Drogensucht geführt habe, gerade ich fühle mich wie magisch von solchen Leuten angezogen? Warum? Es ist, als schlösse man Freundschaft mit seinem Kidnapper, weil man ihm nahegekommen ist während der Gefangenschaft. Lange habe ich jene Orte aufgesucht, wo es am schlimmsten zugeht. Obendrein habe ich für eine Reportage Leute interviewt, die mit Drogentherapie und Süchtigen zu tun haben, Ärzte, Sozialarbeiter, Therapeuten, Betreuer, Streetworker, Polizisten und Politiker. Eine Mitarbeiterin des »Grünen Kreises«, einer Institution für Langzeittherapie an Suchtkranken, hat meine wahre Motivation dafür auf den Punkt gebracht:
»Sie machen es für sich selber, ...« hat sie schlankweg behauptet, »... Sie suchen Antworten, Nähe zu Ihrem Freund. Sie werden die Geschichte nie veröffentlichen. Und überhaupt, was glauben Sie, wer wird die Wahrheit publizieren wollen? Sie kreiden die Öffentlichkeit an. Das gefällt niemandem. Die Zustände sind verheerend, das weiß man, und das vertuscht man.« Sie hat recht behalten. Ich hab 's für mich getan, für mich, für mich, für mich, es war nicht aufzuhalten, endlich etwas für mich zu tun. Ich habe mich tief und tiefer in den Sumpf gewühlt, obwohl Willie weg war. Vielleicht stimmt auch, was die Frau gesagte hat, gerade weil Willie weg war ... Allerdings hat es wenig genutzt, aber was hätte ich sonst tun sollen? Jahrelang hat etwas mein Leben geprägt, und von einem Tag auf den anderen hätte ich umdenken sollen? Wie das? Als Willie zur Therapie fortgegangen ist, hat er mir mein eigenes Rauschgift weggenommen: sich selbst.
Umhergestrichen bin ich, ziellos und sinnlos. Polizeilich observieren habe ich mich sogar trotzig lassen, im berüchtigten Resselpark, im Prater oder an U-Bahnstationen, wo gedealt wird. Angesprochen hat mich nie jemand. Die Süchtigen haben mich nicht zu sich genommen und die vermeintlich Normalen auch nicht, die Polizei hat mich in Ruhe gelassen. Im Niemandsland dahinzurudern ist aber kein bisschen tröstlich, wenn ringsumher dicke, zähe Wattewände sich türmen.
Ich habe später den Rohentwurf der Drogenstory an den »Grünen Kreis« geschickt. Was man dort damit gemacht hat, ist mir einerlei.
*
„... bitte, sagen Sie mir wenigstens, wo kann ich anrufen? Was kann ich tun?" So habe ich ehemals in einen Telefonhörer gefleht, während Willie neben mir in einer Lache von Erbrochenem gelegen ist.
„Was fragen 'S da mich?" hat der Polizist gemurmelt. Aber es müsse doch etwas geben, flehte ich, ... mein Freund nähme Drogen, Tabletten, Hustensaft, Methadon und sonstwas, ... hätte gerade schwere Entzugserscheinungen, aber ich könnte ihm doch nicht helfen! Ob er an der Nadel hänge? Nein! .... ja! ... im Moment nicht, aber ... ja, doch, er ist ein Junkie!
„... und ich kann einfach nicht mehr! Bin allein mit ihm, ich schaffe das nicht ..." Es müsse doch eine Möglichkeit geben, ein Bett im Krankenhaus für einen Suchtkranken zu bekommen, der kurz vor dem endgültigen Absturz steht und der in lichten Momenten um Hilfe bittet! In einer stationären Entzugseinrichtung ... im Psychiatrischen Zentrum Baumgartner Höhe, zum Beispiel. Im Wiener Allgemeinen Krankenhaus, diesem Monsterbau, existierten ganze vier Betten für Wiens hunderte, vielleicht tausende Süchtige für stationären Entzug, und die seien - nein, sowas! - belegt, erfuhr ich damals. Niemand wird das fassen können. Aber es ist wahr. Allein mit einem störrischen Süchtigen, der nicht mehr sich selbst überlassen werden konnte, der so schwach war, dass er sich gerade noch wackelig auf den Beinen hielt, wenn er nicht mit Grießbrei oder Drogen vollgepumpt war, glaubte ich an Wiens Bürokratie zu verzweifeln. Waren wir nicht ein Sozialstaat? Wo war die Hilfe, die Politiker den sozial Schwachen, den in Not Geratenen in Wahlkampfzeiten versprachen?
Willie war ständig in Gefahr, überfahren zu werden, wusste nicht mehr, was er sagte und wo er sich befand, kippte fast aus Fenstern, geriet in Streit mit Punks und Skinheads auf der Straße, pöbelte wohlmeinend kleine Kinder an und merkte es nicht einmal. Übrigens zeigten diese Kinder sich immer angetan von dem seltsam schwerfälligen, stets grinsenden, alles Mögliche fragenden Onkel, der sie so lieb fand. Ihre Mütter, allerdings, zerrten die Sprössling so schnell es ging außer Willies Reichweite und bedachten mich mit vorwurfsvollen oder mitleidigen Blicken. War ich mit ihm unterwegs, musste ich ihn ständig davon abhalten, wildfremde Leute anzulallen, Gesänge anzustimmen, sich einfach an allen Orten und Stellen hinzulegen oder seine Habseligkeiten wie Tabak, Brieftasche, Feuerzeug oder Schlüssel auszustreuen. Und das schlimmste: Willie konnte nicht mehr einschätzen, welche Drogen oder Tabletten er in welcher Menge zu sich nahm, und ich hatte keine Ahnung von Dosierung, von den Tabletten, Säften und Pulvern überhaupt. Er würde sich vergiften, den goldenen Schuss geben, an Kreislaufversagen sterben ...
Natürlich log er mir das Blaue vom Himmel vor, was er eben nicht eingenommen hatte. Der Typ, bei dem er wohnte, unterstützte ihn auch noch und log mit, wenn ich telefonisch anfragte, ob alles in Ordnung sei. Als ich, hysterisch vor Sorge und nicht mehr fähig, zu arbeiten oder auch nur zu lächeln, eines Nachmittags Willie Mitbewohner telefonisch sagte, ich könnte einfach nicht mehr und mir von ihm beteuern ließ, dass Willie keine Drogen nahm, weil er sich doch in ambulanter Entzugsbehandlung befand, dafür Tabletten einnahm und täglich in der Ambulanz vorsprechen musste, um ebendiese Tabletten zu erhalten, log der Mitbewohner kaltschnäuzig, ... ja, ja, alles okay, während Willie grinsend neben ihm saß und sich einen Schuss setzte. Willie selbst hat mir das später erzählt. Und nachmittags, als der Mitbewohner nicht zu Hause gewesen ist und ich, toll vor Sorge, Willie abholen wollte, konnte ich nicht in die Wohnung, weil Willie besinnungslos darin herumlag und mich nicht hörte.
Das Leben bestand für uns nur noch aus Todesgefahr.
... nein. Falsch. Für mich bestand es aus Todesgefahr. Willie bekam meine Sorgen ja gar nicht mit.
Er konnte manchmal kein Essen mehr behalten, kotzte mitten in öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir wurden beschimpft und verhöhnt, ich, als Begleiterin eines Junkies, galt natürlich auch als Junkie. Ich lernte, die Umrisse von Polizeiautos und Polizisten schon von weitem wahrzunehmen und ihnen auszuweichen, ebenso wie ich anfing Junkies an ihrem Verhalten, ihrer Sprechweise und Körperhaltung von Alkoholikern und simpel Verrückten zu unterscheiden. Niemals bot uns jemand Hilfe an, wenn ich Willie durch die Straßen zur Drogenambulanz schleppte. Schlimmer als das Schleppen des neunzig-Kilo-Mannes war es aber, wenn er - gut »drauf« - grinsend behauptete, alles sei in Ordnung, und ich sollte ihm nicht »auf den Arsch gehen«. Er wollte mich abschütteln wie eine Fliege, wurde gemein und ausfällig und brachte mich durch sein absolutes Verleugnen jeglicher Sinnhaftigkeit meines Tuns zum Weinen. Wie gerne hätte ich ihn losgelassen, wäre einfach auf und davongelaufen, gefahren, geflogen!
Statt dessen schluckte ich seine Verachtung, redete auf ihn ein, versprach ihm nun meinerseits das Blaue vom Himmel, ließ mir immer wieder neue Ablenkungsmanöver einfallen, um ihn daran zu hindern, unser Ziel, von seiner Sucht loszukommen, aufzugeben. Einen Drogensüchtigen, der von seinem Stoff beseelt wandelt, unter Kontrolle zu halten oder ihn gar in Drogenambulanzen bringen zu müssen, ist ein qualvolles Unterfangen ... nicht für den Süchtigen. Der anhaltende Kampf hat mich zermürbt.
Warum, hat eine Freundin gejammert, ... machst du dich fertig, seinetwegen? Du kannst ja schon nicht mehr ...
Aber geholfen hat sie mir nicht.
Auch wenn Willie mir allerunschuldigst seine Handflächen präsentiert hat, mich groß angeschaut und steif und fest behauptet hat, er hätte es ohnehin schon geschafft, es gehe ihm doch super, und morgen würde er sich einen Job suchen, wusste ich doch, Stunden später würde aus dem große Sprüche Klopfenden wieder ein hilfloses Bündel Zittern werden. Und sein einziges Verlangen würde sein: irgendetwas, das Hirn und Körper wieder betäubt, wenn das Bewusstsein zu sich kommt und er Körper sich in einen einzigen Schmerz verwandelt, Alltag und Zukunft nichts als drohend sind. Ich habe zu wissen gelernt, wie er sich fühlt. Aber er hat nie eine Vorstellung davon gehabt, wie es mir ergeht.
Willie sackte zuweilen in gnädige Verwirrtheit ab. War er bei sich, dachte er an Stoff. Hatte er welchen, ging es ihm vermeintlich gut, und er lachte mich aus.
... ich sollte den Kerl doch vorbeibringen, schlug der Polizist am Telefon gemächlich vor, und es klang, als knabberte er Kekse, während er mit mir redete. Ich roch meinen eigenen Schweiß, mir schwindelte, und ich musste mich zu Willie auf den Boden setzen. Ein Glück, fast, dass ich keinen fixen Job hatte, arbeiten hätte ich sowieso nicht mehr können ...
... jawohl, den Giftler, ganz genau, den sollte ich vorbeibringen, meinte der Polizist, ... auf den Polizeiposten, natürlich, und wenn es nicht mehr ginge, ginge es eben nicht mehr ...
»Zu ... zu den Bullen?« Willie kicherte.
... aber warum zur Polizei, stammelte ich, ich wollte doch nur wissen, wo man ihm helfen konnte! Nicht ihn ausliefern! Warum konnte man mir nicht einfach Rat geben ... Willie hustete und erbrach grüngelbe Brühe.
„Na, irgendwoher wird er sich's ja beschafft haben, das Zeug, Fräulein. Legal ist 's nicht, wie Sie wissen, Fräulein! Wie heißen Sie denn?" Der Polizist schien alle Zeit der Welt zu haben in seiner Wachstube. Ich habe ihn angeschrien, glaube ich, Spucke in den Telefonhörer sprühend, ... er stirbt vielleicht, habe ich geschrien, und was er mit meinem Namen wollte, ich weiß ja nicht, was er genommen hat ... das mit dem ambulanten Entzug sei doch nur Scheiße! dass er in ein Krankenhaus müsse, hab' ich getobt. Sofort!
»Ihren Namen, Adresse,« hat der Polizist seelenruhig gefordert ... durch den Telefonhörer rasen und ihn erwürgen ... erstand ein panikhafter, wilder Gedanke ... Dieses süffisante »Fräulein, was wollen Sie eigentlich?" wird auf ewig in meinem Gedächtnis gären. Es war ätzend, als hätte man mir Gift eingeflößt. Was ich wollte, fragte er allen Ernstes? Ob es denn keinen Notdienst gäbe? Was musste man denn tun, um ein Krankenhausbett zu bekommen? Ob denn nie sonst Leute mit solchen Notfällen anriefen? Willie keuchte mich an, ob ich, ... verflucht, Baby! ... etwa mit den Bullen redete? Er versuchte, sich aufzurichten.
Ja, es gäbe eine Möglichkeit sofort einen stationären Entzugsplatz zu bekommen, raunte der Polizist, einen erstklassigen Platz sogar. Bloß Name und Adresse des Dealers hätte ich zu liefern. Des Dealers! Am besten gleich mehrerer. Sonst nichts. Ich sollte es mir überlegen, murmelte der Herr Beamte, und im Hintergrund habe ich jemanden lachen hören. Wenn mir der Herr so wichtig sei ...
Ich habe den Rat des Beamten nie befolgt. Überhaupt hatte ich ja keine Ahnung, wer Willies Dealer war(en). Warum hätte er es mir auf die Nase binden sollen?
Welcher Junkie, der von seinem Entzug nicht überzeugt ist, lässt seinen einzigen Halt fahren - den Dealer?
In welchen Mustern denken eigentlich Polizisten?
*
Weshalb ich so blindlings in Willies Welt eingestiegen bin? Er hat es durchaus zuweilen mit der meinen versucht, aber sein Umfeld ist immer stärker gewesen, als meines, hat sich an ihm festgesaugt.
Mit aller Verliebtheit, zu der ich fähig gewesen bin, habe ich alles darangesetzt, Willie kennenzulernen. Er hat mich fasziniert, und ich kann nicht erklären, warum und wodurch. Den Liebesbrief hat er nie erhalten, weil er irrtümlich bei einem namensgleichen Briefträger gelandet ist. Sogar angerufen habe ich Willie, ermutigt von meiner Freundin, die mein Gejammer nicht mehr mitanhören wollte. Mein erstes Gespräch mit Willie war - nett. Sehr nett. Unglaublich nett. Natürlich habe ich mich nicht zu erkennen gegeben. Ich weiß auch nicht mehr, was ich gesagt habe, nur, dass seine verhaltene, dunkle, langsame Sprechweise am Telefon mich geradezu betört hat. Und wir haben gegenseitig unsere Stimmen belauert, als erwarteten wir, dass der andere sich jeden Moment als Gefahr für Leib und Seele zu erkennen geben würde. Neugierig waren wir und schüchtern. Beide.
Nach diesem ersten Gespräch bin ich lange in der abendlich dunklen Küche der Wohnung meiner Mutter gesessen und habe seinen Worten nachgelauscht. Meine Freundin hat mich allein gelassen mit meinem Grübeln, und ich habe nicht gewusst, was mich so betroffen macht. Die Ahnung des Kommenden? Verliebtheit? Mitleid? Hoffnung? Ich glaube, ich habe damals schlicht begriffen, dass es zu spät war, diese Beziehung aufzuhalten.
Damals ist Willie aber ohnehin schon auf mich aufmerksam geworden, denn in seinem Freundeskreis hat es zwei Mädchen gegeben, die ganz gut mit meinem Bruder bekannt gewesen sind, und die kannten natürlich mich. Also ist schnell das Gerücht aufgekommen, dass ich die Anruferin gewesen sein könnte, vor allem, weil ich Willie ja plötzlich ständig über den Weg gelaufen bin.
Irgendwann geschah es, dass meine Freundin und ich Willie in einem Lokal so lange heimlich vom Nebentisch aus beobachteten, bis er sich zu uns an den Tisch setzte. dass ein Bursche bei uns war, den Willie kannte, ermöglichte es ihm. Die Szene, da Willie von seinem Platz an dem anderen Tisch aufstand, während ich verfiel, weil ich glaubte, er würde das Lokal nun verlassen und er statt dessen groß, schwer, gelassen und sein Haar zurückwerfend an unseren Tisch trat und sich einfach mir gegenüber hinsetzte, wird mir auf immer unvergesslich bleiben. Es ist der Augenblick gewesen, da ich geahnt habe, dass ich erreichen könnte, was ich ersehnte. Und Willie hat wohl gewittert, dass von mir etwas zu holen sein würde ...
Er hat später gesagt, meine weißen Stiefel und weil mir meine Aufregung und Unschuld von weitem anzusehen gewesen ist, hätten ihn gerührt. Und er hätte ich schon länger beobachtet, seit man ihm gesagt hätte, ich führe sagenhaft auf ihn ab. Mit ihm zu sprechen war allerdings schwierig. Er sagte nicht viel, und stellten wir ihm konkrete Fragen, gab er sie einfach zurück.
»Wo wohnst du?«
»Überall und nirgends, - und du?«
»Warst du wirklich in Indien?«
»Wer weiß ...«
»Wie heißt du eigentlich?«
»Stefan. Oder Thomas. Oder Ferdinand ...«
»Nein, wie heißt du wirklich?«
»Warum willst du das wissen?«
Meine Freundin stieß mich unter dem Tisch an, sie fragte Willie, ob er keine ganz normalen Fragen ganz normal beantworten könnte. Er antwortete ihr einfach nicht, trank sein Bier und schaute uns nur dunkel an. Ich war ohnehin zu keiner großartigen Konversation fähig, weil ich tiefrot die Tischplatte anstarrte. Einen glühend umschwärmten Menschen nahe zu fühlen ist, wie viel zu heiß zu duschen. Und mein Hirn kochte, mein Bauch krampfte, meine Finger schwitzten.
Das Unglaubliche geschah: Auf Initiative des anderen Burschen, der meine Freundin zu verführen gedachte, verabredeten wir alle vier uns für denselben Abend in einer jener Kneipen, die zu betreten mir niemals eingefallen wäre. Ja, hab' ich gelogen, selbstverständlich kannte ich das Lokal, oft wäre ich schon dort gewesen.
»Komisch, bist mir gar nicht aufgefallen,« murmelte Willie, schaute mich mit diesen unvergleichlichen grüngrauen, tiefliegenden Augen streng an und begann doch zu grinsen, »... bis jetzt ...« Die Art, wie er sich zurücklehnte und rauchte, sein Glas aufnahm, mich dabei nicht aus den Augen ließ und sich durch die Haare fuhr, hatte etwas Mondänes, unglaublich Überlegenes. Ich verliebte mich an Ort und Stelle noch viel mehr, so sehr, dass mir übel wurde ...
... diesen Mann wollte ich haben, um jeden Preis haben ...
... es handelte sich um eine der übelst beleumundeten Spelunken der Gegend. Meine Freundin stimmte eifrig zu, ... jaja, klar würden wir hinkommen, kein Problem. Willie grinste nur dieses unbestimmte, leicht spöttische und doch irgendwie ermutigende Lächeln, das ich an ihm hasse und sehr mag. Es macht ihn fremd und reizvoll, bedeutet alles und nichts. Mir fuhr es durch Mark und Bein. Er vergaß eine Packung Disketten für seinen Computer an unserem Tisch, und so hatte ich einen Vorwand, die Verabredung tatsächlich einzuhalten.
Willie ist unglaublich erfinderisch, wenn er ein Ziel vor Augen hat. Dafür bewundere ich ihn, wenn diese seine Fähigkeit mir auch schlimme Erfahrungen eingebracht hat.
»Ich bin auf Heroin gewesen,« erklärte er mir in derselben Nacht, als wir am Wörther See spazierengingen. Es war, als erzählte ein abgeklärter Hahn einem Küken davon, dass er täglich mit dem Adler beim Mittagstisch säße. Ohne zuvor viel mit mir geplaudert zu haben, hatte er mich aus dem Kreis seiner und meiner im nächtlichen Tanz- und Rotweinrausch überdreht herumirrenden Bekannten gefischt und mir seine Lederjacke umgehängt. Ich ging neben ihm durch die feuchte Nacht und genoss es, obwohl wie gelähmt vor Aufregung. Meine Zähne klapperten. Ich glaube, ich sagte etwas wie »Ach so,« und »Und wie ist das jetzt?«, und er antwortete, er sei jetzt clean. Und zwar deshalb, weil Drogen hier viel teurer seien als in Indien.
Ich weiß noch, dass ich lachte. Na, fein, dachte ich, das heißt, er würde gern, kann aber nicht ... Ich ahnte nicht, wie treffend mein Gedanke Willies zukünftige allgemeine Lebenslage definierte. Das Wort »clean« kannte ich aus Filmen. Willie sah umwerfend attraktiv aus im Mondschein. Und dieser stattliche Bursche mit der sanften Stimme sollte etwas Krankes, Verderbtes wie ein Rauschgiftsüchtiger sein? Unsinn! Zwar fröstelte ich, denn etwas Unheimliches schien mich gestreift zu haben, aber ich hatte kein bisschen Erfahrung mit Drogen, noch wusste ich genug darüber, um richtig zu erschrecken. Und Willie legte mir dem Arm um die Schultern, um die Lederjacke besser zu fixieren. Das reichte, um mich vollends um meine Besinnung zu bringen.
Bei unserem nächsten Treffen in der Spelunke, die ich ja angeblich ohnehin regelmäßig aufsuchte, sagte er, er wollte mit mir in den Wäldern spazierengehen. Und ich müsste absolut keine Angst haben vor ihm. Nichts als spazierengehen wollte er.
Warum er das mit der Angst so betonte, bohrte meine Freundin. Manchmal gab sie mir bereits sanft zu verstehen, es sei vielleicht doch besser, ich würde mich nicht mit diesem Willie einlassen ... Ich glaubte aber, Willie zu durchschauen. Er wusste genau, dass die meisten Mütter dieser Welt ihren Töchtern den Umgang mit jemandem wie ihm verboten haben würden. Gerade dieser Gedanke machte es für mich zum absoluten muss, mit Willie spazierenzugehen. Wenn ich etwas hasse, dann sind das Vorurteile, und das war schon damals so. Im Wald mit diesem geheimnisvollen Fremden ... Willie würde mich nicht vergewaltigen, das wusste ich ... und umbringen würde er mich wohl auch nicht ... allenfalls konnte es peinliches Schweigen zwischen uns geben - ... oh ja, und ob ich mit ihm spazierengehen wollte!
Es gab zwei, drei Mädchen die Willie hofierten. Worin seine Verbindung zu ihnen bestand, wusste ich noch nicht, nur, dass sie sich darum rissen, ihn spätnachts, wenn er volltrunken Leute anstänkerte, nach Hause zu bringen. Da ich selbst mit Tommis Auto herumfuhr, hegte ich die stille Hoffnung, ich würde selbst einmal die Glückliche sein dürfen. Mein schlechtes Gewissen Tommi gegenüber wog leicht gegen diese Aussicht auf wunderbares Zusammensein mit meinem Erwählten. Und Tommi fragte schließlich nie, was ich mit dem Wagen unternahm.
Die Mädchen umschwänzelten Willie, der, groß und ruhig, zuhörte, nickte, gestikulierte, Zigaretten anbot, ab und zu mit Kumpels draußen in der Nacht verschwand. Die ungewohnte Musik betäubte mich, andererseits verstärkte sie noch den Eindruck, den Willie auf mich machte: Stolz, schlau, ein wenig tollpatschig und liebenswert. Willies Art mit Menschen umzugehen, ist einzigartig. Wer immer mit ihm spricht glaubt, nichts sei Willie im Augenblick wichtiger, als eben dieses Gespräch. Willie vermittelt immer den Eindruck, als sei er ganz Ohr und vollkommen bei der Sache. Frauen fallen ihm - nahezu wortwörtlich - in den Schoß. Wie sehr eifersüchtig ich von Anfang an war, wenn er eine Frau freundschaftlich um die Schultern nahm, sie mit Getränken und charmanter Unterhaltung versorgte, auch, wenn es nichts weiter zu bedeuten hatte als bloß Höflichkeit, hat Willie bis heute nicht erfahren.
Willie ist ein Blender.
Niemals werde ich aber behaupten, er sei durch und durch ein schlechter Mensch. Ich weiß es nämlich besser.
*
Habe ich je mit der Möglichkeit kokettiert, einmal an Willies Stelle zu sein, was Drogen betrifft?
Wüsste ich sicher, dass er sich auch um mich bemühen würde, oder besser - dass irgendjemand sich um mein Überleben bemühen würde, könnte es sein, dass ich einem alten Reiz nachgebe. Die Wahrscheinlichkeit, dass es so sein wird, ist aber gleich Null. Allenfalls wenn ich nichts mehr zu verlieren hätte in diesem Leben würde ich alle Drogen er Welt ausprobieren wollen. Bis vor einem Jahr habe ich sogar einen Zettel mit der Adresse eines Dealers besessen. Ich Idiot, sagte ich eines Tages, wenn jemand den gefunden hätte! Aber - warum sollte jemand einen simplen Zettel wichtig finden? Ist die Gefahr, Willies wegen in Teufels Küche zu geraten, denn immer noch nicht vorbei?
Willie ist seit ein paar Wochen verschwunden.
*
Sooft ich nach Willies Entzug mit ihm wieder in der Stadt unterwegs gewesen bin, habe ich mich dabei ertappt, dass ich scharf beobachtet habe, in welche Richtung sein Blick geschweift ist. Leider entgeht mir heute keine Regung seines Gesichts mehr, nichts an seinem Verhalten kann ich übersehen. Als wir neulich kurzfristig wieder zusammengewohnt haben, sind mein Misstrauen und meine gereizte Reaktion auf den kleinsten vermeintlichen Fehler in Willies Verhalten Garanten dafür gewesen, dass unser Zusammenleben nicht funktionieren können würde. Ich bin nämlich dazu verflucht, alles in meinem Umkreis zu registrieren und Willie auf ewig zu misstrauen. Und das vielleicht sogar zu Recht.
Dass ich male, hilft mir ein bisschen, meinen Geist zu lüften. In bunten Farben male ich die schwärzesten Gedanken. Unerkannt bleiben sie zumeist von denen, die helle Farben mit heller Stimmung verwechseln. Ich genieße schmerzende Bandscheiben, steife Handgelenke und entzündete Fingerglieder. Ich komme nicht zur Ruhe, und gerade das erschafft immer neue Bilder in meinen Kopf.
*
Eines Nachts war es soweit. Ich hatte stundenlang in der Spelunke ausgeharrt, geneckt von den Burschen, argwöhnisch gemustert von den Mädchen, spaßeshalber herumgeschubst und begrapscht von den Dreistesten und tapfer an meinem Rotweinglas festhaltend. Eine meiner Freundinnen, die mich an diesem Abend begleitete und die plötzlich einen Narren gefressen hatte an der »Szene« der bösen Buben, blieb an meiner Seite, und ich glaube, sie amüsierte sich ganz gut mit Willies Bekannten. Jedenfalls sah ich sie auf dem Boden herumbalgen und auf Tischen tanzen. Übrigens hat keine meiner Freundinnen je tiefere Bekanntschaft mit Willies Freunden gemacht ...
Genau im richtigen Ausmaß beduselt, um nicht verkrampft zu sein, unterhielt ich mich mit irgendwem und ließ mir Anmache gefallen, unaufhörlich von Willies Blick umfangen. Genüsslich konnte ich so tun, als merkte ich es nicht. Grete, die kleine Dicke, ein Ausbund an Hässlichkeit, obendrein höchst unsympathisch und offensichtlich schwer in Willie verliebt, hing zu dieser späten Stunde auch noch herum und erwartete offenbar, ihren Angebeteten wieder einmal heimchauffieren zu dürfen. Sie ließ den Autoschüssel klimpern. Ihre Freundin Mary dagegen schien mir ein hexengleiches Wesen zu sein, rothaarig, klein, hübsch, mit stechenden Blicken, die Willie offenbar gefielen. Wenn Willie die kleine Rundliche umarmte und ihr mit seinem Gesicht sehr nahe kam, war mir zum Weinen zumute, und ich unterhielt mich umso fröhlicher mit den anderen. Die düstere Musik fand ich mittlerweile richtig gut, hatte Smokie längst vergessen, und ich rauchte sogar Zigaretten. Die kleinen Gläser Rotwein summierten sich, und mein Grinsen krampfte in den Mundwinkeln. Plötzlich baute ein lederduftender Berg Mann sich neben mir auf. Seinen alkoholdunstiger Atem begegnete mir schwül, und Willies Stimme raunte unter der Mähne, die ihm stets ins Gesicht fiel, ob wir nun gehen könnten.
Wir?
Wir konnten!
Meine Freundin machte mir das Sieges-Zeichen, aber mir war alles andere als siegreich zumute. Ich war ganz einfach schockiert. Konnte es wirklich sein, dass mein Angebeteter für mich empfand wie ich für ihn?
Pulvriger, eisiger Frühlingsschnee war gefallen, und Willies bester Freund Balduin kam uns aus der Kneipe nachgewankt und grölte, aha, Willie würde mich heute also wohl endlich packen! Ich tat so, als hätte ich nichts gehört, verbarg mein leises Erschrecken. Willie winkte lässig ab, nannte seinen Freund einen blöden, versoffenen Hund, schaute mich ernst an und stieg einfach in Tommis Wagen. Ohne sorgenvoll nachzudenken wegen der Straßenverhältnisse kurvte ich auf Sommerreifen bergauf durch den Neuschnee, und ich vergaß auch, mit Willie zu plaudern. Die Tatsache seiner Nähe raubte mir jeden anderen Gedanken. Nur dass es Tommis Auto war, in dem ich nun mit meinem Schwarm saß, war mir plötzlich nicht mehr egal. Willie schien mein Schweigen nicht zu stören, denn er sprach auch kein Wort mit mir.
Vor seiner Haustür erklärte er, ich müsste nun mitkommen. Nachzudenken, was das zu bedeuten hätte, erübrigte sich, denn etwas in mir folgte ihm wie ein Hündchen. Und der Rest entsprach. Wie betrunken Willie war, konnte ich nicht ermessen, bloß, dass ich immer noch genug Dusel im Kopf fühlte, um bereitwillig Dummheiten zu machen.
Später lag ich an Willie geschmiegt auf dem Diwan im Wohnzimmer der Wohnung seiner Mutter, und ich schaute, nein, starrte sein morgengraues Gesicht von der Seite her an. War es zu glauben, dass ich tatsächlich neben ihm lag?
Zwischen uns hatte sich nichts abgespielt, wir hatten nicht einmal geschmust. Einfach nur da lagen wir, er auf dem Rücken, meine Wange auf seinen kühlen Haarsträhnen und an seinem Hals, und er war so groß und so warm und so fremd und roch so wunderbar nach Schweiß, Rauch, Rasierwasser und fettigen Haaren. Obwohl ich mich kaum sattsehen konnte an ihm, musste ich ständig daran denken, dass seine Mutter demnächst aus dem Nebenraum kommen und zur Arbeit gehen würde. Also befreite ich mich in mühevoller Kleinarbeit aus der Umarmung des Schlafenden, beglückt, weil ich nun schon viel mehr darüber wusste, wie er lebte. Sobald ich glaubte, mich nun fortstehlen zu können, fing Willie mich wieder ein, zog mich an sich und behauptete, mich sicher nicht gehen zu lassen. Oh doch, sagte ich, er widersprach, ich beharrte, alles im Flüstern, und er schlurfte mit mir zur Tür und fand, ich könnte ihn ruhig bald anrufen. Nein, ... meine Knie zitterten, weil ich drauf und dran war ihn vielleicht auf Nimmerwiedersehen zu verlassen, ... ich bin der Meinung, ich hab' genug getan. Nun bist du an der Reihe.
Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass ich dass sagte.
Später fand ich heraus, dass er mit der hässlichen Grete zuweilen schlief und dass er sich überhaupt sehr, sehr oft in der Wohnung aufhielt, die sie mit Mary teilte. Erst Jahre später erklärte er mir auch, warum. Vorerst glaubte ich nur, sterben zu müssen vor Eifersucht, weil bekannt war, dass Grete und er viel Zeit miteinander verbrachten. Meine Freundin meinte, ich müsste eben um ihm kämpfen, obwohl sie sich nicht vorstellen könnte, weshalb er wohl eine wie Grete einer wie mir vorziehen sollte. Aber Grete hätte aus irgendeinem Grund das Monopol darauf, ihm in den Arsch zu treten, wenn es sein musste und dafür von ihm beglückt zu werden.
Willie rief mich an, schickte mir verstörende, selbstverfasste Gedichte, und wir gingen miteinander spazieren, jawohl, im Wald, so wie er es gewollt hatte. Meinetwegen fing er an, überhaupt wieder an die frische Luft zu gehen, tagsüber, nämlich. Als ich dahinterkam, rührte es mich fast zum Weinen.
Drei Jahre hatte Willie in der Wohnung seiner Mutter zugebracht, im verdunkelten Raum unter Alkohol und Tabletten dahindümpelnd. Zu arbeiten war für ihn nicht in Frage gekommen. Ich begriff zwar nicht, warum das so gewesen war, aber ich wollte ihn nicht mit Fragen nerven. Seine Mutter hat ihn jahrelang versorgt. Später erfuhr ich, sie hat ihm täglich Alkohol und Tabletten gebracht, um ihn ruhigzuhalten und damit er überwachbar bleiben sollte. Niemals hat sie versucht, ihm dabei zu helfen, dass sein Leben sich normalisieren konnte. Ich glaube, sie hat einfach nicht gewusst, wie. Man könnte auch sagen: Sie hat sich keine Mühe gegeben, einen Weg zu finden.
Willies Mutter will bis heute nicht wahrhaben, weshalb Willie überhaupt jemals an Rauschgift geraten ist ... Es waren die Familienverhältnisse, in denen er aufgewachsen ist, da gibt es keinen Zweifel. Sie hat aber doch miterlebt, wie Willie unter dem Diktat seines Vaters gelitten hat, wie unglücklich und von hilflosem Stolz beseelt der junge Bursche gewesen ist, wie verkannt in seinen wahren Neigungen, sie hat als Mutter doch wissen müssen, wie sensibel und sogar labil Willie unter der zähen, kühlen Schale ist! Sie hat sich nie gegen ihren Mann zu stellen gewagt, auch wenn sie geweint hat, wenn der Vater den Sohn misshandelt hat. Vielleicht ist ihr einfach alles egal gewesen.
Und Willies Vater? Wie soll schon ein ehemaliger Fremdenlegionär, Spieler, komplexbehafteter, geltungssüchtiger Neureicher und Macho über einen Sohn wie Willie denken? Willies Vater wird niemals eigenes Versagen eingestehen. Für ihn gibt es nur einen Bedauernswerten und an jeglicher Familienkrise Unschuldigen: ihn selbst. Willies zwei jüngere Brüder hassen und verachten ihren Vater. Sie sind ihm aber niemals so sehr ausgeliefert gewesen wie Willie, der Erstgeborene. Willies jüngere Schwester hat jahrelang Spionin für den Vater gespielt, als dieser längst eine neue Familie gegründet und angefangen hatte, vorzugeben, die alte interessierte ihn nicht mehr. Gegen Bezahlung hat Willies Schwester dem Vater Nachrichten hinterbracht ...
Niemand der Familie hat sich je darum gekümmert, was mit Willie geschehen ist, sobald er nach seiner Drogensucht und all den Jahren zu Hause mit mir nach Wien gezogen ist - ohne einen Groschen Geld, gerade wieder fähig, den Menschen in die Augen zu schauen. Und schon gar nicht hat irgendjemand zu erfahren getrachtet, was mit mir geschehen ist ...
Die Ansicht seiner Mutter über das Süchtigsein war und ist eine sehr naive. Sie hat einen Sohn, der jahrelang Drogen genommen hat, und sie weiß heute noch nichts damit anzufangen. Ich finde es einfach schrecklich, dass jemand das Spazierengehen im Wald erst wieder lernen muss. Seine Mutter würde staunen, wüsste sie von den Nachmittagen, da Willie keuchend und stolpernd die Natur wiedererlebt hat, da er sich so elendiglich schwach gefühlt hat, dass ihm die Tränen gekommen ist, da er nichts dringender haben wollte als Alkohol, Zigaretten und die Dunkelheit in seinem Bett und sich das doch versagt hat. Als ich ihn zum erstenmal bei Tageslicht gesehen habe, bin ich bis ins Mark erschrocken. Seine Haut ist grünlich weiß gewesen, abgesehen von den violetten Ringen unter den Augen, und seine Wangen sind eingefallen gewesen, die Lippen schmal und nahezu blutleer ... Damals ist er fünfundzwanzig gewesen.
Wir sind sehr, sehr langsam durch die Wälder und Wiesen gewandert, und wir haben viel geredet, darüber beispielsweise, dass er in den Jahren, die er zu Hause verbracht hat, zu einem recht guten Programmierer geworden ist - autodidaktisch mit jeder Menge Talent. Er hat angefangen, selbst Computerspiele und allerlei Nutzprogramme zu entwickeln. Nie hat ihm jemand gesagt, dass es bewundernswert ist, dass er seinen Geist trotz aller Misere außerordentlich gefordert und so trainiert hat. Sein Körper ist allerdings in einem jämmerlichen Zustand gewesen. Wäre Willie nicht von der Natur mit einem stattlichen Gerüst bedacht worden, wäre sein Zustand wohl noch übler gewesen. Und der Zustand seiner Seele hat den seines Körpers an Elend noch übertroffen.
Ein alter Freund, Balduin, hat ihm finanziell oft ausgeholfen, als Willie zu Hause dahinvegetiert ist und ihn zu Ausflügen und zum Ausgehen abgeholt. Die Zeiten, da Willie der großer Checker mit dem vielen Geld gewesen war, sind allerdings unwiderruflich ausgelöscht gewesen und damit auch seine vielen Freundesbeziehungen. Balduin selbst ist stets der Überzeugung näher gewesen, ohne Drogen gäbe es kein richtiges Leben als jener, dass Drogen einen Menschen zerstören können. Er fand nie die richtigen Worte, setzte nie die geeigneten Aktionen, Willie auf die Beine zu helfen. Allerdings lebte Balduin in einem gutbürgerlichen Elternhaus mit autoritärem, aber immerhin nicht krankhaft geltungssüchtigem Vater, dominanter, kraftvoller Mutter, viel Grund und Boden und friedlichen Geschwistern in einem Dorf, wo jeder jeden kennt ... Balduin kämpft heute noch gegen die Bevormundung durch seine Familie.
In einem psychiatrischen Krankenhaus hat man Willie nach seiner kläglichen Rückkehr aus Indien einen körperlichen Entzug verpasst. Er ist klug genug gewesen, den Therapeuten den Geläuterten vorzuspielen um schnell entlassen zu werden. Niemand hat sich um Willies Seele gekümmert.
Obwohl mir bald aufging, dass, was man über ihn sagte, die Wahrheit an dramatischen Tatsachen noch nicht einmal streifte, hielt mich das nicht eine Sekunde lang davon ab, mich hundertprozentig auf Willies Seite zu schlagen. Was ich so sehr an ihm begehrte, ohne ihn zu kennen, weiß ich bis heute nicht. Er war und ist attraktiv, groß und breitschultrig, hat zwar schlechte Zähne, dafür aber berückend schöne Augen, starke, feingliedrige Hände und schöne Haare. Mein Denken ist von einem Tag auf den anderen unwiderruflich auf das Geheimnis Willie ausgerichtet gewesen. Allerdings war die Anziehung viel weniger gegenseitig, als ich gern glauben wollte.
*
Im Sommer unseres Kennenlernens arbeitete ich als Thekenkraft in einem Café mitten in meinem Heimatort, wo es in der Badesaison zugeht wie in einem großen Irrenhaus. Die Touristen sind wild auf Braunwerden, den See und die geilen Motorbootfahrer, Tennislehrer, Stubenmädchen und Serviererinnen, die Einheimischen bloß auf das Geld der Gäste und deren Willfährigkeit in geschlechtlichen Dingen. Das ist es. Dieser Ort ist sommers ein wahrer Sündenpfuhl, und es ist kein Wunder, dass wenige junge Einheimische wirklich stabile Beziehungen zueinander entwickeln können. Damals hatte ich bereits einige Stationen eines Lebens hinter mir, das von einer höheren Instanz sicher nie als geruhsam geplant worden ist. Die Scheidung meiner Eltern, Reiseleiterausbildung, Umzug nach Linz, Arbeit in einem Lichtstudio, Umzug nach Graz mit Tommi, ein bisschen Studium, der Freund meiner Mutter verunglückte tödlich, meine Mutter begann zu trinken, Rückkehr nach Kärnten, Arbeit in einer Bank, Umzug nach Wien, wieder ein bisschen Studium, zurück nach Kärnten, Arbeit in einer Werbeagentur, ein Schwangerschaftsabbruch, Aufgabe meiner Arbeit und Hineinkippen in soziales Siechtum, neuerlicher Plan, in Wien weiterzustudieren und nebenbei zu arbeiten ...
Tommi versuchte im Sommer, da ich Willie kennenlernte, unsere inzwischen recht marod gewordene Beziehung wiederzubeleben. Er wollte mich von der Schnapsidee meines Lebens abbringen, wie er sagte, mich an Willie zu verschwenden. Ich hielt Tommi entgegen, dass er früher zu mir stehen hätte sollen, damals, als sein Vater mich noch einen Nichtsnutz, weil Studentin, geheißen und mich hinausgeschmissen hatte. Tommi hat dazu geschwiegen. Obwohl meine Oma heute noch sagt, dass er der richtige für mich gewesen sei, hat er es weder mit der Treue noch mit meinem Ambitionen jemals sehr genaugenommen. dass ich nicht sogleich Bäuerin werden und Kinder haben wollte, gab er zwar zu akzeptieren vor, doch seine Eltern ließ er in dem Glauben, ich würde schon noch so funktionieren, wie sie es von der zukünftigen Schwiegertochter erwarteten. Und mit Tommi zu schlafen, gefiel mir schon längst nicht mehr. Ich hatte entdeckt, dass ich ihn, rein freundschaftlich, wirklich gern hatte. Aber in puncto Erotik spielte sich nichts mehr ab. Er hatte mir in einer empfindlichen Phase gesagt, ich könnte nicht ordentlich blasen, und das verzieh ich ihm nie.
Mit Willie wollte ich sofort schlafen. Und ich war es auch, die ihn letztendlich dazu ermutigte. Ich mietete mir sogar im selben Haus, wo mein Bruder und ich mit meiner Mutter wohnten, ein Zimmer, um mit Willie ungestört sein zu können. Nach dem ersten Mal Sex sprang er aus dem Bett, zeigte mit dem Zeigefinger auf mich und tat, als wollte er mich erschießen. Er ging aufs Klo und blieb lange dort. Ich weiß nicht einmal mehr genau, wie es dazu gekommen ist, dass wir zusammen in eindeutiger Absicht in meinem Bett gelandet sind, noch, wie unser erstes Mal Bumsen sich im Detail abgespielt hat. Ich weiß nur noch, dass ich enttäuscht war. Allerdings machte der Gedanke, dass er nun mir gehörte, alles andere wett.
Allzu oft verpestete er fortan mein Zimmer, weil ich ihm erlaubt hatte, es zu betreten, wann immer er wollte, beglückt vom Beginn der ersehnten Beziehung. Stockbesoffen kam er an, während ich noch arbeitete, und seine Schweißfüße, seine Ungewaschenheit und den ständigen Zigarettenrauchgestank zu ertragen, gelang mir bei aller Liebe nur ein paar Wochen lang. In diesen Wochen suchte er mich bei meiner Arbeitsstelle heim, goss Kaffee überallhin, nur nicht in seine Kehle, lallte und pöbelte die anderen Gäste an. An guten Tagen versuchte er sogar einen Job zu finden, briet eineinhalb Stunden lang Würstchen und landete besoffen in einem Gebüsch. Tommi ließ auch nicht locker, und unzählige Male marschierte ich mitten in der Nacht nach Dienstschluss sieben Kilometer weit in Stockfinsterem in das Dorf, in dem er wohnte, nur, um Willie nicht in wieder einmal schrecklichem Zustand in meinem Zimmer anzutreffen. Ich marschierte, obwohl ich zu dieser Zeit eine Suzuki 450 Chopper besaß, und tagsüber, vor Dienstbeginn oder in der Mittagspause, stets zu einem nahegelegenen kleinen See fuhr, um mich freizuschwimmen. Das schnelle, anstrengende Gehen klärte meine Gedanken. Tommi nahm mich auf, ohne lange zu fragen. Wir schliefen nicht mehr miteinander.
Willie fragte nie, wo ich die Nacht über gewesen sei. Aus schlechtem Gewissen ihm gegenüber ließ ich ihn, der seit Jahren keinen Führerschein mehr besaß, mit meiner Maschine fahren. Weil er sich so strahlend glücklich darüber zeigte, beglückte mein eigener Mut, Vertrauen zu ihm zu beweisen, mich auch. Willie sah umwerfend gut aus auf der Maschine. Und unendlich stolz präsentierte er sich damit seinen alten Bekannten. Ich durchschaute seinen Anflug von Geltungsbedürfnis und gönnte ihm seine Freude.
Es kränkte mich sehr, wenn Willie einfach für Tage verschwand und ich später erfuhr, dass er mit Grete und ihrer Freundin Mary herumgezogen war und sonstwas erlebt hatte. Ich hörte, Willie sei sogar mit Grete auf meiner Maschine gesehen worden ...
So sehr ich Tommi mochte - meine Sehnsucht gehörte Willie, seit ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Verabscheute ich ihn auch in Zeiten, da er sich mir hemmungslos ungepflegt, herunterge¬kommen und stinkend präsentierte, zog etwas an ihm mich dennoch unaufhörlich an. Irgendwie tut es das noch, aber das darf niemand wissen, schon gar nicht Willie. Er würde wahrscheinlich jeden Respekt vor mir verlieren.
Damals hat jener Wunsch in mir zu keimen begonnen, der mich über die Jahre mit Willie gezogen, gestoßen, gezwungen hat, und er ist immer noch nicht vertrocknet, nicht einmal ausgewachsen: Ich wollte Willie immer gerne so sehen, wie ich weiß, dass er im Grunde seines Wesens ist: Ein lieber, großzügiger, sensibler, idealistischer, naturverbundener, intelligenter, fürsorglicher Mann. Und er sollte nur zwei Ziele haben: Mit beiden Beinen fest und eigenverantwortlich im Leben zu stehen und - mich. Mein Bild von ihm bestand aus meiner schönen Vorstellung und Bruchstücken seiner schrecklich selbstzerstörerischen Identität, die ich auch mit aller Kraft nicht wegleugnen konnte.
Mir wurde bald klar, dass ich wegen meiner »sauberen«, harmlosen Herkunft aus einer simplen, zerrütteten Arbeiterfamilie in Willies Welt nicht mitreden konnte. Was Willie mit seinen Freunden trieb, erzählte er mir nicht einmal. Die dicke Grete war allerdings immer dabei, das hatte ich mitbekommen. Meine Mutter behauptete, es sei besser so, dass ein anderes Mädchen diesen Wüstling begleitete, nicht ich, die ich, zart besaitet, wie ich sei, das niemals durchstehen würde können ... und ich sollte mir doch überlegen, was für ein Haufen Müll der Bursche sei. Aber meine Mutter hatte genügend eigene Sorgen, als dass sie sich viel mit der Beziehung zwischen der »... wilden Henne« und ihrer Tochter auseinandersetzen konnte.
Mein Bruder war inzwischen nach Klagenfurt gezogen, und was er dort trieb, blieb uns großteils verborgen. Nach den Jahren der Kämpfe zwischen meinen Eltern, des engen Zusammenwohnens mit mir und meiner Mutter in einer winzigen Wohnung, nach verfehlten Schulversuchen und missglückten Jobs, bedurfte er der Ruhe zur Selbstfindung, so nehme ich jedenfalls an.
Meine Mutter trank viel, gab sich manchmal besorgt, oft gleichgültig. Sie hat nach dem Unfalltod ihres geliebten Partners einen Neubeginn versuchen wollen und nicht gewusst, wo den Anfang des neuen Fadens aufnehmen. Meine Katze Iwan ist lange Zeit meine einzige wirkliche Freundin gewesen. Ich habe sie aufgezogen, und sie war mir zugetan wie ein Hündchen, ein treues Tier, wie man es nicht oft findet. Als ich Willie kennenlernte, habe ich angefangen Iwan zu vernachlässigen, desgleichen ihren Sohn Boris. Aber als Katzen seien sie wahrscheinlich ganz froh, freier als zuvor herumstreunen zu dürfen, da nicht ständig das Frauli nach ihnen rief, beruhigte ich mein Gewissen ...
Kaum ein Wesen habe ich jemals so geliebt wie Iwan, und ihr Sohn Boris ist mir ähnlich wichtig gewesen. Sobald ich mit Willie nach Wien gezogen bin, ist Iwan, siebenjährig, verschwunden und nie wiedergekommen. Ihr Sohn Boris ist bald darauf an Leukose gestorben. Wochenlang unsichtbar und von meiner Mutter verzweifelt gesucht, hat er sich eines Tages, da ich aus Wien angekommen bin, völlig abgemagert durch die Büsche herbei geschleppt, nachdem ich ihn stundenlang in den Wäldern der Umgebung gerufen hatte. Den Weidenstamm zu unserem Balkon hochklettern konnte er nicht mehr, aber er erwartete mich, im Gras liegend, und er versuchte sich zur freudigen Begrüßung an mich zu schmiegen. Als Iwan verschwand, schwor ich, niemals wieder jemanden im Stich zu lassen, und bis heute ist mir zum Weinen, wenn ich an sie denke. Als Boris starb, brach ein großes Stück meiner Welt ein. Willie hatte den Rest damals bereits zu erschüttern angefangen.
Zuweilen nahm Willie mich mit zu sich nach Hause. Auf dem Dachboden besaß er ein kleines Refugium im Form eines zugigen Verschlages samt Bett, vielen Kerzen, einem Kasten und keinem Teppich. Ich kutschierte Willie in Tommis Wagen herum, und Willie schlief mit mir - im wahrsten Sinne des Wortes. Denn während sein Penis noch in mir war, fiel er manchmal in Tiefschlaf. Dies war die erste einer Reihe von Kränkungen, die immer noch verdammt wehtun. Er bemerkte es nicht, wenn ich heulend davonschlich. Seltsamerweise sind mir keine Details unserer damaligen sexuellen Beziehung in Erinnerung geblieben. Tags nach dem missglückten Beischlaf wollte er oft in aller Ahnungslosigkeit wissen, was denn los sei mit mir.
Nicht selten schwor ich mir heulend, dass ich von diesem Arschloch niemals schwanger werden wollte. Einmal, als ich durchgesetzt hatte, dass wir fortan Präservative verwenden würden, zog er ein solches heimlich während des Bumsens herunter. Als ich seinen Samen an meinen Oberschenkel hinabrinnen spürte, erlitt ich beinahe einen Nervenzusammenbruch. Er hätte sich nichts dabei gedacht, erklärte Willie schulterzuckend, das Ding sei einfach unbequem gewesen, also hätte er es weggeschmissen. Noch dazu blieb in jenem Monat prompt meine Periode aus, und ich tastete mich tagelang zwischen Hysterie und Panik durch meine Arbeitszeit im Café, zerrte Willie aus seinem Bett, zwang ihn zum Reden und zum Einsehen, dass er sich wie ein Schwein verhalten und mein Vertrauen gemein missbraucht hatte.
»Null Verantwortungsgefühl hat der Kerl, pass bloß auf,« warnte meine Freundin, und da sie hemmungslos aussprach, was ich bange verdrängte, widersprach ich wütend. Balduin, Willies Freund, beruhigte mich, Willie hätte einfach noch nie eine Frau wie mich gekannt, so ernsthaft, so lieb, so treu ... Er hätte eben keine Erfahrung mit Frauen, die nicht die Pille nahmen. Daraufhin nahm ich ein halbes Jahr lang die Pille ein. Dabei erging es mir so schlecht, dass ich mir schwor, das nie wieder für einen Mann zu tun. Wenn nicht mit Gummi, ist seither meine Devise, dann eben gar nicht.
Willies Herumstreunen und tagelang Verschwinden machten mich krank. Tauchte er wieder auf, himmelte er mich an, ohne ein Wort darüber zu verlieren, wo er gewesen war, nannte mich »Baby« und war lieb und zutraulich. Irgendwann tauchte sogar Gretes Freundin Mary im Café auf, um mir zu sagen, ich sollte nicht glauben, Willie liege nichts an mir. Er wüsste nur genau, dass er nicht der Richtige für mich sei, dass ich viel zu unschuldig und zu gut sei für jemanden wie ihn. Überdies hätte er keine Ahnung, wie mit jemandem wie mir umzugehen sei.
Diese Auskunft versetzte Berge. dass Mary mir derlei verlautbarte, um Grete eins auszuwischen, bekam ich durchaus mit, aber es kümmerte mich nicht. Grete war in Willie verliebt, darüber lachte jeder. Und was Willie darüber dachte, wusste niemand. Wenn er nicht mit mir umzugehen wusste, ich würde mit ihm umzugehen lernen, frohlockte ich. Meine Periode bekam ich fortan wieder pünktlich, und ich gab mich betont locker und aufgeschlossen, sobald Willie sich blicken ließ.
Als ich ihm aber eines Tages an den Kopf warf, dass er ein verstunkener Saufbruder sei, weil mein Zimmer nach seinem Besuchen unerträglich roch, dass er nichtsnutzig und verlogen sei und doch bei seiner dummen Tussi bleiben sollte, tauchte er mehr als zwei Wochen lang nicht mehr bei mir auf.
Die Tage vergingen quälend, so schön der Sommer auch war. In mir erstarrte alles. War er vielleicht wieder nach Indien gegangen? Ein alter Freund von mir, meine erste große Liebe, nahm die Gelegenheit wahr, mir eindringlich zu raten, Willie zu vergessen. Ich war unbelehrbar und untröstlich. Mein alter Freund - von mir vorurteilskrank und neidisch genannt - klopfte mir auf die Schulter und wünschte mir viel Glück.
Zu Beginn unseres Kennenlernens hatte ich Willie öfter nach seinen Reiseplänen gefragt, weil das Gerücht umging, er würde bald wieder verduften. Stets hatte er mich nachdenklich angeschaut und genickt, ... ja, ja, in ein paar Wochen. dass das niemals sein Ernst gewesen ist, weiß ich heute. Damals mühte ich mich wie eine Ertrinkende, ihm nahe zu kommen. Schließlich konnte er jeden Tag wieder verschwunden sein, und ich würde nie Gelegenheit haben, ihn davon zu überzeugen, wie gut wir zusammenpassten ...
Nach Indien fuhr er sehr wohl wieder, allerdings Jahre später - mit mir. Und heute noch verwünsche ich die unselige Idee, diese Reise mit ihm zu machen. Aber zu jener Zeit glaubte ich, unsere Beziehung dadurch retten zu können. Alles wurde aber nur noch schlimmer ... dazu später.
In den Wochen, da er verschwunden war, kam mich sogar Grete besuchen und gab kleinlaut zu, dass auch sie ihn vermisste und dass er gar zu ihr von mir gesprochen hatte. Sie wollte mich aushorchen, und ich sah ihr an, dass sie ernsthaft litt. Als sie merkte, dass ich auch nicht mehr wusste als sie, ließ sie alle Freundlichkeit fahren und trumpfte damit auf, dass er wohl für immer ihr gehören würde. Jahrelang seien sie schon ein Liebespaar, sie schilderte mir, wie romantisch es in seinem Dachbodenverschlag zwischen ihnen zuginge, was für ein toller Liebhaber er sei. Und erst vorige Woche hätte er sie sogar zum Einkaufen nach Klagenfurt begleitet, hätte sie zu einem Kurs gebracht, wieder abgeholt, sich zu Hause von ihr schminken lassen ...
.... schminken? Damit konnte ich absolut nichts anfangen. Was für ein seltsamer Spaß! Einen Moment lang dachte ich sogar daran, dass Grete vielleicht wirklich besser zu Willie passte als ich ...
Ich schluckte meine Verzweiflung hinunter und machte mich daran, Willies besten Freund Balduin näher kennenzulernen. Hartnäckig mischte ich mich in dessen Freundeskreis und erreichte, dass ich eines abends, zum ersten Mal in meinem Leben, zum Haschischrauchen eingeladen wurde.
Mir war speiübel vor Aufregung, und ich flüsterte Balduin zu, ich hätte das noch nie gemacht. Er ließ mich beim Fabrizieren des Rauchgerätes helfen, und wir fuhren zu viert in ein abgelegenes Waldstück. Er werde auf mich aufpassen, beruhigte Balduin ernsthaft und zeigte mir, wie ich rauchen musste. Ich riss mich zusammen, tat, wie mir geheißen und hoffte, Willie würde auch wirklich von meiner Heldentat erfahren, wo immer er war. Er sollte sehen, dass ich sehr wohl in seine Welt passte und vertrauenswürdig war. Was nützte es, wenn wir miteinander spazierengingen und bumsten, da er mich doch nicht wirklich teilhaben ließ an seinem Leben?
An meine Mutter dachte ich auch, als ich in mich hineinlauschte, ob dieser seltsam klebrige, später über einer Flamme zerbröselte, von mir zusammen mit Tabak in Rauchform aufgesogene Kuchen auch schon wirkte. Meine Mutter würde es nicht fassen können, was ich tat - oder würde es ihr egal sein, weil sie ohnehin nicht wusste, was dagegen tun? Ich, die ich immer mehr auf den Bäumen zu Hause gewesen war als auf Partys von Gleichaltrigen, die nichts mehr geliebt hatte als in Ruhe zu lesen, mit Iwan und Boris zu spielen und abenteuerliche, romantische bunte Bilder zu zeichnen ... saß mit fremden Leuten in einem fremden Auto und rauchte etwas, von dem ich nicht einmal wusste, was es war. Ich tat etwas derartig Anrüchiges, dass mir einerseits davor graute, ich andererseits stolz war auf meinen Abenteuermut. Wohl fühlte ich mich dabei kein bisschen. Ich wusste, dass ich wieder ein wenig meiner Unschuld verloren hatte, und es war absolut nicht angenehmer als damals, da ich wirklich entjungfert worden war.
Später tanzte ich in einer Disco wie eine Wilde, und ich lachte und lachte und lachte, und man musste mich an die frische Luft bringen.
Willie erfuhr davon. Geradezu stolz war ich, als er mir später sagte, das hätte er nicht von mir gedacht. Ich grinste, und das sollte heißen, na, siehst du, ich bin wie du. Und er lächelte sein Lächeln, das alles bedeuten kann und nichts. Heute frage ich mich, ob dieses Lächeln jemals mehr gewesen ist als eine Art Bildschirmschoner für den Computermonitor, wenn das Hirn des Computers vorübergehend außer Betrieb ist, eine Szene, die über seine Züge flimmert und doch nur die Wahrheit in seinem Kopf verbirgt, ihn heimlich Energie tanken lässt.
Er ist damals braungebrannt wiedergekommen, vollkommen nüchtern, gut genährt und bester Dinge, allerdings mit einem bösen Sonnenbrand. Für mich hätte er das getan, flüsterte er, all das, viel geschlafen, nichts getrunken, Gesundes gegessen, er hatte sich in die Sonne gelegt und Sport betrieben wie ein Irrer, geschwommen sei er, gelaufen ... Er hätte sich so geschämt, gestand er, wie ein ausgekotztes Gespenst herumgelaufen zu sein neben mir, gesoffen zu haben und Weiber gevögelt, die er gar nicht leiden mochte. Nun seien ihm frisch gewaschene Haare lieber als die fettigen Strähnen, die er lange Zeit so cool gefunden hatte. Und er wechselte täglich die Socken, sagte er und gehe jeden Tag schwimmen. Tatsächlich sah er aus wie Adonis höchstpersönlich.
Und endlich hatten wir erfreulicheren Sex. dass ich eigentlich schüchtern war wie eine Jungfrau und gehörig viel Respekt vor seinem Körper und seiner Kraft hatte, bekam er vielleicht mit. Als Mann, der seine Teenagerzeit mit zahllosen bedeutungslosen, sexuellen Abenteuern verbracht hatte, war er ein Liebhaber der rustikalen Art, gewöhnt, sich ohne viel Federlesens seinen Spaß zu holen. Er hatte mir in Sachen Quantität einiges voraus, was aber die Qualität betraf ... Naja, sagte ich mir und besorgte mir meinen Orgasmus selber, ... Hauptsache, er ist es, den ich da streicheln und drücken darf.
Übrigens ist es für Willie sehr wichtig geblieben, sauber und einigermaßen gut gekleidet zu sein.
Waren wir zusammen auf Parties oder in Lokalen oder anderswo, behandelte er mich geradezu zärtlich. Einmal fuhr ich abends mit dem Rad Bier einkaufen, während er mit Grete, Mary und ein paar anderen bei einem Grillfest auf mich wartete. He, begrüßte er mich mit glänzenden Augen nach einer Viertelstunde, ... Baby, wo warst du nur so lange, ... und er streichelte mich und zog mich zum Sitzen auf seine Knie, versorgte mich mit allem, was ich essen oder trinken wollte, streichelte mich wieder und wieder und küsste mich ab.
»Geh nie wieder so weit fort von mir,« flüsterte Willie.
Wenn ich mich selbst rückblickend betrachte, sehe ich ein rosa Kätzchen, das fröhlich quiekend durch die Gegend läuft, bis über die Haarbüschel in beiden Ohren verliebt und stolz auf die Gunst eines zerzausten, abgeklärten Katers. Heute bin ich eine zerzauste, abgeklärte Löwin, die voller Nostalgie ihre Wunden leckt und dabei nicht gestört werden will.
Mein Sieg stand damals für mich fest. Willie beschloss, im Herbst mit mir nach Wien zu ziehen. Die Behauptung, dass er immer schon vorgehabt hatte, im Herbst nach Wien zu übersiedeln, wusste ich unwahr, auch wenn er sie jedem, der sie hören wollte, auftischte. Ich hatte ihn auf die Idee gebracht, denn für mich war diese Übersiedlung wahrhaftig seit einem Jahr festgestanden, und hatte Tommi noch soviel dagegengeredet. Und einmal ist Willie entfahren, es sei doch nicht mein Ernst, ihn allein zu lassen im kommenden öden Winter! Seinen Hang fremde Leistungen zu eigenen zu stilisieren oder eigene aufzubauschen, habe ich sofort an ihm bemerkt. Meinen Unwillen deshalb habe ich verdrängt. Er ist mir zunächst egal gewesen. Heute ist das anders.