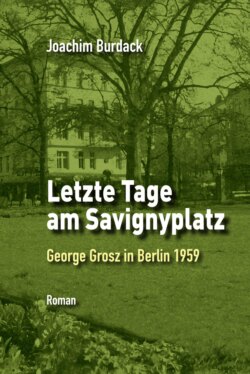Читать книгу Letzte Tage am Savignyplatz - Joachim Burdack - Страница 4
1. George zurück am Kurfürstendamm
Оглавление
15.Juni 1959
»Ach knallige Welt du Lunapark, du seliges Abnormitätenkabinett. Paß auf! Hier kommt Grosz, der traurigste Mensch in Europa. Ein Phänomen an Trauer«, murmelte der groß gewachsene, ältere Herr vor sich hin. Er zitierte gerne aus seinem Gesang an die Welt, wenn er nachdenklich gestimmt war. Zum wiederholten Mal hatte er bei seinem Spaziergang einem Haufen Hundekot ausweichen müssen, der mitten auf dem breiten Bürgersteig in Charlottenburg lag. Berlin hatte sich verändert, seit er die Stadt vor einem Vierteljahrhundert verlassen hatte, in jeder Hinsicht.
Das wolkenverhangene, trübe Wetter an diesem Junitag drückte auf Georges Stimmung. In New York war es um diese Jahreszeit oft schon heiß und schwül, das war natürlich auch nicht besser. Man hätte ihn mit seinem breitkrempigen Hut und der gestreiften Krawatte leicht für einen amerikanischen Touristen halten können. Sobald er jedoch sprach, belehrte sein akzentfreies Deutsch eines Besseren. Vor drei Wochen waren er und seine Frau Eva in Amerika aufgebrochen, hatten sich in New York auf der Bremen nach Bremerhaven eingeschifft. In Deutschland verbrachten sie zunächst ein paar Tage in Hamburg. Dann ging es mit dem Flugzeug weiter nach Berlin. Hier wohnten sie nun vorübergehend, bis sie eine passende Bleibe gefunden hatten, in der Wohnung von Evas Schwester Lotte am Savignyplatz. Die Akademie der Künste in West-Berlin, die George zu ihrem Mitglied gewählt hatte, half ihnen bei der Wohnungssuche, aber noch war nichts Geeignetes in Aussicht. Eva und Lotte waren unterdessen in den Harz gereist. Dort trafen sie sich mit ihrer Mutter. George hatte die Wohnung für sich und endlich auch etwas Zeit, sich in Berlin umzuschauen.
Vom Savignyplatz kommend, war er in die S-Bahn-Passage eingebogen, die zur Bleibtreustraße führte. Dort schwenkte er nach links und ging unter dem Bahn-Viadukt in Richtung Kurfürstendamm. Über ihm ratterte ein Zug mit ohrenbetäubendem Lärm. ‚Turbulente D-Züge über rasselnde Brücken knatternd‘, fiel ihm dazu aus seinem Gesang ein. Die Tauben, die sich in den Querstreben der eisernen Brücke angesiedelt hatten, schien der Lärm nicht zu stören. Sie gurrten weiter vor sich hin und bedeckten die Brückenpfeiler geduldig mit einer hellen Dreckschicht. Wenn George je wieder Bilder von Berlin malen sollte, wären sie wohl voller Hundekot und Taubendreck. Das ließe sich gar nicht vermeiden. Die Exkremente waren ihm aufgefallen und würden sich somit ins Bild drängen, einfach durch den Eindruck, den sie bei ihm hinterlassen hatten. Eigentlich hatte er immer nur Bilder voller Schönheit malen wollen, als er als junger Maler frisch von der Dresdner Akademie zurück nach Berlin kam. Aber die Wirklichkeit, die er wahrnahm, ließ das nicht zu. Immer wieder fiel sie ihm in den Pinsel. Wie sollte man Schönes malen, wenn man nur Hässliches und Gewalttätiges um sich herum sah? Berlin hatte ihn einfach überwältigt. Zeichnen wurde für ihn in jener Zeit eine physische und psychische Notwendigkeit, ein Akt der Selbsterhaltung, eine Art rituelle Reinigung. All die Dämonen, die auf ihn eindrangen, mussten raus aus seinem Kopf und auf Papier oder Leinwand gebannt werden: die Schieber und die Schupos, Huren und Zuhälter, Kriegsinvaliden und Kriegsgewinnler, Spartakisten und die Freikorpsmänner.
George war zwar in Berlin geboren, aber heimisch hatte er sich hier nie gefühlt. Heimat, das waren für ihn eher die Kleinstadt Stolp und die Landschaft an der pommerschen Ostseeküste. Als Junge hatte er dort tagsüber in den Wäldern und Dünen gespielt und abends Abenteuer- und Wildwestromane verschlungen. Im Rückblick erschien ihm diese unbeschwerte Kindheit als die glücklichste Zeit in seinem Leben. Aber im idyllischen Pommern hätte er nie die Bilder malen können, die ihn in den zwanziger Jahren berühmt und - wie manche behaupten würden - auch berüchtigt gemacht hatten. Seine Zeichnungen, Aquarelle und Ölbilder waren voller Gewalt und menschlicher Perversion.
Eine Art Hassliebe verband ihn mit Berlin. Er benötigte die Stadt als Inspiration für seine Werke. Aber gleichzeitig brachte ihn die ständige Reizüberflutung aus dem emotionalen Gleichgewicht. Der großstädtische Moloch ging ihm auf die Nerven, machte ihn aggressiv und wütend. Es gab zu viele Menschen auf engem Raum, zu viel Rücksichtslosigkeit und endloses Elend. Berlin nagte regelrecht an ihm. Depressionen wurden seine ständigen Begleiter. Manchmal meinte George, einen perfiden Mechanismus des Kunstbetriebs zu erkennen. Je schlechter es ihm persönlich ging, desto mehr Erfolg hatte er als Maler. Das Publikum mochte es anscheinend, wenn ein Künstler von seinem Werk verschlungen wurde, wenn er sich dafür ans Kreuz schlagen ließ oder sich wenigstens ein Ohr abschnitt. Das Opfer der geistigen und körperlichen Gesundheit auf dem Altar der Kunst galt als Beleg von Wahrhaftigkeit und Authentizität.
Wenn er den Moloch nicht mehr aushielt, reiste er mit Eva nach Frankreich. Dort fand er Ruhe. Die Bilder, die er von dort mitbrachte, waren ganz anders gestimmt als seine Berliner Werke. Gleichsam als ob eine andere Person sie geschaffen hätte. Im Scherz sagte Eva manchmal, dass er wie Doktor Jekyll und Mr. Hide malen würde. Der aggressive und aufgewühlte Mr. Hide führe seinen Stift in Berlin, während der freundliche Doktor Jekyll sich in Südfrankreich seiner annahm.
Das alles war drei Jahrzehnte her. Nazizeit und Krieg hatte er in New York verbracht. Gerade noch rechtzeitig vor Hitlers Machtübernahme war er mit seiner Familie nach Amerika geflohen. Jetzt kam er als amerikanischer Staatsbürger zurück. Heute spürte er nichts mehr von seinen damaligen starken Emotionen. Das heutige Berlin des Jahres 1959 konnte er vielleicht bemitleiden, bedauern oder auch belächeln, aber starke Gefühle von Zuneigung oder Abneigung löste dieser geteilte Torso einer Metropole bei George nicht mehr aus. Berlin wirkte blasser auf ihn als früher, wie eine alte Postkarte, deren Farben ausgeblichen waren. Alles war banaler. Sogar die Latrinensprüche, die George immer gerne gelesen hatte, waren schlechter geworden. Früher konnte man kleine Kunstwerke auf den öffentlichen Toiletten entdecken. Einige waren sogar Inspiration für seine Zeichnungen. Heute fanden sich dort meist nur primitive Kritzeleien, Telefonnummern und das Wort ficken in allen Konjugationsformen. George war der Meinung, dass man den Zustand einer Kultur auch an ihren Toilettensprüchen ablesen konnte. Wenn das stimmte, dann bestand hier wenig Hoffnung.
Er wunderte sich auch, wie wenige Kriegsinvaliden man auf den Straßen sah. Das war nach dem Ersten Weltkrieg ganz anders gewesen. In jedem Hinterhof schienen damals einarmige Leierkastenspieler ihre Drehorgeln zu betätigen. An jeder Ecke saßen Uniformierte mit Beinstümpfen und verkauften Streichhölzer. Wo waren die Verstümmelten des letzten Krieges verblieben? Auf den Straßen sah man sie jedenfalls nicht. Dafür fielen die vielen älteren Frauen im Straßenbild auf. Waren es Kriegswitwen, deren Männer in Russland gefallen waren oder versteckten sie ihre Krüppel von Ehemännern einfach zu Hause?
Nur den Hunden schien es in Berlin gutzugehen. Ihre Zahl hatte jedenfalls stark zugenommen. So ließe sich das kriegsversehrte Berlin eventuell auf die Leinwand bringen: Eine alte Frau mit einem Dackel, der seinen Haufen auf dem Trottoir platziert. Vielleicht sollte er sich einen Skizzenblock besorgen.
In der Bleibtreustraße konnte er das ihm vertraute Vorkriegs-Berlin noch eher wiedererkennen als in großen Teilen der Innenstadt. Die Kriegsschäden hatten sich hier offensichtlich in Grenzen gehalten. Total zerstört waren nur die beiden Eckhäuser an der Niebuhrstraße. An einer Ecke hatte man die Ruine abgeräumt und einen schmucklosen Flachbau für ein Kino errichtet. Capri verkündete die neonfarbige Leuchtschrift über dem Eingang, ein trauriges Symbol deutscher Sehnsucht nach dem Süden. Im gegenüberliegenden Ruinengebäude wurde nur noch das Erdgeschoss von einem kleinen Schreibwarengeschäft genutzt. Hier konnte er nach Skizzenpapier fragen. Vielleicht verspürte er ja Lust, ein paar Zeichnungen anzufertigen. Er betrat das Schreibwarengeschäft und wählte einen der Skizzenblöcke aus, den die nette Verkäuferin ihm vorgelegt hatte. In der hinteren Ecke des Ladens saß ein kleiner Junge konzentriert über ein Schreibheft gebeugt. Er erledigte offensichtlich seine Schularbeiten. Vor ihm stand eine halbvolle Flasche Sinalco. George kaufte noch eine Ansichtskarte. Später verschickte er die Karte mit folgendem Text: Schön in Berlin, sehr grün und still. Viele alte Frauen mit Stöcken. Almost like a resort, wie ein Kurort hier.
Nachdem George den Laden wieder verlassen hatte, ging er ein paar Schritte weiter Richtung Kurfürstendamm zum Haus mit der Nummer 15. Das Gebäude hatte den Krieg unversehrt überstanden. Hier hatte sein Freund und Gallerist Alfred Flechtheim gewohnt. Er war als Jude vor den Nazis geflohen und verarmt in London gestorben. Bei seinen Partys ging es in den zwanziger Jahren immer hoch her. Die Maybach- und Mercedeslimousinen parkten bis hinter die Mommsenstraße. George war oft zu Fuß aus Wilmersdorf herübergekommen. Nur wenn Eva dabei war und sie ihre Garderobe nicht ruinieren wollte, nahmen sie ein Taxi. Bei Flechtheim war immer viel Prominenz zu Gast. Hier hatte er auch Max Schmeling kennengelernt, den er später porträtieren sollte.
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite bemerkte George den Laden von Jack Bilbo, einem alten Bekannten. In Käpt’n Bilbos Schatztruhe wurden Kuriositäten aus fernen Ländern angeboten. Jack betrieb auch eine Bar am Kurfürstendamm. Beide Lokalitäten waren aber im Augenblick geschlossen. George nahm sich vor, ein anderes Mal vorbeizuschauen.
Wenig später erreichte er die Ecke Kurfürstendamm und blickte auf das neue MGM-Kino gegenüber: ein modernistischer Neubau mit schwarz glänzender Fassade, der etwas von einem Raumschiff hatte. George hatte den Ku‘damm anders in Erinnerung. Früher war die Gegend sein Kiez gewesen. Sobald er es sich leisten konnte, war er mit Eva in die Nähe des Boulevards gezogen. Für George war der Kurfürstendamm immer das Gegenstück zu dem preußischen Boulevard Unter den Linden in Berlin-Mitte.
War der Linden-Boulevard von Adel und preußischem Militär geprägt, so war der Kurfürstendamm der Boulevard der Bürger. Die monumentale Kulisse der Linden schien wie geschaffen für Militärparaden, die durch das Brandenburger Tor zum Stadtschloss der Hohenzollern zogen, vorbei an vielen staatlichen Prachtbauten und Adelspalais. Hier kam der Einzelne sich klein und unbedeutend vor. Dagegen konnte George sich militärische Aufmärsche auf dem Kurfürstendamm nur schwer vorstellen. Wenn es hier je welche gegeben hätte, so hatte George jedenfalls keine Erinnerung daran. Der Boulevard Unter den Linden stand für Gehorsam und Unterordnung. Darüber wachte der Alte Fritz von seinem Reiterstandbild. Der Ku‘damm dagegen symbolisierte Geschäftigkeit, Vergnügen und Lebensfreude. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet Reichskanzler Bismarck entscheidenden Anteil am Entstehen der Charlottenburger Prachtstraße hatte. Ihm war der geplante Ausbau einer Verbindungsstraße von Berlin zum Grunewald nicht repräsentativ genug. Er erinnerte sich wohl an seine Ausritte in den Bois de Boulogne, als er Gesandter in Paris war. Der Grunewald erschien ihm das Pendant zum Pariser Bois. Deshalb sollte der Kurfürstendamm zu den Berliner Champs Elysées werden - ein schöner ‚Hauptspazierweg für Wagen und Reiter‘. Bismarck ließ die ursprünglich geplante Straßenbreite von nur dreißig Metern per Kabinettsorder einfach verdoppeln. Damit hatte der Kurfürstendamm zwar immer noch nicht die Ausmaße seines Pariser Vorbilds erreicht, aber immerhin. Man munkelte, dass Bismarck gerne ein Denkmal am Boulevard des Westens gehabt hätte. Aber der Wunsch wurde ihm nicht erfüllt. George wusste immer zu schätzen, dass der Kurfürstendamm im Gegensatz zum Linden-Boulevard eine denkmalfreie Zone war. Das aufstrebende Bürgertum feierte sich mit protzigen Putzfassaden selbst und brauchte keine Denkmäler vergangener Größe, denn es war sicher, dass ihm die Zukunft gehören würde.
In den Erdgeschossen der Gründerzeithäuser entstanden zahlreiche Lokale und Gaststätten. Vor allem in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg bildete sich eine Vergnügungskultur mit Theatern, Cabarets und Caféhäusern heraus, die ihresgleichen suchte. Ein Schriftsteller nannte den Kurfürstendamm damals ‚das größte Caféhaus Europas‘. Der Boulevard bot alles, was George an Berlin liebte: Kinos, Bars und Betriebsamkeit bis spät in die Nacht.
Aber was war noch übrig von dieser Vorkriegswelt? Die meisten Häuser hatten den Krieg nicht heil überstanden. War der Boulevard nicht zu einer Art umgekehrter Peter Schlemihl geworden? Der hatte bekanntlich sein Schattenbild verkauft. Der Kurfürstendamm war dagegen nur noch ein Schatten seiner selbst. Kinos gab es zwar wieder, aber sie hatten wenig gemeinsam mit den exklusiven Lichtspielpalästen der zwanziger Jahre, die George häufig besucht hatte. Typisch für den Wandel des Kurfürstendamms schien ihm der neue Gloria-Palast zu sein. Vor dem Krieg war dieser das luxuriöseste Filmtheater in Berlin. Der Kinosaal hatte einen Orchestergraben, in dem vierzig Musiker Platz fanden, um Stummfilme zu begleiten. Auch sonst trug das Lichtspielhaus die Bezeichnung Palast mit einiger Berechtigung. Es war ausgestattet mit Garderoben, Bars, Marmortreppen, einem Spiegelsaal und sogar einem Springbrunnen. George konnte sich noch an die Premiere des Blauen Engel mit Marlene Dietrich erinnern. Der Champagner, vielleicht war es auch nur Sekt, floss in Strömen. Der alte Gloria-Palast hatte den Krieg nicht überstanden. Der neue befand sich in einem schlichten Nachkriegsbau, der anstelle des zerbombten historischen Gebäudes errichtet worden war. Das neue Kino hatte zwar eine moderne Filmtechnik für CinemaScope-Filme, aber nichts mehr von dem Glamour seines Vorgängers.
In den Goldenen Zwanzigern war der Ku’damm eine Glitzerwelt der Illusionen. Aber wenn George zurückdachte, so war dieser Boulevard der Lebensfreude schon damals in Gefahr. Er erinnerte sich noch gut an den September 1931. Hunderte SA-Leute in Uniform oder in Zivil hatten sich unter die Passanten gemischt und griffen Juden an, die aus der Synagoge in der Fasanenstraße kamen. Dann wurden auch Passanten, die irgendwie jüdisch aussahen, beschimpft und geschlagen sowie jüdische Lokale und Restaurants verwüstet. Die Schlägertrupps hatten auch das Romanische Café, sein Stammlokal, heimgesucht. George hatte die SA-Trupps auf der Straße gesehen. Es war als hätte eine feindliche Armee das Viertel besetzt. Eva konnte ihn gerade noch zurückhalten, sich einzumischen. Er hörte noch, wie ein SA-Führer triumphierend rief: »Jetzt haben wir dem verjudeten Kurfürstendamm einen gehörigen Denkzettel verpasst!«
Viele der Passanten schienen durchaus mit der Aktion einverstanden zu sein, zumindest unternahm niemand etwas. Auch die Polizei ließ sich lange Zeit nicht blicken. Damals war George bewusst geworden, dass er Deutschland wohl bald verlassen müsste. Er konnte die Gefahr körperlich spüren. Hitler würde in diesem vom Krieg gedemütigten Deutschland bald an die Macht kommen. Diese Einsicht drängte sich ihm immer unerbittlicher auf. Als er dann das Angebot bekam, an einer amerikanischen Kunsthochschule zu unterrichten, hat er nicht lange gezögert. Zunächst ging er für einen Sommer allein nach New York, ein halbes Jahr später dann endgültig mit Eva und den beiden Söhnen. Er hatte Berlin gerade noch rechtzeitig vor Hitlers Machtergreifung verlassen können. Die Situation drohte gefährlich zu werden. Er wusste, dass er auf der Schwarzen Liste der Nazis stand. Schon einmal war er ihnen nur knapp entgangen. Betrunkene SA-Leute standen eines Abends vor seinem Atelier und brüllten: »Komm raus, du Judenschwein!«
Es hätte in dieser Situation wohl wenig genutzt, den Kameraden zu versichern, dass alle seine Vorfahren deutsche Bauern aus Hinterpommern waren. Als die Uniformierten drohten die Tür einzutreten, öffnete er ihnen schließlich: »Es tut mir leid meine Herren, aber der Herr Künstler ist leider die ganze Woche verreist und kommt erst am nächsten Montag wieder. Ich mache hier nur sauber. Kann ich etwas ausrichten?«
Wie immer bei der Arbeit trug George eine alte Kittelschürze und ein Stoffkäppi, ein Aufzug, in dem er ziemlich lächerlich aussah. Seine Unschuldsmine und ein aufgesetzter pommerscher Akzent taten ein Übriges. Die SA-Rabauken waren offensichtlich verdutzt und standen einen Augenblick unschlüssig herum. Dann brüllte der Anführer: »Du kannst dem Schmierfinken sagen, dass wir wiederkommen und ihm seine Judenfresse polieren werden, wenn er nicht verschwindet. Heil Hitler!« Darauf zogen sie ab.
Inzwischen war George am neuen Café Kranzler an der Ecke Joachimsthaler Straße angelangt. Alle Tische waren besetzt. Eigentlich hatte er hier eine Tasse Kaffee trinken wollen, aber der Neubau mit seinen eng gestellten Tischen und der hektischen Atmosphäre entsprach ohnehin nicht seiner Vorstellung von einem Caféhaus. Er beschloss, noch etwas weiter in Richtung Gedächniskirche zu gehen.
Den Kirchplatz kannte er noch unter dem Namen Auguste-Viktoria-Platz. Zu seiner Überraschung sah er, dass der Platz inzwischen Breitscheidplatz hieß. Er kannte den Sozialdemokraten Rudolf Breitscheid aus den zwanziger Jahren. Den Schönen Rudi hatten sie ihn immer genannt. So hatte George ihn auch gezeichnet: Im gut sitzenden Anzug mit einer roten Rose in der Hand. Herrn Dr. Breitscheid hatte die Tuschezeichnung wohl geschmeichelt. Jedenfalls bedankte er sich persönlich bei George. Jetzt hat der Schöne Rudi einen angemessenen Platz bekommen, dachte George bei sich und überlegte, ob man auch einmal einen Platz in der Gegend nach ihm benennen würde.
Auf dem Breitscheidplatz stand nur noch die Ruine der Kaiser-Wilhelm-Gedächniskirche. Man hatte nach langen Diskussionen beschlossen, sie als Mahnmal gegen den Krieg stehenzulassen und eine moderne Kirche um sie herum zu bauen. Die Grundsteinlegung war vor kurzem erfolgt. Auch George hatte einen Vorschlag zur Neugestaltung gemacht: Man sollte die Turmruinen doch gold- und silberfarben anstreichen. Die Ruinen würden dann im Sonnenlicht glänzen. Aber seine Idee hatte kein Gehör gefunden.
Hinter der Kirche sah George, wie die letzten Trümmer des ehemaligen Romanischen Cafés abgeräumt wurden. Das war lange Zeit sein Stammcafé gewesen. Auch Georges Verleger und Freund Wieland Herzfelde und dessen Bruder John Heartfield verbrachten, in Ermangelung eines eigenen Büros, hier ganze Tage. Einmal wollte der Ober John Heartfield nicht hereinlassen, weil er ihn mit dem Zeitungs- und Zeitschriftenstapel, den er bei sich trug, für einen Zeitungsverkäufer hielt. Johnny zerschnitt immer irgendetwas: Zeitungen, Fotos und Werbeanzeigen, um dann alles in Fotomontagen mit überraschender Wirkung neu zusammenzufügen.
Das Romanische Café hatte aus zwei großen, dunklen Sälen bestanden, die dem Romanischen Baustil mit mächtigen Säulen und Rundgewölben nacheiferten. Die Räume erinnerten mehr an eine Bahnhofshalle, als an ein gemütliches Caféhaus. Tatsächlich herrschte hier eine strikte Zweiklassengesellschaft. Der größere Saal, das sogenannte Bassin für Nichtschwimmer, war offen für Touristen, Schaulustige und namenlose Amateurpoeten. Prominenten Stammkunden war der kleinere, Bassin für Schwimmer genannte Saal vorbehalten. Mit der Zeit war es George und Wieland gelungen, ins Schwimmerbecken zu wechseln. Auch wenn er hier viel Zeit verbrachte, ging George zum Essen lieber anderswohin, beispielsweise zu Aschinger ein paar Straßen weiter, denn die Küche im Romanischen Café war eher schlecht. Trotzdem war es the place to be, der angesagte Ort, an dem man sich sehen lassen musste.
George musste immer noch schmunzeln, wenn er daran dachte, wie er die Brüder Wieland und John, der damals noch Helmut hieß, kennengelernt hatte. Das war schon ein eigenwilliger Spaß gewesen, den er sich mit ihnen erlaubt hatte.
Als er noch vor Kriegsende wieder nach Berlin kam, hörte George von einer Künstlergruppe, die sich Dada nannte. Sie lehnten den traditionellen Kunstbetrieb ab und wollten etwas völlig Neues machen. Nach ihrer Ansicht hatte die europäische Kultur durch den Krieg ihren Wert und ihre Fundamente verloren. Man müsste erst einmal tabula rasa machen und völlig neu anfangen. Der große Sinn, der sich als Lüge herausgestellt hatte, sollte durch den großen Unsinn ersetzt werden. George, der den Wahnsinn des Krieges miterlebt hatte, leuchtete das unmittelbar ein. So beschloss er, gleich zur Tat zu schreiten. Er zog sich seinen besten Anzug an, band sich eine Krawatte um und begab sich zum Treffen der Dadaisten. Dort stellte er sich als holländischer Kaufmann vor, der den jungen Künstlern eine Geschäftsidee unterbreiten wollte. Zum Entsetzen der pazifistischen Künstlergruppe erläuterte der angebliche Niederländer, dass man im Krieg auch die positiven Seiten sehen müsse: »Ein neutraler Holländer wie ich sieht die Dinge wohl etwas nüchterner. Es bieten sich doch jetzt interessante geschäftliche Möglichkeiten. Ich hab‘ da eine tolle Idee, für die ich Sie gerne gewinnen würde. Ich möchte künstlerisch wertvolle Kriegsandenken aus Granatsplittern und Patronenhülsen herstellen. Man könnte zum Beispiel passende Granatenteile bemalen und als Aschenbecher verkaufen. Die Andenken werden dann noch mit vaterländischen Sinnsprüchen verziert, wie ,Jeder Schuss ein Russ‘ oder ‚Aus großer Zeit‘. Was meinen Sie dazu? Ich kann ihre Unterstützung bei der künstlerischen Gestaltung gut gebrauchen, meine werten Herrn Künstler. Wir wollen doch Qualitätsprodukte herstellen. Das sind wir den Opfern schuldig. Ich habe vor, schon bald einhundert Kriegsinvaliden einzustellen. Aber wir müssen uns beeilen. Der Krieg dauert nicht ewig oder andere kommen vielleicht auf die gleiche Idee. Wie sagen Sie in Deutschland? Man muss die Eisen schmieden, solange sie warm sind!«
John Heartfield hatte den Raum empört verlassen. Bei den anderen herrschte bedrücktes Schweigen, während George entspannt sein Pfeifchen anzündete. George liebte solche Maskeraden. Erst Tage später kamen die anderen hinter seinen Schabernack.
Später zeigte George Wieland seine jüngsten Arbeiten. Der war beeindruckt von der drastischen Darstellung des Berliner Milieus. Wieland borgte sich Geld zusammen, um eine Mappe mit Georges Zeichnungen in seinem Malik-Verlag herauszugeben. Das war der Beginn einer langen Zusammenarbeit und Freundschaft.
Zu viele Erinnerungen kamen bei George wieder hoch, wenn er an das Romanische Café dachte. Eigentlich hatte er gar keinen Appetit mehr auf Kaffee und Kuchen. Er würde doch lieber etwas Richtiges trinken. Er beschloss zurückzugehen und auf ein Bier bei Franz Diener in der Grolmannstraße einzukehren. Eine Boulette wäre jetzt auch besser als Kuchen. Er schaute auf seine Uhr. Es war kurz vor 18 Uhr. Das Lokal müsste inzwischen schon geöffnet haben.
Heute wollte er zeitig zu Bett gehen, denn der morgige Tag würde anstrengend werden. Er hatte vor, einen alten Freund in Ost-Berlin zu treffen.