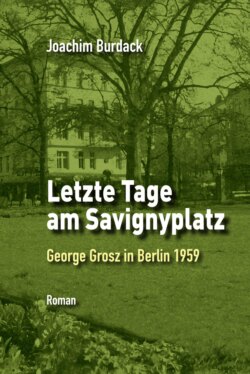Читать книгу Letzte Tage am Savignyplatz - Joachim Burdack - Страница 5
2. Albert fährt zum Sachsendamm
Оглавление
Juni 1959
Albert Bergmann saß in seinem Zimmer und erledigte seine Hausaufgaben, zumindest versuchte er es. Mathematik war nicht gerade seine Stärke und die Differentialrechnung, die sie gerade im Unterricht behandelten, hatte er nie richtig verstanden. Er würde es in Mathe nicht zu einer guten Note bringen, aber er wollte wenigstens die wacklige Vier halten, die er sich mühsam erarbeitet hatte, denn sonst wäre seine Versetzung im nächsten Jahr ernsthaft in Gefahr. Albert besuchte die 12. Klasse des Sophie-Charlotte-Gymnasiums in Charlottenburg. Das altehrwürdige Schulgebäude in der Sybelstraße, das nur wenige Minuten zu Fuß von der elterlichen Wohnung entfernt lag, zog ihn immer herunter, deprimierte ihn. Die Aussicht, dort noch ein zusätzliches Jahr verbringen zu müssen, gefiel ihm überhaupt nicht. Da quälte er sich lieber noch etwas mit den Ableitungen von Differentialgleichungen.
Manchmal dachte er, dass man für Mathematik einfach eine andere Art von Verstand benötigte als er ihn hatte. Und um in den öden Zahlenreihen und Formeln einen Sinn oder gar die Eleganz zu entdecken, von der Oberstudienrat Lehmann immer faselte, dazu musste man schon ziemlich schräg drauf sein, oder - und das leuchtete Albert noch mehr ein - du bist ein Masochist, einer der sich gerne quält und in das Scheitern verliebt ist.
Das mit dem Scheitern erinnerte Albert nun wieder an seinen Namensvetter und französischen Lieblingsautoren Albert Camus. In seinem Buch über den Mythos von Sisyphos schilderte der das ewige Scheitern als etwas zutiefst Menschliches, als wäre der Mensch geradezu zum Scheitern geboren. Der alte Sisyphos hatte gegen die Götter rebelliert und war deshalb von ihnen dazu verurteilt worden, einen Felsblock den Berg hinaufzuwuchten, nur um dann sehen zu müssen, wie der Stein immer wieder ins Tal rollt. Dann ging die Sache wieder von vorne los, ganz schön sinnlos. Camus aber schreibt dazu: Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Man muss sich Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen!
Was sollte das nun wieder bedeuten? Ist Sisyphos glücklich, weil er etwas zu tun hat und sich keine Gedanken machen muss, wie er den morgigen Tag rumbringt? Oder schaut er einfach gerne zu, wie ein Stein bergab rollt? Jedenfalls war Camus leider wenig hilfreich beim Lösen von Matheaufgaben.
Um es überhaupt mit den Schularbeiten auszuhalten, machte Albert das Radio an. Seit seine große Schwester ausgezogen war, hatte er das Zimmer für sich alleine. Evi hatte immer nur Sender mit klassischer Musik eingeschaltet, was Albert furchtbar nervte. Jetzt konnte er hören, was er wollte. Das war echter Luxus.
Es war gerade fünf Uhr geworden, Zeit für AFN. Zu dieser Zeit lief auf AFN-Berlin immer Frolic At Five mit den neuesten Hits. Der Sender der amerikanischen Streitkräfte war ursprünglich eingerichtet worden, um die GIs mit Musik und Nachrichten aus der Heimat zu versorgen. Mit der Zeit aber wurde er zur ersten Adresse für musikbegeisterte Jugendliche in Berlin und Umgebung. Kaum hatte Albert das Radio angeschaltet, hörte er auch schon die Titelmelodie und die vertraute Moderation des Discjockeys, wie man die Ansager von Musiksendungen neuerdings nannte. »Hey, hey, hey what do you say? It’s time for another edition of Frolic At Five!«
Im AFN hatte Albert zum ersten Mal Elvis Presley und Buddy Holly gehört. Heute, am Mittwoch, wurden immer Hörerwünsche gespielt. Auch Albert hatte eine Karte an den Sender geschickt und sich Diana von Paul Anka gewünscht, mit Widmung ‚…for the pretty girl in Pankow from the lonesome boy in Charlottenburg‘. Vielleicht hatte er Glück und sein Wunsch würde heute gespielt. Beim AFN konnte er wenigstens sicher sein, dass sie das Original von Paul Anka spielten und nicht den lauwarmen, deutschen Aufguss von Conny Froboess wie im RIAS. Das Girl in Pankow war natürlich Inge, für die er seit ein paar Monaten schwärmte. Eigentlich hätte er sich ja einen Song von Bill Haley wünschen sollen, denn er hatte Inge beim Konzert von Bill Haley and his Comets im letzten Oktober kennengelernt. Aber Diana war natürlich viel romantischer. Albert träumte noch so vor sich hin, als sich die Tür öffnete und seine Mutter eintrat.
»Möchtest du eine Tasse Pfefferminztee, Berti? Ich stell‘ sie dir auf den Tisch, das heißt, falls ich hier noch einen freien Platz finde bei diesem Tohuwabohu. Du könntest dein Zimmer mal wieder aufräumen. Wie kannst du überhaupt bei dieser Urwaldmusik arbeiten? Da wird man doch ganz verrückt im Kopf.«
»Danke, Mutti. Die Musik hilft mir bei der Konzentration, und weißt du, was Camus über Ordnung sagt? Äußere Ordnung ist oft nur der verzweifelte Versuch, mit einer großen inneren Unordnung fertig zu werden.« Camus half zwar nicht bei Matheaufgaben, aber für einen guten Spruch war er immer zu gebrauchen.
»Wo hast du denn diesen Unsinn her, Junge? Ordnung muss schon sein. Wir sind hier doch nicht bei den Hottentotten!«
Bei seiner Mutter waren immer die Hottentotten schuld. Seine Großmutter hatte in diesem Zusammenhang immer auf Russisch Polen verwiesen. Sein Vater dagegen sprach von wie bei Hempels unterm Sofa. Albert wusste weder, wer die Hottentotten waren noch wo Russisch Polen lag. Vielleicht waren die Hempels ja Hottentotten, die in Polen lebten, oder so ähnlich. Es war in solchen Situationen jedenfalls besser nicht nachzufragen, sondern Einsicht und Reue vorzutäuschen: »Ja, Mutti, ich mach‘ das am Wochenende. Heute komme ich nicht mehr dazu. Hotte holt mich gleich ab und bis dahin will ich noch die Schularbeiten erledigen.«
»Wie hört sich denn das an: Hotte. Er heißt doch Dieter. Du kannst deinem Freund Dieter auch mal sagen, dass er ruhig an der Wohnungstür klingeln kann und nicht immer von der Straße nach oben pfeifen soll. Dafür ist die Klingel schließlich erfunden worden.«
»Ja, Mutti, sag‘ ich ihm. Das ist eben einfach so eine Angewohnheit.«
»Na ja, er ist ja sonst ein netter Kerl, aber diese Halbstarken-Manieren sind bei uns fehl am Platze. Wir sind hier schließlich immer noch in Charlottenburg und nicht im Wedding.«
Als seine Mutter wieder aus dem Zimmer gegangen war, öffnete Albert das Fenster einen Spalt breit, um Hotte, also Dieter, beim ersten Pfeifen hören zu können. Er stellte auch das Radio etwas leiser.
Wenig später hörte er das Hupen eines Autos: kurz-lang-kurz. Das war Hottes Pfeifzeichen, aber eben gehupt und nicht gepfiffen. Warum sollte nicht auch ein Autofahrer dieses Signal benutzen? Als sich das Hupen wiederholte, schaute Berti doch aus dem Fenster. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite stand ein dunkelgrauer Volkswagen. Am Steuer saß Dieter. Er hatte die Seitenscheibe heruntergekurbelt und winkte Albert zu. Albert hob anerkennend den Daumen und gab ein Zeichen, dass er gleich runterkommen würde. Mann, ein Ausflug im eigenen Wagen, das hatte Stil! Zwar war der VW nicht gerade ein Cadillac, aber die Mädchen in seiner Klasse würden schon Augen machen, wenn sie so vorbeifuhren.
Als er Minuten später aus der Haustür kam, begrüßte er Dieter überschwänglich: »Wo hast du denn die Karre her, Hotte? Tolle Sache!«
»Mach den Mund zu, Keule, die Milchzähne werden sauer und steig ein! Wir haben es eilig. Der Wagen ist von Eddy, dem Verlobten meiner Schwester. Ich soll was für ihn abholen, vom Sachsendamm.«
Dieter war Alberts bester Freund. Die Verwendung des Superlativs bester ist hier eigentlich überflüssig, denn genaugenommen war Dieter sein einziger Freund. Sie kannten sich seit der gemeinsamen Zeit in der Grundschule. Dieter war ein Jahr älter und kam als Sitzenbleiber in Alberts Klasse. Die Schule war einfach nicht sein Ding. Nach dem Unterricht teilten sie sich öfter Kuchenrinde für zehn Pfennig vom Bäcker und spielten auf leergeräumten Ruinengrundstücken Fußball. Dieter hatte einen echten Lederball. Das war damals ein Schatz, der ihn in der Nachbarschaft sehr beliebt machte. Mit dem Ball verbrachte Dieter viel Zeit, lernte immer neue Tricks. Beim Dribbeln hatte Albert kaum eine Chance gegen ihn. Er spielte dann eine Weile in einer Jugendmannschaft von Tennis Borussia. Der Trainer hielt ihn für ein Talent, dem es aber noch an der notwendigen Disziplin mangelte. Da hatte er wohl Recht. Mit sechzehn wurde Dieter das Vereinstraining zu langweilig. Die ewige Kritik des Trainers nervte ihn. Außerdem hatte er angefangen zu rauchen, was seiner Kondition nicht gut bekam.
Dass er seine Fußballschuhe wenig später endgültig an den Nagel hängte, hatte auch mit Horst Buchholz zu tun. Von dem stammte auch der Spitzname Hotte. Man konnte ihm kein größeres Kompliment machen, als ihm eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Schauspieler zu attestieren. Horst Hotte Buchholz war sein Idol, seit er ihn im Film Die Halbstarken gesehen hatte. Eigentlich schon bevor der Film in die Kinos kam, denn einige Szenen des Films waren an der Tankstelle, wo er arbeitete, gedreht worden. Hotte Buchholtz spielte in den Halbstarken einen Tankwart. Drei Tage war die Filmcrew vor Ort mit den Aufnahmen beschäftigt. Im Film dauerte die Szene dann nur ein paar Minuten. Dieter hatte sich den Film vier Mal angeschaut. Leider war er selbst nicht im Bild präsent, aber die Tankstelle von Otto Ziege war deutlich zu erkennen.
Dieter hörte immer amüsiert zu, wenn Albert von Camus und Sartre erzählte. Er hatte dazu aber seine eigene Meinung und kommentierte die existenzialistischen Sprüche auf seine Art. Zu dem Sartre-Zitat ‚die Hölle, das sind die anderen‘ bemerkte er zum Beispiel: »Weißt du, Berti, die anderen sind nur die Hölle, wenn du alles mit dir machen lässt. Aber dann bist du auch selbst schuld. Man darf sich nicht alles gefallen lassen.«
Eigentlich konnte Dieter mit dem ganzen philosophischen Gequatsche wenig anfangen und nahm es nicht für voll. Das war eine Wichtigtuerei von Bücherwürmern und nichts Reales. Man konnte Camus-Sprüche immer so oder so sehen. ‚Der Mensch ist zur Freiheit verdammt‘: Man ist höchstens dazu verdammt, eine schnelle Mark zu machen, und wer genügend Kohle hat, für den ist Freiheit auch kein Problem. ‚Die Sinnlosigkeit des Lebens‘: Was sollte das bedeuten? Man muss sehen, wo man bleibt und wie man zu Geld kommt. Sinnlos ist das Leben nur, wenn man keine Kohle hat. Denn mit dem nötigen Kleingeld konnte man alles bekommen, was im Leben wichtig war: Klamotten, Autos, Mädchen. Und man konnte am Swimmingpool in der Sonne liegen mit einem Cocktailglas in der Hand. Das war doch genug Sinn für ein Leben oder etwa nicht?
Richtig begeistern konnte sich Dieter nur für handfeste Dinge, zum Beispiel für Bluejeans. Hier war die Sache für ihn klar: »Es gibt nur drei Sorten, die was taugen, die echte Bluejeans sind und zwar die von Levi‘s, Wrangler und Lee. Der Rest ist Scheiße! So was würde ich nie über meinen Hintern ziehen. Dann lieber in Unterhosen rumlaufen!«
Dann war da noch die Frage nach dem Schnitt der Hosenbeine: Bootcut oder Straight Cut? Auch hier war die Sache für Dieter klar: »Bootcut ist für Schlappschwänze. Horst Buchholz würde bestimmt nie Bootcut anziehen oder hast du jemals James Dean mit Bootcut Jeans gesehen? Höchstens, wenn er mal reiten geht.«
Albert verstand nicht so recht, was denn der Unterschied zwischen den Marken sein sollte. War nicht die Hauptsache, dass man überhaupt eine Jeans anhatte? Es hieß in den Ausflugslokalen doch immer: Mit Nietenhosen kein Zutritt bei Tanzveranstaltungen. Die Marke war da doch egal. Mit einer Jeans gehörtest du nicht mehr zu den Spießern, sondern warst auf der richtigen Seite. Er war froh, sich überhaupt eine Jeans leisten zu können.
»Hotte, weißt du, wo ich gestern war?«
»Nee, woher soll ich das wissen«.
»Gestern war ich in der Filmbühne am Steinplatz.«
»Oh ja, ich hätte es mir denken können.«
Albert ging immer in die Filmbühne am Steinplatz. Der Kinosaal war zwar etwas schäbig und die Luft war auch nicht immer die Beste, besonders wenn alle Plätze besetzt waren. Aber dafür gab es hier Filme, die man sonst in Berlin nicht zu sehen bekam, wie italienischen Realismus, französische Gangsterfilme und Hollywoodklassiker. Viele Filme wurden im Original mit Untertiteln gezeigt.
»Da lief ein Film auf Französisch mit Untertiteln, Fahrstuhl zum Schafott hieß der. Der Film ging gerade los, da höre ich hinter mir zwei Mädel zetern: ‚Scheiße, der is‘ ja ausländisch, warum hast du das denn nicht gesagt. Ich kann doch kein Italienisch oder so was und ich wollte einen Film glotzen. Wenn ich lesen will, geh‘ ich in die Bibliothek‘. Darauf sagt die andere: ‚Du weißt doch gar nicht, wo die ist!‘. Dann kichern beide los. Dann sage ich: ‚Ruhe, bitte, wir wollen den Film sehen, und der ist auf Französisch!’. Da knurrt die Blonde mich an: ‚Und du kannst mich auch mal Französisch!‘ Da lachte das halbe Kino. Dann war aber Ruhe im Karton.«
Wenn es um Filme ging, konnte sich Albert richtig begeistern: »Der Film fängt an mit Großaufnahmen von Paris in der Abenddämmerung. Und dann kommt Jeanne Moreau. Eigentlich ist sie nicht mein Typ, viel zu alt, bestimmt schon über fünfundzwanzig, aber dieser Mund und dieser Blick. Jedenfalls, sie und ihr Lover wollen ihren Alten beseitigen, weil der die Kohle hat und drauf sitzt. Die alte Geschichte eben. Sie haben einen todsicheren Plan, aber dann geht eben doch was schief, nur eine Kleinigkeit, ein dummer Zufall. Der Lover muss noch mal zurück und bleibt im Fahrstuhl stecken. Und Jeanne wartet und wartet und sucht ihn in allen Kneipen und Cafés. Sie durchstreift ihr Revier und dazu tolle Musik, nur Trompete. Ihr Freund kommt irgendwie raus aus dem Fahrstuhl und beinahe geht noch alles gut, aber dann findet die Polizei Fotos von Jeanne mit dem Lover und weiß Bescheid. Dumm gelaufen. Ich muss unbedingt mal nach Paris!«
»Hört sich ein bisschen langweilig an«, sagte Dieter. »Ich schaue mir lieber Filme an, wo mehr passiert.«
Der Volkswagen bog an der Leibnizstraße nach rechts in Richtung Norden ab.
»Müssen wir nicht nach Süden fahren?«, wunderte sich Albert. »Der Sachsendamm ist doch in Schöneberg.«
»Wir fahren nicht zum Sachsendamm in Schöneberg, der heißt doch nur so«, grinste Dieter ihn an. »Wir fahren zum richtigen Sachsendamm, dahin, wo die Sachsen sind «
Albert verstand nur Bahnhof.
»Na, wir müssen zur Badstraße im Wedding, da wo unsere Brüder und Schwestern aus der Ostzone Bananen und Perlonstrümpfe kaufen und sich die Nasen an den Schaufensterscheiben plattdrücken. Da hörst du nur Sächsisch oder so was Ähnliches, alles voller Kaffeesachsen, deshalb eben Sachsendamm. Wir müssen da ein paar Schuhe abholen.«
Die Badstraße im Bezirk Wedding wurde in keinem Berliner Reiseführer erwähnt. Das war durchaus verständlich, denn es gab hier keine touristischen Sehenswürdigkeiten, sieht man einmal von der von Friedrich Schinkel um 1835 erbauten Vorstadtkirche Sankt Paul ab. Die war nach starker Kriegszerstörung gerade wieder aufgebaut worden. Sonst war die Badstraße eine ziemlich hässliche Vorstadtstraße und immer noch mit Trümmergrundstücken gespickt. Dennoch stellte sie für viele Besucher aus dem Osten eine Hauptattraktion in West-Berlin dar, oder wie es ein zeitgenössischer Zeitungsartikel ausdrückte: ein Traumland für Tausende. Die Menschen, die jeden Tag aus dem Ostsektor in die Badstraße strömten, wollten einkaufen und sich vergnügen. Wohl kaum ein Besucher interessierte sich für den Schinkel-Bau oder machte sich Gedanken darüber, wie die Straße zu ihrem Namen gekommen war. Es erinnerte auch nichts mehr an das Heilbad, das Luisenbad, das der Gegend einmal den Namen Gesundbrunnen und der Oranienburger Chaussee den Namen Badstraße verschafft hatte. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts existierte nahe des Flüsschens Panke eine Kuranlage mit einem Park und einer Heilwasserquelle, die vom Berliner Bürgertum gerne besucht wurde. Dann siedelten sich Gerbereien am Oberlauf der Panke an und verwandelten den idyllischen Bach in eine Kloake. Damit war der Kurbetrieb ruiniert. Für die Besitzer hielt sich der Schaden jedoch in Grenzen, denn sie konnten den Park in der Folge parzellieren und als Bauland verkaufen. Die Heilquelle wurde zugeschüttet.
Auf wundersame Weise hatten gerade die Kriegszerstörungen den wirtschaftlichen Aufschwung der Badstraße nach der Währungsreform beflügelt. Der Bombenhagel schuf Platz in der engen Straßenschlucht. Sobald die Trümmer beiseite geräumt waren, breiteten Händler auf den Freiflächen ihr Warenangebot aus. So etablierte sich die Badstraße als Zentrum des Grenzhandels. Hier konnten Ostdeutsche verkehrsgünstig und in Grenznähe all das finden, was in der DDR Mangelware war: Reißverschlüsse und Petticoats, Bananen und Räucheraal, vergoldete Trauringe für fünf und Kleider für zehn D-Mark-West und vieles andere.
Ganze Ladenstraßen entstanden, wie der Badmarkt mit zwei Geschäftszeilen, die tief in den Baublock zwischen Stettiner und Grünthaler Straße hineinreichten. Daneben gab es sogar einen Rummelplatz mit Karussell und Losbuden. Nach und nach wurden die einfachen Marktstände durch stabilere Flachbauten ersetzt. Kinos wie das Humboldt, das Neue Alhambra oder das Corso begannen schon vormittags mit ihren Vorstellungen und schlossen erst spät in der Nacht. Das Café Reichelt oder das Café Pinguin luden zu Verschnaufpausen bei der Schnäppchenjagd ein.
Dieter parkte den VW direkt gegenüber vom Eingang zum Badmarkt, stieg aus dem Wagen und überquerte die Straße. Auf dem Badmarkt war immer einer von Eddys Geldwechslern unterwegs. Eddy hatte Dieter beauftragt nachzusehen, ob alles in Ordnung war. Seine ambulanten Geldwechsler hatten natürlich keine amtliche Genehmigung und zahlten auch keine Steuern. Deshalb waren ihre Kurse auch günstiger als die der offiziellen Wechselstuben. Aber man musste immer vor Kontrollen auf der Hut sein. ‚Bei einem guten Geschäft machen alle ihren Schnitt‘, hatte Dieter von Eddy gelernt. ‚Du musst nur aufpassen, dass unbeteiligte Schnorrer nicht die Hand aufhalten‘. Mit den unbeteiligten Schnorrern meinte Eddy vor allem Konkurrenzbanden, Denunzianten, den Fiskus und andere staatliche Organe.
Heute tauschte Micha für Eddy auf dem Badmarkt Ost gegen West zum Tageskurs. Als er Dieter aus dem VW steigen sah, gab er ihm ein Zeichen. Dieter nickte kurz und die beiden Männer trafen sich wenig später in einer geschützten Ecke des Grundstücks.
»Hallo Micha«, sagte Dieter. »Alles OK? Wie läuft das Geschäft? Ich hab‘ Westgeld dabei, falls du noch was brauchst, aber die Ostscheine kann ich dir nicht abnehmen, weil ich was anderes zu tun habe: jede Menge Schuhe einsammeln, Auftrag vom Chef.«
»Nee, ist nicht nötig«, antwortete Micha. »Alles in Butter. Aber ich hätte da vielleicht ein paar Ausweise für dich. Sollte aber auch ein bisschen was für mich dabei herausspringen.«
»Na klar, fünf Mark Provision sind immer drin.«
»Also einen Zehner für ´ne Ostpappe fänd‘ ich schon angemessen. Du kannst zwei Stück auf einmal kriegen.«
»Sagen wir fünfzehn DM, wenn ich beide bekomme. «
»Na, OK. Siehst du das Pärchen da drüben beim Fischstand, den Mann mit der Schirmmütze und dem Koffer und die Dürre mit dem grauen Faltenrock? Die sind gerade rübergekommen, frisch von der LPG aus Dessau oder so. Die brauchen Geld. Denen läuft beim Anblick des Räucheraals schon das Wasser im Mund zusammen.«
Dieter ging rasch zu dem Paar aus Dessau, das etwas hilflos auf das überbordende Warenangebot der Marktstände schaute. Schnell wurde er mit ihnen handelseinig: fünfundzwanzig Mark für einen Ausweis, also fünfzig für beide. Hier im Westen brauchten sie die DDR-Dokumente nicht mehr. Auf der Flüchtlingsstelle in Mariendorf konnten sie sich auch mit anderen Papieren legitimieren und würden gleich einen vorläufigen West-Ausweis erhalten. Den alten Ost-Ausweis zog man dort gleich ein. Also, warum nicht noch etwas Startgeld mitnehmen?
Dieter war zufrieden. Er würde von Eddy und seinem Kompagnon, dem Spanier, einhundert D-Mark für zwei Ostausweise bekommen. Die brauchten die Ostpapiere dringend für ihr lukratives Kerngeschäft, das darin bestand, Fotoapparate in den Westen zu schmuggeln. Wenn er die fünfzig DM für das Pärchen und die fünfzehn D-Mark Provision für Micha abzog, blieben ihm fünfunddreißig Mark Reingewinn netto. Das war beinahe so viel wie er mit seinem Halbtagsjob an der Tankstelle mit Nachtzuschlag in einer Woche verdiente; und das ganz nebenbei und auf die Schnelle. So läuft ein gutes Geschäft, dachte Dieter. Jeder macht seinen Schnitt!
Albert hatte die ganze Zeit im Auto gewartet: »Ich dachte, wir sollen noch vor Ladenschluss irgendwelche Schuhe abholen.«
»Ja, ja, komm schnell. Wir gehen erst mal zu Piko.«
Das Piko-Schuhgeschäft lag wenige Häuser weiter in einem einfachen Flachbau, der eilig in einer Kriegslücke errichtet worden war. Schon von weitem sah man den Werbespruch, der die ganze Breite der Fassadenfront einnahm: Piko-Schuhe kaufen - billiger als barfuß laufen!
Sie betraten den Laden. Dieter flüsterte der Verkäuferin zu, dass sie von Eddy kämen ‚wegen der alten Schuhe‘. Die junge Frau gab ihnen einen Wink, mit nach hinten in den Lagerraum zu kommen. Dort standen zwei große Kartons, die bis zum Rand mit gebrauchtem Schuhwerk gefüllt waren. Es waren die Hinterlassenschaften der Kunden aus dem Osten, die ihre neuen Schuhe gleich angezogen hatten. Sie wollten keinen Ärger mit dem ostdeutschen Zoll riskieren. Ihre alten Paare ließen sie deshalb einfach im Geschäft zurück. Die Verkäuferin war offensichtlich froh, die alten Treter loszuwerden.
»Was macht ihr denn mit den ollen Latschen?«, fragte sie interessiert.
»Na ja, ist für einen guten Zweck, Rotes Kreuz und so«, antwortete Dieter; und das mit dem Roten Kreuz war nicht mal gelogen.
»Dann bis zum nächsten Mal und schöne Grüße an Eddy.«
Dieter verkniff sich ein Grinsen. Der Schöne Eddy hatte den Dreh bei den Frauen einfach raus. Sie taten ihm gerne einen Gefallen.
Albert und Dieter gingen noch zu Bären-Stiefel und Schuh Feldmann, wo sie zwei weitere Säcke mit Altware einsammelten. Damit war die Arbeit in der Badstraße erledigt. Dieter war bester Laune wegen des Geschäfts mit den Ausweisen.
»Berti, jetzt gehen wir zu Aschinger, aufn‘ Bier und `ne Bockwurst. Oder wart mal! Ich weiß was Besseres. Vorne an der Ecke gibt es Currywurst. Hast du schon mal `ne Currywurst gegessen? Schmeckt echt Spitze, schön scharf, brennt richtig auf der Zunge. Danach gehen wir noch ins Kino. Ich lad‘ dich ein!«
»Danke, Hotte! Du hast heute wohl die Spendierhosen an. Eine Currywurst wollte ich schon immer mal probieren. Sieht ja komisch aus mit dem roten Zeug drauf, aber soll Klasse schmecken.«
Wenig später standen sie an einem der Stehtische vor der Imbissbude, aßen Currywurst mit Brötchen und tranken dazu Schultheiss Bier. Dieter erzählte zwischen den Bissen von dem Film, den er unbedingt sehen wollte: »Im Neuen Alhambra spielen sie einen tollen Horrorfilm Die Rache des Ungeheuers. Das ist die Fortsetzung vom Schrecken des Amazonas. Da ist so ein Fischmensch aus der Urzeit, der sieht echt gruselig aus mit Schuppen und Flossen. Der erwürgt die halbe Expeditionstruppe, bis er sich in die junge Wissenschaftlerin verguckt mit seinen Glupschaugen. Das war natürlich ein Fehler. Zum Schluss wird er abgeknallt und verschwindet in der Tiefe. Aber anscheinend eben doch nicht ganz erschossen, denn jetzt ist er ja wieder da und rächt sich.«
Das Kino war bereits gut gefüllt, als sie den Saal betraten. Die Luft war abgestanden. Kein Wunder, denn seit elf Uhr vormittags hatte es ununterbrochen Vorstellungen gegeben. In der dritten Reihe fanden sie noch zwei zusammenhängende, freie Sitze. Als es wenig später dunkel im Saal wurde, waren fast alle Plätze besetzt. Die meisten Besucherinnen und Besucher kamen aus dem Osten. Sie zahlten nur 50 Pfennig Westgeld, die Hälfte des regulären Eintrittspreises. Das Neue Alhambra war eines der sogenannten Grenzkinos, die speziell auf Gäste aus dem sowjetischen Sektor ausgerichtet waren. Die Kinobetreiber erhielten von Senat Steuernachlässe für die verbilligten Eintrittskarten.
Albert fand den Film nur mäßig spannend, während Dieter begeistert war. Zum Schluss verschwand das Ungeheuer wieder tödlich getroffen in der Tiefe. Aber eben doch nicht ganz tot, denn im nächsten Jahr kam noch eine Fortsetzung heraus: ‚Das Ungeheuer ist unter uns‘.
Nach dem Kinobesuch brachten sie die eingesammelten Schuhe noch zu Dieters Schwester.
»Wo habt ihr euch denn so lange rumgetrieben? Ich sitze hier wie auf Kohlen. Ich muss doch die Schuhe noch zurechtmachen. Die sollen doch morgen abgeholt werden. Jetzt müsst ihr mir gefälligst beim Sortieren und Putzen helfen, sonst sitz‘ ich hier bis morgen früh.«.
Da Monika sehr energisch werden konnte, traute sich Dieter nicht zu widersprechen. Die Jungen stellten die passenden Schuhpaare zusammen. Dann sortierte Monika die Paare in drei Kategorien. Die am besten erhaltenen Paare wurden noch schnell gesäubert und geputzt. Sie gingen an das schwedische Rote Kreuz. Die Schweden zahlten bis zu drei Mark für ein gutes Paar. Weitere brauchbare Paare gingen für ein paar Pfennige an andere Organisationen. Der Rest wanderte in den Müll.
»Wieder ein gutes Geschäft, wo jeder seinen Schnitt macht«, sagte Dieter, als er Albert nach Mitternacht zurück in die Mommsenstraße fuhr. »Die aus der Zone und die Händler sind die alten Schuhe los, und wir verdienen noch ein paar Mark. Ist eine Idee von Eddy. Der Kerl ist echt clever. Der weiß, wo das Geld auf der Straße liegt. Man muss es nur noch aufheben.«