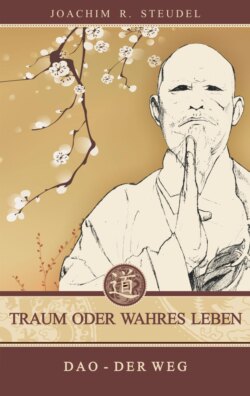Читать книгу Traum oder wahres Leben - Joachim R. Steudel - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Verzweiflung
ОглавлениеEin steiler, durch den anhaltenden Nieselregen schlüpfriger Weg führte in vielen Windungen den Berg hinauf. Mit zügigen und dennoch sicheren Schritten strebte ein etwa dreißigjähriger Mann auf diesem dem Gipfel entgegen. Nur noch wenige Meter trennten ihn vom höchsten Punkt, als der schmale Pfad um einen leicht vorspringenden Felsgrat bog. Nachdem er diese nicht ganz ungefährliche Stelle passiert hatte, wurde der Blick frei auf eine kleine Terrasse. Bei schönem Wetter konnte man von dieser Stelle aus weit ins Land schauen, doch an diesem Tag war durch das neblige und regnerische Wetter die Sicht bis auf wenige Meter eingeschränkt. Am Rand dieses überhängenden Felsstückes, nur eine Handbreit vom Abgrund, stand eine junge Frau. Die nassen, verklebten Haare hingen ihr ins Gesicht und an ihrer durchnässten Kleidung konnte man erkennen, dass sie schon länger hier stand.
Ungehört von der Frau ging der Mann zu der etwas überhängenden Felswand, die in einem leichten Halbkreis den hinteren Teil dieses Ortes umrahmte. Nachdem er sie eine Weile beobachtet hatte, durchbrach er die Stille.
»Warum wollen Sie Ihr Leben wegwerfen, es hat doch gerade erst begonnen?«
Erschrocken fuhr die Frau herum und wäre dabei beinahe abgerutscht. Das Gleichgewicht wieder erlangend und einen Schritt vom Abgrund zurückweichend, schaute sie den Mann mit weit aufgerissenen Augen an.
Sein schon fast ganz ergrautes Haar schien seltsamerweise noch vollkommen trocken zu sein. Groß und schlank gewachsen, strahlte er eine Ruhe aus, wie sie es noch nie gespürt hatte. Auf einem Bein stehend, das andere angewinkelt an der Felswand, schaute er ihr freundlich lächelnd in die Augen. Dieser Blick hielt sie für kurze Zeit gefangen.
»Wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Wie lange stehen Sie schon hier?«
Er lachte fast unhörbar.
»Mein Name tut hier nichts zur Sache. Sie kennen mich ja doch nicht.«
»Noch nicht!«, fügte er lächelnd hinzu. Tief sog er die frische, feuchte Luft ein und sie hatte den Eindruck, dass er bis in ihr Innerstes sehen konnte.
»Ich stehe schon lange genug hier, um Ihre Absicht zu kennen. Ehrlich gesagt ist es genau das, was mich hierher geführt hat.«
»Was wissen Sie schon von meinen Absichten und was geht Sie das an?!«
Wütend drehte sie sich zum Abgrund um, und ein wenig leiser fügte sie hinzu: »Sie haben doch keine Ahnung! Für Sie scheint das Leben in Ordnung zu sein.«
Ihre Gedanken rasten und setzten fort, was sie laut ausgesprochen hatte.
»Aber für mich ist es nicht mehr lebenswert. Ich habe alles verloren, selbst zerstört! Ich habe ja selbst keine Achtung mehr vor mir, wer sollte mich denn noch mögen nach dem, was ich getan habe!?«
Tränen mischten sich ins Regenwasser, das ihr im Gesicht herunterlief. Traurig und tief verletzt stand sie da und wagte doch nicht, diesen einen Schritt zu tun. Der Zwiespalt in ihrem Inneren war riesig, sie schämte sich, fühlte sich ausgenutzt, ekelte sich vor sich selbst. Und doch wehrte sich ihr Verstand, ihre Seele gegen die Selbstvernichtung.
»Sicherlich sieht es so aus, als ob das Leben für mich in Ordnung wäre, aber das war nicht immer so. Auch ich wollte meinem Leben am liebsten ein Ende setzen, und glauben Sie mir, es war zwar aus einem anderen Grund, aber für mich war in diesem Moment das Leben auch nicht mehr lebenswert. Doch nichts auf dieser Welt kann rechtfertigen, dass jemand sein Leben wegwirft. Ich denke, ich weiß wovon ich spreche, denn ich habe genug erlebt. Und das, weswegen Sie Ihr Leben wegwerfen wollen, ist es nicht wert, diesen Schritt zu tun! Nicht Sie müssen sich schämen für das, was Sie getan haben, sondern die, die Sie ausgenutzt und benutzt haben! Eigentlich sind Sie doch ein Opfer, das Opfer des Bedarfs, der Wünsche und Fantasien anderer.«
Langsam, wie die Tropfen des Regens, drangen die Worte in sie ein und nur zögernd wurde ihr bewusst, dass er sprach, als ob er all ihre Gedanken kennen würde. Sie drehte sich wieder um, sah ihn mit ihren verweinten, tieftraurigen Augen an und versuchte zu ergründen was, wie viel und woher er es wusste.
»Ich kenne Sie nicht und doch sprechen Sie so, als ob Sie alle meine Gedanken kennen würden. Woher wollen Sie wissen, warum ich hier stehe, weshalb ...«
Plötzlich durchzuckte ein Gedanke ihr Gesicht, ihre Augen blitzten auf und zornig, aggressiv, ja feindselig fuhr sie ihn an.
»Außer«, sie dehnte die Worte und wirkte wie ein Panther vor dem Sprung, »außer, Sie sind auch einer von denen, die sich diesen Dreck anschauen und sich dran aufgeilen!«
Lauernd sah sie ihn an und wartete auf seine Reaktion. Doch diese fiel ganz anders aus, als sie erwartet hatte. »Eine logische Schlussfolgerung, doch weit daneben. So ohne Weiteres können Sie es doch nicht verstehen. Aber vielleicht sollte ich Ihnen eine Geschichte erzählen, damit Sie das Leben, auch Ihr Leben, besser verstehen. Ihr Zorn ist verständlich, da Sie sich ausgenutzt und missbraucht fühlen und doch haben Sie es freiwillig und bei vollem Bewusstsein der Folgen getan. Eine Zeitlang hat es Ihnen ja auch Freude bereitet. In meinen Augen ist auch nichts Verwerfliches dabei, solange man seiner Seele keinen Schaden damit zufügt. Viel schöner und erfüllender ist es aber, wenn es aus Liebe geschieht.«
»Woher …«, zögernd und immer noch ablehnend kamen die Worte über ihre Lippen, »woher wissen Sie das alles, mit wem haben Sie gesprochen, wer hat Ihnen das alles über mich erzählt?«
Halblaut, mehr zu sich gesprochen, fügte sie noch hinzu: »Aber eigentlich, eigentlich habe ich doch mit keinem darüber gesprochen?! Keiner weiß, wie ich mich fühle, was mich bewegt, wonach ich mich sehne.«
Ihre Augen wurden wieder feucht.
»Nein! Sie haben mit keinem darüber gesprochen, haben alles in Ihrer Seele eingeschlossen! Sie schämen sich. Sehen in jedem Blick Ablehnung. Haben das Gefühl, dass andere Sie verachten und sind verbittert, weil Sie denken, alle reden schlecht von Ihnen. Doch die, die am meisten mit dem Finger auf Sie zeigen und lästern sind vielleicht die Schlimmsten, und schauen voller Wollust, zwischen den Fingern, genau hin. Eigentlich sollten die Menschen nur über andere richten, wenn sie es selbst besser machen, eine Lösung für einen Konflikt haben oder ein leuchtendes Vorbild sind. Doch leider ist das nicht so!«
Eine kurze Pause entstand, in der er sich an solche Gegebenheiten erinnerte.
»Sie quälen sich und finden doch keinen Ausweg. Doch solange Sie sich so vor allen anderen verschließen, spüren diese Ihre Ablehnung, Ihre Distanz und die, die Sie mögen und Ihnen helfen könnten, finden keinen Weg zu Ihnen.«
Langsam löste er sich von der Felswand, ging zwei Schritte zur Seite und setzte sich dort auf einen Felsblock.
»Kommen Sie, setzen Sie sich mit hierher. Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen. Ob diese Geschichte wahr ist und von einem gelebten Leben handelt oder ein Traum, spielt keine Rolle. Hören Sie einfach nur zu und wenn Sie dann immer noch in Selbstmitleid versinken möchten, werde ich Sie nicht mehr stören. Dann können Sie springen oder auch ewig hier stehen bleiben.« Sie zögerte. »Bitte, bitte kommen Sie.«
Immer noch verblüfft über das nachdenkend, was sie soeben gehört hatte, ging sie langsam auf ihn zu. Sie konnte es sich nicht erklären, woher wusste er das alles, wie konnte er so über sie und mit ihr sprechen, obwohl sie sich nicht kannten. Und doch flößte er ihr fast uneingeschränktes Vertrauen ein. Sie fühlte sich viel ruhiger und entspannter. In seinen Worten hatte sie all ihr Leid und ihre Verzweiflung wiedergefunden, und wie von einer unsichtbaren Macht gezogen setzte sie sich neben ihn auf den Felsblock.
Erschrocken sprang sie im nächsten Augenblick wieder auf. Der Stein hätte nass und kalt sein müssen und doch war er trocken und angenehm warm, so, als hätte die warme Sommersonne ihn wunderschön aufgeheizt. Verblüfft schaute sie zum Himmel. Die Wolkendecke war aufgerissen und aus einem kleinen Loch, nicht viel größer als die Sonnenscheibe, lachte sie diese an. In ihren Kopf wirbelte alles durcheinander. Es war doch eigentlich gar nicht möglich, eben hatte es noch geregnet und alles um sie herum und an ihr triefte nur so vor Nässe, wie konnte da dieser Felsblock trocken und warm sein?! Ihr wurde langsam unheimlich, und noch einen Schritt zurückweichend, sah sie zu diesem seltsamen Mann hinunter. Doch er streckte nur seine Hand nach ihr aus und forderte sie nochmals auf, sich zu setzen. Sie konnte nicht widerstehen, nahm seine Hand und ließ sich auf dem Stein nieder. Eine angenehme Wärme durchströmte sie, ihr wurde leicht ums Herz und sie spürte, dass sie keine Furcht vor ihm haben musste.«
Langsam, in seinem Gedächtnis alles ordnend, begann der Mann zu sprechen.
»Es begann vor über einem Jahr mit einem richtig großen Familienkrach. Ich hatte ein gutgehendes Handelsgeschäft mit über vierzig Angestellten aufgebaut und kurz zuvor das große Potenzial entdeckt, das im Handel mit den ehemaligen Ostblockländern, Polen, Russland und der Ukraine, steckt. Leider hatte ich dabei nicht bedacht, dass es dort einige Organisationen gibt, die an jedem Geschäft mitverdienen oder auch allein verdienen wollen. Kurz und gut, es dauerte nicht lange und ich bekam Besuch von einigen unsympathischen Männern. Diese drohten mir und stellten massive Forderungen. Ich fühlte mich im Recht, ließ mich nicht so leicht einschüchtern und wies ihnen, die Gefahr unterschätzend, die Tür. Als sie den Raum verließen, drehte sich ihr Anführer um und sagte zu mir, dass ich diesen Fehler bald bereuen würde. Ich lachte ihn aus und wies ihm zornig die Tür.«
Nachdenklich und kaum hörbar fügte er hinzu: »Wie oft habe ich das bereut, wie oft habe ich mich gefragt, was wäre, wenn ich damals nachgegeben hätte. Ja, was wäre, wenn?, wie oft habe ich mich das seitdem gefragt.«
Er schüttelte sich kurz und fuhr dann, diesen Gedanken unterdrückend, mit seiner Geschichte fort.
»Am selben Abend habe ich meiner Frau davon erzählt. Erschrocken, ja panisch vor Angst, hat sie mir Vorwürfe gemacht, hat mich eindringlich gebeten nachzugeben, das Geschäft mit diesen Ländern sein zu lassen. Immer wieder sagte sie zu mir: ›Es reicht doch, was wir mit dem Handel hier verdienen, wir sind vermögend, haben alles was wir brauchen, und es geht uns besser als all unseren Bekannten, warum kannst du es nicht dabei belassen?‹ Ich habe all ihre Bedenken beiseitegeschoben, hab sie ausgelacht und auf meinem Standpunkt beharrt. An diesem Abend haben wir uns total verstritten und sind ohne Versöhnung schlafen gegangen. Ich fühlte mich im Recht und bin sofort ruhig und fest eingeschlafen, doch sie ...«
»Was ist? Was haben Sie? Weshalb schauen Sie mich so an?«
Wieder war die junge Frau hochgesprungen, hatte sich losgerissen und schaute sich erschrocken um. Die Wolkendecke über ihnen war noch weiter aufgerissen. Über dem Berg war ein großes Stück blauer Himmel zu sehen und alles um sie herum machte einen freundlichen und friedlichen Eindruck. Rundherum konnte man in einiger Entfernung sehen, dass es dort immer noch neblig und regnerisch war. Nur hier in ihrer näheren Umgebung schien ein wunderschöner Sommertag zu sein. Zitternd vor Schreck sah sie den Mann wieder an und sagte: »Es ist alles so seltsam, dieser Wetterwechsel um uns herum, Ihr Auftreten, und dann, als ich die Augen geschlossen habe, ich ...«, sie stockte kurz, »ich hab Ihre Frau gesehen, ich war dabei, als Sie sich gestritten haben. Ich habe alles gesehen, den Zorn gespürt, Ihre Wohnung gesehen, alle Details. Es war … war, als ob ich neben Ihnen gestanden hätte. Es … es macht mir Angst, es war alles so realistisch!«
Wieder lächelte er sie an, streckte seine Hand nach ihr aus und sagte: »Sie brauchen keine Angst zu haben, es geschieht Ihnen nichts. Wenn ich Ihre Hand halte, können Sie nur meine Gedanken fühlen und dadurch alles richtig miterleben. Es hilft Ihnen, das Geschehen besser zu verstehen und Sie werden im Laufe der Geschichte auch noch begreifen, warum das so ist.«
Er machte wieder eine einladende Bewegung und zögernd, ihn genau beobachtend, griff sie zu. Sofort spürte sie die Wärme und Ruhe in sich eindringen und gab jeden Widerstand auf. Er fuhr fort, seine Geschichte zu erzählen, und abermals hatte sie den Drang, ihre Augen zu schließen. Sie gab nach und augenblicklich war sie wieder mitten im Geschehen. Sie hatte das Gefühl, über ihm zu schweben und gleichzeitig in ihm zu sein und all seine Gefühle zu teilen.
»Der Wecker klingelte, ich tastete im Dunklen nach ihm und schaltete ihn aus. Zurück ins Bett sinkend und langsam munter werdend, wanderten meine Gedanken zurück zum Vorabend. Der hässliche Streit und all die anderen Erlebnisse des Vortages kehrten in mein Gedächtnis zurück. Ich schaute zu meiner Frau und lauschte ihren Atemzügen. Ihr Atem war ruhig und gleichmäßig, als ob sie noch tief schlafen würde und doch hatte ich das Gefühl, dass das nicht so war. Das schwache Licht der Straßenlampe, die noch durch einige Bäume verdeckt wurde, reichte nicht aus, um mehr als ihre Umrisse zu erkennen. Ich hob meinen Kopf, um ihr Gesicht besser sehen zu können, doch dadurch konnte ich sie, da ich zwischen ihr und dem Fenster lag, nur noch schlechter erkennen.
Frustriert stand ich auf und ging ins Bad. Ich wollte sie nicht wecken und falls sie munter war, wollte sie anscheinend nicht gestört werden. Beim Zähneputzen ging mir der Vortag noch einmal durch den Kopf. Der Streit mit meiner Frau lag mir schwer auf der Seele. Ich hätte mich gerne mit ihr ausgesprochen, denn ich wusste, dass sie in vielem recht hatte. Aber ich war auch nicht bereit nachzugeben, denn es war für mich eine Sache der Ehre und des Prinzips, mich solchen Leuten nicht zu beugen. Wenn ich mich im Recht fühlte, konnte ich stur wie ein alter Esel sein, und ich wich um nichts von meinem Standpunkt ab. Wir waren lange genug zusammen, sodass sie das auch wusste und ihr war klar, dass sie meine Meinung nicht ohne Weiteres ändern konnte.
Unsere Beziehung war schon seit einiger Zeit nicht mehr so harmonisch wie früher. Sie warf mir vor, zu viel Zeit und zu viele Gedanken ans Geschäft zu verschwenden und zu wenig Zeit für sie zu haben. Jetzt ist mir bewusst, wie recht sie damit hatte, denn alles ist vergänglich, nur die Erinnerungen bleiben und so war es nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.
Ich machte Frühstück, las die Zeitung und war in Gedanken schon wieder im Geschäft, als meine Frau die Küche betrat. Man sah ihr an, dass sie nicht erst aufgewacht und dass ihr Zorn noch nicht verraucht war. Schweigend setzte sie sich an den Frühstückstisch. Ich beobachtete sie und wusste im selben Moment, dass sie von allein beginnen musste, dass ich es nur noch schlimmer machen würde, wenn ich sie bedrängen würde. Schweigend saßen wir uns eine ganze Weile gegenüber und ich wurde langsam ungeduldig, schaute immer wieder verstohlen auf die Uhr, denn wenn ich pünktlich sein wollte, musste ich nun bald gehen. Es arbeitete in ihr und sie war wahrscheinlich kurz davor ihrem Herzen Luft zu machen, als ich es nicht mehr aushielt und sie ungeduldig ansprach: ›Gabi, entschuldige bitte, ich wollte dich gestern Abend nicht verletzen! Ich will auch keinen in Gefahr bringen und mir geht es im Prinzip auch nicht so sehr um die Gewinne aus diesen Geschäften. Aber wo kommen wir denn hin, wenn man sich von jedem erpressen lassen muss und irgendwelche Dahergelaufene einfach an unserer Hände Arbeit mitverdienen können, ohne einen Finger krumm zu machen! Ich sehe das nicht ein, und werde solchen Leuten auch niemals nachgeben!‹
Ich hatte mich wieder in Zorn geredet, holte tief Luft und fügte dann etwas ruhiger hinzu: ›Natürlich werde ich mich heute gleich noch mit der Polizei in Verbindung setzen, aber ich denke, dass die nur geblufft haben und auf Dummenfang sind.‹
Ich ahnte ja damals nicht, wie sehr ich mich geirrt hatte. Und in der Hoffnung, dass mit diesen Worten alles wieder in Ordnung wäre, fügte ich hinzu: ›Bist du mir wieder gut? Es macht mich krank, wenn ich nicht mit dir reden kann! Ich möchte doch nur, dass du mich verstehst. Ach Gabi, ich brauch dich und dein Verständnis doch!‹
›Ach ja, du brauchst mein Verständnis? Seit wann denn das? Du willst doch nur, dass ich zu allem schön Ja und Amen sage! Seit wann interessiert es dich denn, was ich denke und fühle? Du kommst nach Hause, erzählst mir von deinem Stresstag, was jener gesagt, der getan hat, welche Probleme du hattest und wie du sie gelöst hast. Dann teilst du mir noch so ganz nebenbei mit, dass du erpresst wirst und zwar mit massiven Drohungen auch gegen deine Familie. Und dann, dann willst du das mit solchen Bemerkungen wie ‚Ich werde es der Polizei melden.‘ oder ‚Ich werde mich solchen Leuten nicht beugen.‘ abtun!? Einfach wegwischen und zur Tagesordnung übergehen?! Was glaubst du eigentlich, wer oder was du bist, dass du einfach so über diesen Dingen stehen kannst? Ich jedenfalls fühle mich bedroht und habe Angst!‹
Sie holte tief Luft.
›Ich möchte, dass du mir jetzt genau zuhörst! Also, entweder gibst du denen nach und bezahlst, lässt diese Geschäfte sausen und gehst dem Ganzen damit aus dem Weg, oder‹, sie holte tief Luft und fuhr mit bedrückter Stimme fort, ›oder ich werde dich verlassen!‹
Sie sah mir in die Augen, und an ihrem Blick konnte ich erkennen, dass es ihr bitter ernst war mit diesen Worten. Total überfordert fing ich an nach Ausflüchten zu suchen.
›Gabi, bitte, ich will euch, will uns nicht in Gefahr bringen! Ich denke ganz einfach nur, dass diese Leute nur bluffen und versuchen, auf eine einfache und leichte Art und Weise ans Geld zu kommen. Ich werde ...‹
Zornig unterbrach sie mich.
›Siehst du, du fängst schon wieder an, das Ganze zu verharmlosen! Aber so einfach kommst du mir diesmal nicht davon! Ich hab dir drei Möglichkeiten genannt. Und glaub mir, ich habe die ganze Nacht lang gründlich darüber nachgedacht und ich möchte jetzt eine Antwort und nicht erst, wenn es zu spät ist! Ich hoffe, du hast das jetzt verstanden!‹
Sie wurde immer wütender, stand auf und lief, ohne mich dabei aus den Augen zu lassen, wie ein gefangener Tiger am Tisch hin und her. Nach ein paar weiteren, sinnlosen Versuchen sie zu beruhigen und eine Entscheidung zu verschieben trat ich, um Zeit zu gewinnen, die Flucht an.
›Bitte, Gabi, können wir uns heute Abend noch mal in Ruhe darüber unterhalten? Ich muss jetzt weg, ich komme sowieso schon zu spät zur Arbeit. Ich möchte jetzt nicht so unter Zeitdruck darüber reden. Vielleicht ist es auch besser, wenn wir beide noch mal alles in Ruhe überdenken. Ich werde noch mal ...‹
Sie war stehen geblieben und unterbrach mich mit einem traurigen Unterton in der Stimme: ›Heute Abend werde ich nicht mehr da sein! Entweder du entscheidest dich jetzt oder ich fahre dann mit Maria und Torsten zu meinen Eltern.‹
Fragend sah sie mich an und als ich nicht gleich antwortete fuhr sie fort: ›Gut, du willst nicht nachgeben. Aber ich gebe diesmal auch nicht nach!‹
Ihre Augen bekamen einen feuchten Schimmer.
›Okay, ich hab das Handy ja immer dabei, solltest du dir’s doch noch anders überlegen, kannst du mich ja anrufen. Ansonsten ist jetzt erst mal alles gesagt.‹
Mit schnellen, energischen Schritten verließ sie den Raum. Verblüfft schaute ich ihr nach. So hatte ich sie ja noch nie erlebt, aber ich nahm ihre Drohung, mich zu verlassen, immer noch nicht ernst und so machte ich mich auf den Weg zur Arbeit.
Dort angekommen, empfing mich meine Sekretärin gleich mit den Worten:
›Ein Herr Igor hat schon mehrfach angerufen und nach Ihnen verlangt. Er hat seinen Nachnamen trotz Nachfrage nicht genannt, aber ich vermute, dass es einer der Herren war, mit denen Sie gestern gesprochen haben.‹
›Was wollte er denn?‹
›Das hat er mir nicht gesagt. Er wollte unbedingt mit Ihnen selbst sprechen. Er wird nachher noch mal anrufen.‹
›Danke.‹
Ich betrat mein Büro, ließ mich in meinen Sessel fallen, und nachdenklich strich ich mir über die Stirn. Warum war bloß alles so kompliziert? Ich war immer ehrlich und zum beiderseitigen Vorteil mit meinen Kunden umgegangen. Weshalb ich mir auch einen sehr guten Namen in der Branche gemacht hatte. Viele meiner Kontakte hatte ich Empfehlungen anderer Kunden zu verdanken, worauf ich auch sehr stolz war, und nun war ich plötzlich mit einem Problem konfrontiert, auf das ich überhaupt nicht vorbereitet war. Ich hatte den Kopf immer noch in meinen Händen vergraben und grübelte darüber nach, wie ich mich aus der Affäre ziehen könnte, als das Telefon klingelte. Ich richtete mich auf, strich die zerwühlten Haare glatt und meldete mich betont forsch:
›Ja!‹
›Herr Kaufmann, hier ist wieder dieser Herr Igor. Soll ich ihn durchstellen?‹
›Ja.‹
›In Ordnung, hier ist er.‹
›Ja, Kaufmann, was kann ich für Sie tun?‹
›Ooh, das wissen Sie ganz genau, Herr Kaufmann‹, sprach er mich in seinem harten, aber guten Deutsch an.
›Haben Sie noch einmal nachgedacht über unser Gespräch von gestern? Ich hoffe, Sie haben Ihre Meinung geändert und wir können nun, wie sagen Sie hier so schön, ‚Nägel mit Köpfen machen‘!‹
›Ja, ich habe noch einmal darüber nachgedacht!‹
Ich spürte wie der Zorn in mir aufstieg und musste mich sehr zusammennehmen, um ruhig und überlegt zu antworten.
›Aber an meiner Meinung hat sich nichts geändert. Ich lasse mich nicht erpressen, weder von Ihnen noch von anderen. Wenn Sie Geld verdienen wollen, suchen Sie sich einen Job oder bauen Sie sich selbst etwas auf, so wie ich, aber versuchen Sie nicht, auf Kosten anderer zu leben. Sie werden von mir nichts bekommen!! Und damit ist das Gespräch beendet!‹
Ich hatte den Hörer schon vom Ohr weggenommen, doch dann zog ich ihn zurück und fügte noch hinzu:
›Und belästigen Sie mich nicht wieder, es wird sich nichts an meinem Standpunkt ändern.‹
Bevor ich den Hörer wieder wegnehmen konnte, hörte ich ihn sagen: ›Gut, gut, ich habe es fast befürchtet. Aber wir werden ja sehen. Ich werde mich wieder melden, morgen, oder – ich denke – spätestens übermorgen. Bis bald!‹
Und mit diesen Worten legte er auf. Wütend schlug ich mit der Faust auf den Schreibtisch, knurrte einige halblaute Flüche vor mich hin und begann darüber nachzugrübeln, auf welche Weise mich dieser Igor dazu bringen wollte, seine Bedingungen zu erfüllen. Doch ich sollte nicht dazu kommen, meine Gedanken zu Ende zu bringen. Die täglichen Arbeiten standen an. Es kam ein Anruf nach dem anderen, der Vertreter eines unserer wichtigsten Lieferanten hatte einen Termin bei mir und meine Sekretärin erinnerte mich an den Mittagstermin in der Bank. Über all diesen Dingen hatte ich diesen Igor und mein Versprechen, mich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, schon fast vergessen. Weswegen ich auch sehr erstaunt war, als ich beim Verlassen des Büros von meiner Sekretärin mit den Worten aufgehalten wurde: ›Herr Kaufmann, die Polizei ist am Apparat und möchte Sie dringend sprechen.‹
Ich schaute auf die Uhr und sagte: ›Das passt mir jetzt eigentlich überhaupt nicht! Lassen Sie sich die Nummer geben und wenn ich wieder da bin, rufe ich zurück.‹
›Hab ich schon vorgeschlagen, doch sie behaupten, es sei dringend und sie müssten sofort mit Ihnen sprechen.‹
Widerwillig vor mich hin knurrend ging ich wieder in mein Büro, nahm das Gespräch aus der Musik und meldete mich mit den knappen Worten: ›Ja, Kaufmann, was kann ich für Sie tun?‹
Eine leicht verunsicherte Stimme antwortete: ›Ja, äh, Herr Kaufmann, hier spricht Hauptwachtmeister Schlichter, äh, ich ...‹
Ungeduldig unterbrach ich ihn: ›Herr Schlichter, wenn es nicht sehr dringend ist, möchte ich Sie bitten, das Gespräch vielleicht auf vierzehn Uhr zu verschieben, damit ich jetzt meinen Banktermin wahrnehmen kann.‹
Meine barsche, ungeduldige Art nahm ihm jede Hemmung und betont sachlich erwiderte er: ›Herr Kaufmann, ich denke es wäre besser, wenn Sie diesen Termin verschieben und erst einmal das Sonneberger Krankenhaus aufsuchen würden¸ denn ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Frau und Ihre Kinder einen schweren Verkehrsunfall hatten. Der Rettungsdienst müsste mittlerweile dort angekommen sein und ich werde, wenn die Ermittlungen hier vor Ort abgeschlossen sind, auch hinfahren.‹
Ich sank in meinen Bürosessel und fragte verständnislos: ›Unfall? Aber sie fährt doch immer so vorsichtig, besser als ich! Wie konnte das denn passieren, und wie geht es ihnen?‹
Ich schaute mit leeren Augen durch die offene Bürotür auf meine Sekretärin und nahm nur im Unterbewusstsein wahr, dass diese das Gespräch mitgehört hatte, denn erst in diesem Moment hatte ich den Hörer abgenommen und die Lautsprecherfunktion deaktiviert. Sie tat genau das, weswegen ich ihre Mitarbeit so schätzte, denn sie rief sofort die Bank an und verschob den Termin auf unbestimmte Zeit.
Währenddessen hatte mir der Polizist begreiflich gemacht, dass er am Telefon keine weiteren Auskünfte geben würde. Wie gelähmt bemerkte ich erst nach einer ganzen Weile, dass das Gespräch schon beendet war. Gedankenverloren legte ich den Hörer auf und suchte nach dem Autoschlüssel. Ich zog die Jacke an, klopfte die Taschen ab, sah dann den Schlüssel neben dem Telefon liegen, zog die Jacke wieder aus, nahm den Schlüssel, machte einige Schritte in Richtung Tür, bemerkte, dass ich nur im Hemd war und drehte brummend wieder um. Als ich in den zweiten Ärmel fuhr, verhedderte ich mich im Futter. Meine Sekretärin half mir und sagte:
›Wäre es nicht besser, wenn ich Sie fahre oder einen anderen Mitarbeiter damit beauftrage?‹
Wider besseres Wissen lehnte ich ab.
›Geht schon wieder. Danke für das Angebot, aber Sie werden hier gebraucht. Bitte sagen Sie alle weiteren Termine für heute ab‹, ich stockte kurz, ›und, vielleicht auch für morgen. Sagen Sie einfach ... ach, Sie machen das schon, Frau Wagner. Danke!‹
Ihr zunickend verließ ich das Büro.
Die Fahrt nach Sonneberg verlief wie im Traum. Nur einmal fuhr ich zusammen und kehrte für einige Augenblicke in meine Umwelt zurück. Lautes Hupen und das Quietschen blockierender Reifen auf dem Asphalt rissen mich aus meinen Gedanken. Ich hatte einem anderen PKW die Vorfahrt genommen. Schimpfend und gestikulierend kam der Fahrer dieses Autos zum Stehen. Ich konnte noch sehen, wie seine Beifahrerin mit schreckensstarrem Blick die Hände vors Gesicht schlug. Als mir klar wurde, dass ich ein Stopschild überfahren hatte, trat ich kurz auf die Bremse, doch da kein Schaden entstanden war, gab ich gleich wieder Gas. Durch diese Schrecksekunden fuhr ich eine Weile aufmerksamer weiter, doch lange hielt das nicht an. Als ich dann endlich vor dem Krankenhaus einen freien Parkplatz gefunden hatte, sprang ich aus dem Auto und lief hastig zum Empfang.
›Hallo, meine Frau und meine Kinder hatte einen Unfall und sollen gerade hier eingeliefert worden sein, können Sie mir sagen, wo ich sie finde?‹
Der Mann am Schalter lächelte und sagte: ›Guten Tag. Wenn Sie mir Ihren Namen oder den Ihrer Frau verraten, kann ich Ihnen vielleicht helfen.‹
›Entschuldigung. Ich heiße Kaufmann und die Polizei hat mich vor Kurzem angerufen und mir gesagt, dass meine Frau einen schweren Verkehrsunfall hatte und hierher gebracht worden ist.‹
Er tippte den Namen in seinen Computer ein und schüttelte dann bedauernd den Kopf.
›Ich habe hier noch keine Information über eine Frau Kaufmann! Im Moment haben wir gar keine Patienten mit dem Namen Kaufmann in Behandlung. Aber wenn sie eben erst eingeliefert worden sind, könnte es sein, dass ihre Daten noch gar nicht aufgenommen sind. Gehen Sie doch bitte in die Notaufnahme und fragen Sie dort nach.‹
Ich ließ mir den Weg beschreiben und erkundigte ich mich dann dort noch einmal nach meiner Familie.
Es war nicht das, was die Schwester sagte, sondern wie sie es sagte und mich dabei anschaute, was mich so unruhig machte. Sie bat mich, kurz Platz zu nehmen und ging, um jemanden zu holen, der mir Auskunft geben konnte.
Wenig später betrat ein älterer, Vertrauen einflößender Arzt den Raum und forderte mich auf, ihm in sein Büro zu folgen. Als ich dort Platz genommen hatte, setzte er sich mir gegenüber, stützte seine Ellenbogen auf den Schreibtisch vor sich und faltete die Hände vorm Gesicht.
Ich werde diese Augenblicke nie vergessen und es hat sich jede Einzelheit tief in mein Gedächtnis eingebrannt, aber noch wusste ich nicht, dass sich dadurch mein ganzes Leben ändern würde.
Es waren nur Sekunden bis er anfing zu sprechen und doch nahm ich in dieser kurzen Zeit jede Einzelheit an und um ihn herum wahr.
Wir saßen in einem kleinen, hellen, freundlichen Büro. Einige gut gepflegte Pflanzen auf dem Fensterstock verliehen dem Raum ein angenehmes Klima. Der Schreibtisch war ordentlich aufgeräumt und es lag nur das Notwendigste darauf. Die Anordnung des Computerbildschirms, der Tastatur und der Maus waren sinnvoll gewählt, sodass auch bei einem Gespräch wie diesem nichts störte. Es drangen kaum Geräusche von außen herein und man hätte in den Augenblicken, bevor er anfing zu sprechen, eine Stecknadel fallen hören können. Der Arzt saß leicht nach vorn gebeugt an seinem Schreibtisch, hatte den Kopf ein wenig gesenkt und schaute über seine Brille hinweg in meine Augen. Nachdenklich oder nervös rieb er, mit den gefalteten Händen, die Handballen und Daumen aneinander. Langsam richtete er sich auf und fing an zu sprechen: ›Herr Kaufmann, als Ihre Frau hier eintraf ...‹
Dieses Gespräch fiel ihm sichtlich schwer und das flaue Gefühl in meiner Magengegend verstärkte sich. Mit weit aufgerissenen Augen und schwer atmend hing ich an seinen Lippen.
›… als sie hier eintraf, konnten wir leider nichts mehr für sie tun. Sie hat bei dem Unfall schwere, auch schwere innere Verletzungen erlitten. Der Notarzt hat alles Menschenmögliche versucht, um sie am Leben zu erhalten und auch wir haben hier versucht sie zu reanimieren, aber es war leider nicht mehr möglich.‹
Mein Herz schlug bis zum Hals. Ich hatte das Gefühl, dass mein Kopf jeden Augenblick platzen würde. Mein Atem ging schwer, meine rechte Hand fing an zu zucken und ein kalter Schauer lief mir über den Rücken.
›Wie ... was ... ich verstehe das nicht! Das … das ist doch nicht möglich!‹
Meine Gedanken wirbelten durcheinander. Sie wollte doch mit den Kindern nur zu ihren Eltern fahren. Diese Strecke kannte sie wie ihre Westentasche, denn sie war diese Straßen doch schon hundert Mal gefahren. Da konnte doch gar nichts passieren. Außerdem, wenn die Kinder mit im Auto saßen, fuhr sie immer besonders vorsichtig. Die Kinder, na klar, die waren ja auch mit dabei gewesen.
›Und den Kindern, wie geht es denen? Wenn ich mich recht entsinne, dann hat der Polizist vorhin auch von ihnen gesprochen!‹
Erwartungsvoll und zugleich ängstlich schaute ich ihn an.
›Tjaaa, also, wenn ich recht informiert bin, dann kam für die beiden Kinder schon vor Ort jede Hilfe zu spät. Als die Rettungskräfte eintrafen und sie mühevoll aus dem Auto befreit hatten, gab es leider keine Möglichkeit mehr, ihnen zu helfen.‹
Ich sank in mich zusammen. Jedes Wort der letzten Sätze war wie der Schlag mit einem Hammer gewesen. Mühsam versuchte ich, meine Gedanken zu ordnen und zu begreifen, was der Arzt eben gesagt hatte. Als ich früh gegangen war, hatte ich doch noch in die Kinderzimmer geschaut und sie friedlich schlafen gesehen.
Oh Gott, mein Gott, was ist nur geschehen, was hab ich nur getan, dass ich so gestraft werde? Bisher war immer alles, mit einigen wenigen, vergessenswerten Schwierigkeiten, nach meinen Wünschen und Träumen verlaufen und nun das. Es konnte gar nicht sein, das war überhaupt nicht möglich! Es musste einfach ein Missverständnis sein! Bei diesem Gedanken angekommen, schaute ich hoffnungsvoll auf den Arzt. Doch im selben Moment wurde mir klar, dass es nur ein dummer Gedanke gewesen war. Der Arzt sprach immer noch und ich versuchte mühsam, seine Worte aufzunehmen, doch es gelang mir nicht. Ich sah nur wie schwer es ihm fiel, mir diese Mitteilung zu machen, dass er schon lange nicht mehr in mein Gesicht sah, sondern gebannt auf seine immer noch gefalteten Hände schaute und auch weiterhin nervös die Handballen und Daumen aneinander rieb. Was war nur geschehen, die Kinder hatten doch noch ihr ganzes Leben vor sich und Gabi ...
›Ich … ich möchte sie sehen. Wo ist sie, und wo sind meine Kinder?‹
Verblüfft schaute der Arzt hoch. Er hatte immer noch gesprochen und ich hatte ihn mitten im Satz unterbrochen. ›Ich denke, es wäre besser, wenn Sie Ihre Angehörigen jetzt noch nicht wiedersehen. Es ist kein schöner Anblick durch die schweren Verletzungen. Vielleicht sollten Sie in Erwägung ziehen ...‹
In diesem Moment klopfte es zaghaft an der Tür. Der Arzt, froh wegen dieser Unterbrechung, sagte: ›Ja, bitte!‹
Langsam ging die Tür auf und ein Polizist schaute herein.
›Entschuldigen Sie bitte, ich suche einen Herrn Kaufmann. Mir wurde gesagt, ich könnte ihn hier finden.‹
›Ja, da sind Sie hier schon richtig. Ich nehme an, Sie sind der Ermittlungsleiter vom Unfallort?‹
›Ja, Schlichter, Hauptwachtmeister Schlichter, aber Sie waren noch im Gespräch, und ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ich werde vor der Tür warten bis Sie fertig sind.‹
Er drehte sich um und wollte den Raum verlassen, doch der Arzt hielt ihn mit den Worten auf: ›Einen Moment bitte, bleiben Sie, ich habe dem Herrn Kaufmann schon alles erzählt, was ich über den Unfall sagen kann. Weitere Fragen zum Unfallhergang können höchstens Sie ihm beantworten. Ich werde dann, damit Sie ungestört sprechen können, solange in die Notaufnahme gehen.‹
Er erhob sich und wollte den Raum verlassen, doch der Polizist hielt ihn mit den Worten auf: ›Bitte warten Sie, ich denke, es wäre besser, wenn Sie hier bleiben würden.‹ Und mit einem flehenden Blick fügte er hinzu: ›Es gibt da vielleicht das eine oder andere, wobei ich Ihre Hilfe benötigen könnte.‹
Der Arzt machte eine resignierende Handbewegung und setzte sich mit einem enttäuschten Blick wieder hin. Neben der Tür stand ein Stuhl, den sich der Hauptwachtmeister nun heranzog. Er schloss kurz die Augen und sammelte seine Gedanken.
›Ich kann Ihnen nur das mitteilen, was wir aus den Unfallspuren und Zeugenaussagen ableiten können, denn der Unfallverursacher hat Fahrerflucht begangen. Zurzeit läuft die Fahndung nach einem Fahrzeug, dessen Beschreibung wir durch vage Zeugenaussagen haben. Also, es muss sich ungefähr so zugetragen haben …‹
Teilnahmslos schaute ich auf seine Lippen und versuchte den Ausführungen zum Unfallgeschehen zu folgen.
›… Ihre Frau war auf der Hauptstraße zwischen Lauscha und Steinach unterwegs, als sie von einem nachfolgenden PKW, vermutlich dem Unfallverursacher, hart bedrängt wurde. Dies wissen wir durch die Zeugenaussage eines entgegenkommenden Fahrzeugs, dessen Fahrer später wieder in Richtung Steinach zurückfuhr. Der Unfallverursacher muss dann bei weiteren Überholversuchen Ihre Frau auf der Fahrerseite gerammt haben. Vermutlich hat sie dadurch die Gewalt über das Fahrzeug verloren und ist auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern gekommen. Nachdem sie mit dem Fahrzeugheck einen Baum berührt hatte, ist sie aufgrund der hohen Geschwindigkeit, die sie wahrscheinlich durch den Unfallverursacher hatte, auf der gegenüberliegenden Seite in den Straßengraben gefahren. Dort hat sich das Auto dann mehrfach überschlagen. Zuerst ist es über die Front hinweg aufs Dach geschlagen, und das Dach wurde durch die große Wucht bis auf die Rückenlehnen der Sitze heruntergedrückt. Anschließend hat sich das Auto noch mehrfach seitlich überschlagen, bevor es auf der Fahrerseite liegend, zum Stehen kam. Der Fahrer eines nachkommenden LKW hat noch gesehen, wie sich ein PKW, schnell beschleunigend, von der Unfallstelle entfernt hat. Nach der Fahrzeugbeschreibung war dies das gleiche Fahrzeug, das uns auch der andere Zeuge beschrieben hat. Fahrer und Beifahrer des LKW haben dann sofort die Rettungskräfte informiert und versucht, selbst Hilfe zu leisten. Leider waren aber alle so im Fahrzeug eingeklemmt, dass sie nur die Möglichkeit hatten Ihre Frau durch die herausgebrochene Frontscheibe notdürftig zu versorgen. Als die Rettungskräfte eintrafen und die Feuerwehr das Dach entfernt hatte, konnten Ihre Kinder leider nur noch tot geborgen werden. Vermutlich hatten sie schon den ersten Überschlag nicht überlebt. Ihre Frau war besinnungslos und hatte in der Zwischenzeit so viel Blut verloren, dass der Notarzt sich wunderte, dass sie überhaupt noch am Leben war. Wahrscheinlich konnte sie nur durch die Notversorgung der beiden LKW-Fahrer so lange am Leben erhalten werden.‹
Er atmete tief durch und beendete seine Ausführungen mit den Worten: ›Das ist erst einmal alles, was ich Ihnen zum Unfallhergang mitteilen kann. Ich werde Sie auf jeden Fall über den Stand der weiteren Ermittlungen auf dem Laufenden halten.‹
Der Hauptwachtmeister hatte mich die ganze Zeit fixiert und schnell hintereinanderweg gesprochen und war nun sichtlich froh, dass er diese schwierige Aufgabe hinter sich gebracht hatte. Er wartete auf eine Reaktion von mir, doch ich musste das Gehörte erst einmal verarbeiten. In meinem Kopf hatten sich während der Ausführungen des Polizisten Bilder gebildet, mit denen ich das Geschehen nachzuvollziehen suchte. Mir stockte der Atem und es wurde mir schlecht, als ich mir meine blutenden, im Fahrzeugwrack eingeklemmten Familienangehörigen vorstellte. Mein Anblick muss beängstigend gewesen sein, denn der Polizist hatte schon einen fragenden und um Hilfe flehenden Blick auf den Arzt geworfen, als dieser auch schon aufstand, zu mir trat und mich fragte: ›Ist Ihnen schlecht? Soll ich das Fenster öffnen?‹
›Ja, ich glaube, das wäre nicht schlecht‹, keuchte ich.
Der Arzt trat, ohne mich aus den Augen zu lassen, ans Fenster, nahm die Pflanzen weg und öffnete es weit. Zitternd und taumelnd stand ich auf und trat, gestützt vom Polizisten, ans Fenster. Die frische Luft tat gut und langsam konnte ich wieder klar sehen. Doch in meinem Kopf wirbelte alles durcheinander. Alles war so düster, so trostlos. Doch das Wetter und die Natur schienen dem allen Hohn zu spotten. Die Sonne war hinter den Gewitterwolken hervorgekommen und begann, die Nässe vom Boden aufzusaugen. Die Vögel zwitscherten fröhlich, die Luft war klar und sauber, alles sah so frisch, so erholt aus. All dies passte überhaupt nicht zu meiner derzeitigen Verfassung. Langsam begann ich meine Gedanken zu ordnen.
›Danke, es geht schon wieder. Das ist bloß sehr viel auf einmal. Ich muss das erst einmal verarbeiten.‹
Der Arzt nickte.
›Das kann ich verstehen. Wenn Sie möchten, können Sie gerne eine Weile hier in diesem Büro bleiben. Hier stört Sie keiner und Sie können erst einmal zur Ruhe kommen.‹ Er schaute mich fragend an, und als ich nicht reagierte, gab er dem Polizeibeamten mit den Augen einen Wink und sie verließen gemeinsam den Raum.
Ich setzte mich und holte tief Luft. Dann versuchte ich das Gehörte zu verarbeiten. In diesem Moment wurde mir bewusst, dass ich nun allein war. Diese Erkenntnis erschlug mich fast, denn ich hatte nun niemanden mehr. Meine Eltern lebten nicht mehr, meine Schwester war weit weggezogen und nun waren meine einzigen nahen Verwandten mit einem Schlag nicht mehr da. Plötzlich spürte ich, dass die Stille und Einsamkeit in diesem kleinen Raum mich erdrückte. Schwer atmend und am ganzen Körper zitternd stand ich auf. Ich verließ das Büro und begab mich in die Notaufnahme. Die an diesem Ort herrschende Betriebsamkeit tat mir gut und ich schaute mich nach dem Arzt und dem Polizisten um. Schließlich fand ich sie in ein Gespräch vertieft, Zigarette rauchend vor der Tür stehen.
›Tut mir leid, aber allein in diesem kleinen Büro, das ist jetzt doch nicht das Richtige für mich. Als ich kam, habe ich vorn beim Haupteingang eine Cafeteria gesehen, und ich denke bei einer Tasse Kaffee kann ich meine Gedanken jetzt besser ordnen.‹
Anscheinend hatten sich die beiden gerade über mich unterhalten und der Arzt schien nun sichtlich erleichtert zu sein, dass ich diese Entscheidung getroffen hatte. Er nickte zustimmend und bat mich nur, später noch einmal bei ihm vorbeizuschauen, um einige Formalitäten zu erledigen. Auch auf dem Polizeirevier sollte ich mich zu diesem Zweck noch einmal melden.
Ich nickte und begab mich in die Cafeteria. Dort musste ich mich zwingen, nicht meiner Verzweiflung nachzugeben, sondern über die weiteren Schritte nachzudenken. Nach einer Weile gelang mir das auch und ich fand zu der rationalen Handlungsweise zurück, für die ich bei meinen Geschäftspartnern bekannt war. Ich zog das Notizbuch, das ich immer bei mir hatte, hervor und begann mir Notizen über die nächsten Schritte zu machen.
Der Rest dieses Tages war wie ein Lauf durch dicken Nebel. Ich funktionierte rationell und von außen drang nichts richtig bis zu mir vor.
Nachdem ich Schritt für Schritt abgearbeitet hatte, was ich zu diesem Zeitpunkt für notwendig erachtete, fuhr ich nach Hause und ließ meinen Gefühlen freien Lauf. Nun begann ich zu bereuen, dass ich mir so wenig Zeit für meine Familie genommen hatte. Bilder aus der Vergangenheit stürmten auf mich ein und ich sah so vieles, was ich hätte anders oder besser machen können.
Das Klingeln des Telefons riss mich aus meinen trübsinnigen Gedanken. Meine Schwester erkundigte sich nach meinem Befinden und bot mir an, mich in den kommenden Tagen zu unterstützen. Ich war dankbar für dieses Angebot, denn die Einsamkeit in diesem Haus war belastend. Nachdem ich einige Bier getrunken hatte, kam ich soweit zur Ruhe, dass ich mich entschloss, zu Bett zu gehen. Doch nach höchstens zwei Stunden Schlaf schreckte ich aus einem Albtraum hoch. Meine Decke war ein einziger Knoten und der Schlafanzug klebte schweißnass an meinem Körper. Nachdem ich mich umgezogen und das Bett wieder in Ordnung gebracht hatte, legte ich mich wieder hin, doch an Schlaf war nicht mehr zu denken.
Die folgenden Tage und Nächte bis zur Beerdigung waren nicht leicht für mich und ich weiß nicht, wie ich sie ohne die Hilfe meiner Schwester überstanden hätte. Da meine Eltern nicht mehr lebten, war sie meine nächste lebende Verwandte und ihre Nähe half mir sehr. Am Tag der Beerdigung wurde alles noch einmal so richtig aufgewühlt und ich musste alle Kraft zusammennehmen, um ihn zu überstehen.
Seit diesem Tag stelle ich mir ständig die Frage: Was wäre geschehen, wenn ich nachgegeben hätte? Was wäre, wenn ...
Das Schlimmste kam aber noch, denn ich wusste ja noch nicht alles über diesen Unfall. Aber es traf mich wie ein Schlag, als ich zwei Tage nach der Beerdigung das erste Mal wieder in der Firma erschien. Ich hatte lange überlegt, wie es nun weitergehen sollte und war schließlich zu dem Ergebnis gekommen, dass es das Beste wäre, wenn ich mich wieder in meine Arbeit stürzen würde. Die Arbeit würde mich ablenken, sodass ich nicht ständig über das Warum und Wieso nachdenken könnte. Meine Belegschaft war wirklich sehr verständnisvoll. Besonders Frau Wagner, meine Sekretärin, hatte wieder bewiesen, dass sie die perfekte Besetzung für diese Stelle war. Alles, was ich nicht unbedingt selbst entscheiden musste, hatten sie und andere leitende Angestellte in der Zwischenzeit zu meiner vollsten Zufriedenheit erledigt. Nur die Dinge, die kein anderer entscheiden konnte, waren, sauber nach Wichtigkeit geordnet, auf meinem Schreibtisch bereitgelegt. Ich ging mit ihr diese Angelegenheiten durch und wir hatten schon einiges abgearbeitet, als das Telefon wieder einmal klingelte. Sie ging an ihren Schreibtisch und nahm den Hörer ab. Im selben Moment konnte ich an ihrem Gesichtsausdruck erkennen, dass sie diesen Anruf zwar erwartet, aber insgeheim gehofft hatte, dass er nicht käme. Sie legte das Gespräch in die Musik und sagte zu mir: ›Es ist wieder dieser Herr Igor und er lässt sich einfach nicht abwimmeln. Er hat schon in den letzten zwei Tagen mehrfach hier angerufen. Was soll ich ...?‹
›Geben Sie das Gespräch her. Der erwischt mich gerade auf dem richtigen Fuß! Dem werd ich jetzt ein für alle Mal die Meinung geigen!‹, sagte ich zornig. Ich nahm das Gespräch an und meldete mich betont forsch.
›Ja! Kaufmann am Apparat!‹
›Ahhh, Herr Kaufmann. Schön, dass Sie wieder im Geschäft sind.‹
›Was wollen Sie? Ich denke, ich habe Ihnen meine Position klar und verständlich mitgeteilt! Also, warum belästigen Sie mich trotzdem noch?‹
›Also, also, Herr Kaufmann. Nicht so aggressiv! Ich bedaure das mit Ihrer Familie sehr, aber es sollte eigentlich nur ein Warnschuss werden. Dass es dann so schlimm ausgegangen ist, war wirklich die Verkettung unglücklicher Umstände. Ich habe meine Mitarbeiter schon bestraft für ihr übertriebenes Vorgehen. Ich hoffe Sie wissen nun, dass wir es ernst meinen und auch die Möglichkeit haben, unsere Forderungen durchzusetzen!‹
Mit einem Schlag ging mir ein Licht auf. Ich verstand nun, wie es zu diesem Unfall hatte kommen können. Mir verschlug es die Sprache und die Hand mit dem Telefonhörer sank mir auf die Brust. Ich rang nach Luft und Frau Wagner, die durch die offene Tür hereingeschaut hatte, war schon auf dem Sprung, um mir zu helfen, als ich mich aufraffte und den Hörer wieder hochnahm.
›Hallo? Hallo, Herr Kaufmann? Sind Sie noch da?‹
›Ja … Ja, ja‹, stotterte ich, ›was haben Sie da eben gesagt? Sie … Sie sind dafür verantwortlich? Ich … ich kann das gar nicht glauben!‹
›Tja, dann finden Sie sich mal mit diesem Gedanken ab! Ich hatte Sie vorher mehrfach gewarnt! Es sollte nicht so hart ausfallen, sollte nur ein Warnschuss werden, aber vielleicht war es auch gut so. Nun wissen Sie wenigstens, dass wir es ernst meinen! Ich denke, Sie sollten nun eine Änderung Ihrer Meinung in Betracht ziehen, denn wir haben auch noch andere Möglichkeiten, unseren Willen durchzusetzen. Also, ich lasse Sie das Ganze noch einmal in Ruhe überdenken. Äh, sagen wir ein, oder besser zwei Tage, dann melde ich mich wieder und wir handeln die Einzelheiten aus!‹ Es folgte eine kleine Pause.
›Und denken Sie nicht mal im Traum daran, die Polizei oder jemanden anders zu informieren! Ich würde auf jeden Fall recht schnell davon erfahren und dann ist Ihre Firma und Ihr Leben keinen Pfifferling mehr wert! Ich denke, dass ich mich da klar ausgedrückt habe.‹
Wut stieg in mir hoch und ohne irgendwelche Konsequenzen zu bedenken, schrie ich in den Hörer:
›Sie sind wohl nicht mehr ganz bei Trost?! Nachdem, was Sie mir jetzt erzählt haben, erwarten Sie auch noch eine Kooperation von meiner Seite? Ich denke ja nicht mal im Traum daran, auch nur im Geringsten in irgendeiner Form auf Ihre Forderungen einzugehen! Sie können sich Ihre Drohungen sonst wohin stecken! Sie, Sie Stück Dreck, Sie! Sie ... Arrr!!‹
Mit diesen Worten knallte ich den Hörer so wütend auf die Basisstation, dass er auseinanderbrach. Noch wütender dadurch, wischte ich das Telefon inklusive einiger anderer Dinge vom Schreibtisch. Ohne Rücksicht auf weitere Schäden ging ich durch die heruntergeworfenen Gegenstände, nahm meine Jacke vom Garderobenständer und verließ ohne ein weiteres Wort das Firmengebäude in Richtung Auto. Aus den Augenwinkeln konnte ich noch das entsetzte Gesicht meiner Sekretärin sehen, doch ich war zu aufgewühlt, um in diesem Moment darauf einzugehen.
Aggressiv fuhr ich ohne Ziel drauflos. Nach einer ganzen Weile bog ich in einen Waldweg ein, stieg aus und lief leise vor mich hinredend auf und ab.
Oh Gott, warum nur? Was hab ich denn verbrochen, dass ich so gestraft werde? Ich wollte doch nie jemandem schaden oder ihn übervorteilen. Habe immer versucht, es allen recht zu machen. Oft habe ich zu meinem eigenen Nachteil anderen nachgegeben. Ich stockte kurz und holte tief Luft.
Na ja, meistens war es ja nicht ganz unberechnend, denn im Nachhinein hat sich oft ein Vorteil für mich daraus ergeben. Aber muss ich deswegen so gestraft werden? Ich habe doch deswegen niemandem Schaden zugefügt! Warum habe ich nur diesmal nicht nachgegeben? Warum habe ich dieses blöde Geschäft nicht einfach sausen lassen? Es lief doch auch so hervorragend in der Firma. Sie muss es geahnt haben, muss gewusst haben, was geschehen würde. Sie war immer besser in der Einschätzung solcher Dinge.
Die Verzweiflung überrollte mich, ich legte die Arme aufs Autodach, vergrub meinen Kopf in den Armbeugen und begann hemmungslos zu schluchzen.
Bilder stiegen in mir auf.
Wie schön war es immer gewesen, wenn Maria mit ihren großen Kinderaugen flehend zu mir aufgeschaut hatte, um etwas zu erreichen, und wie schwer war es mir oft gefallen, ihr nicht jede Bitte zu erfüllen. Ich habe immer gedacht: Das darfst du nicht, später bekommt sie auch nicht jeden Wunsch erfüllt und dann kann sie nicht damit umgehen. Hätte ich ihr doch jeden Wunsch erfüllt! Ach, könnte ich doch die Zeit zurückdrehen! Die schönen Stunden mit Gabi noch einmal erleben. Wie schön war es gewesen, als unsere Liebe noch jung war. Wir hatten uns nichts daraus gemacht, immer und überall zu zeigen, wie sehr wir uns liebten. Auch wenn andere manchmal verunsichert wegschauten, wenn wir uns im Beisein Dritter küssten oder umarmten, es war ja nichts dabei, wenn wir jedem zeigten, dass wir zusammengehörten. Aber später kam dann die Routine ins tägliche Leben, und im Kampf mit den anfallenden Aufgaben haben wir uns vernachlässigt. Unsere Liebe vernachlässigt. Oder war nur ich das? Aber wie sollte ich sonst mein Tagespensum bewältigen? Nur durch die harte Arbeit und die Routine im täglichen Leben konnte ich das aufbauen, was ich bis jetzt geschaffen hatte. Ich wollte doch nur eine gewisse Sicherheit haben! Sicherheit und noch ein Stück Sicherheit und noch ein Stück! Und, was nützt sie mir jetzt, diese Sicherheit? Es ist niemand mehr da, dem sie nützen könnte. Auch Torsten nicht! Oh, wie stolz war ich auf meinen Sohn gewesen! Der Glanz in seinen Augen, bei gemeinsamen Unternehmungen, war die schönste Belohnung. Wann hatte ich denn eigentlich das letzte Mal richtig Zeit für ihn gehabt? Wie oft hab ich mit Gabi über das alles diskutiert und mir vorgenommen, etwas zu ändern. Aber dann. Eine Weile hat es meist angehalten, bis, ja bis mich die tägliche Routine wieder im Griff hatte. Und jetzt, jetzt ist es zu spät. Hätte ich doch nur damals in die Zukunft schauen können. Was hätte ich nicht alles anders gemacht! Wieder schossen mir Tränen in die Augen.
Ja, was, was hätte ich denn anders gemacht? Hätte ich wirklich mein Leben geändert? Wäre ich in der Lage gewesen, mich anders zu verhalten? Meinem Wesen, meinen Wünschen und Träumen entgegen anders zu leben? Mich anderen unterzuordnen und so zu leben, wie diese sich das wünschten? Oder wäre ich daran zerbrochen? Hätte ich vielleicht nur den Weg des geringsten Widerstandes gesucht und nur bestimmte Dinge vermieden? Oh, warum ist das Leben nur so kompliziert?
Ich begann wieder hin und her zu laufen und kam mit diesen Gedanken nicht zur Ruhe. Nach einer Weile lief ich einfach den Waldweg entlang, bis er an einem Wiesenhang die Richtung wechselte. Er führte dann am Waldrand entlang, bis er in einem großen Bogen ins Tal hinunter schwenkte. Wenn man dem Weg mit den Augen weiterfolgte, konnte man am Ende des Tales, bevor es durch einen Bogen nicht mehr einsehbar war, die ersten Häuser eines kleinen Dorfes sehen. Irgendjemand hatte am Waldrand, zwischen zwei Bäumen, eine kleine Bank gebaut. Dort setzte ich mich nieder und schaute den wild dahintreibenden Wolken nach. Der stürmische Wind beugte die Baumwipfel und immer wieder hörte man das Knacken von kleineren Ästen, die zu Boden fielen. Ich war noch nie an diesem Ort gewesen. Da ich aufs Geradewohl losgefahren war, wusste ich nicht einmal genau, wo ich mich befand. Wäre ich zu einem anderen Zeitpunkt hierhergekommen, hätte ich mich an der Schönheit der Landschaft gefreut und dem Treiben der Natur zugeschaut. Doch so nahm ich das alles nur nebenbei wahr und meine Gedanken jagten genauso wild dahin, wie die Wolken im stürmischen Wind.
Was hab ich nun noch vom Leben? Mein Halt, die Wärme, die Zuflucht in meinem Leben sind nicht mehr da. Das einsame, stille, für mich allein viel zu große Haus erdrückt mich fast. Jeder Ort, jeder Gegenstand in diesem Haus erinnert mich an meine Familie. Was will ich allein mit all den Dingen, die ich um mich herum angehäuft habe? Es macht keine Freude, wenn man sie nicht mit jemandem teilen kann. Oh Gott, was soll nur werden?
Ich vergrub den Kopf in den Händen und schloss die Augen.
Wie soll es jetzt weitergehen mit mir? Ich weiß ja nicht einmal, wie ich das Problem in der Firma lösen soll. Wenn ich diesem Igor jetzt nachgebe, verrate ich alles und alle, die mir jemals lieb waren. Gebe ich ihm nicht nach, bringe ich auch noch andere, von mir und der Firma mal abgesehen, in Gefahr. Vielleicht wäre es ja gar nicht mal schlecht, wenn ich mit dran glauben müsste. Dann wären all meine Probleme ein für alle Mal gelöst. Ich müsste mir keine Gedanken mehr machen, wie es weitergeht und wäre alle Sorgen los. Ja, das ist es. Ich leg mich weiter mit diesem Gangster an.
Mein Gesicht hellte sich auf und ich wollte aufspringen, doch fast im selben Moment sackte ich wieder in mich zusammen.
Ich bin bloß der Letzte, dem es an den Kragen geht. Er will ja was von mir. Also wird er erst alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen. Wieder nichts! Wieder kein Weg! Wie komm ich nur da raus? Man müsste einfach ausreißen können. Einfach weg. Sich einfach davonstehlen. Es merkt ja doch keiner mehr, wenn ich nicht mehr da bin. Aber wo soll ich denn hin? Was soll ich denn dann tun mit meinem Leben? Außer … außer ich setz meinem Leben selbst ein Ende.
Ich erschauderte bei dem Gedanken und doch ließ er mich nicht mehr los. Nachdenklich aber schon ruhiger stand ich auf und lief den Waldweg zurück. Der Selbstmordgedanke hatte sich richtig in mir festgefressen. Ich überlegte nur noch, ob ich vorher noch etwas klären müsste. Doch schließlich kam ich zu dem Schluss, dass es mir doch dann egal sein könnte, was weiter werden würde. Der Gedanke an Gott kam kurz in mir auf, doch ich hatte den Glauben in den letzten Jahren sehr vernachlässigt, sodass der Selbstmordgedanke schnell wieder die Oberhand gewann. Zielsicher ging ich aufs Auto zu, suchte den Schlüssel in meinen Taschen und musste dann feststellen, dass er noch im Zündschloss steckte. Das war mir auch noch nicht passiert. Sonst hatte ich meist noch ein, zwei Mal kontrolliert, ob das Auto auch richtig zugeschlossen war und jetzt, da steckte der Schlüssel, da lagen alle Papiere auf dem Beifahrersitz. Selbst die Brieftasche hatte ich dort liegengelassen.
Kopfschüttelnd setzte ich mich ans Steuer und fuhr zurück auf die Landstraße. Da ich zu dem Schluss gekommen war, dass es am besten wäre, wenn ich gleich jetzt mit dem Auto einen tödlichen Unfall verursachte, schaute ich mich nach einer passenden Stelle um. Schließlich kam ich auf eine lange Gerade, die in einer scharfen Rechtskurve endete. Am linken Straßenrand in dieser Kurve stand ein recht starker Baum.
Das ist ideal! dachte ich und beschleunigte. Da ich ein PS-starkes Auto hatte, war es kein Problem, es bis zum Ende der geraden Strecke auf 140 km/h zu bringen. Ich hielt genau auf den Baum zu. Da schoss mir aber noch ein Gedanke durch den Kopf:
Was ist, wenn ich nicht sterbe? Was, wenn ich diesen Unfall überlebe? Wenn ich nur zum Krüppel werde! Wenn ich ein Pflegefall werde! Nein das geht nicht! Das ist zu unsicher!
Im letzten Moment nahm ich den Fuß vom Gaspedal und riss das Lenkrad herum. Ich kann nicht mehr genau sagen, wie ich es geschafft habe, das schleudernde Auto wieder in den Griff zu bekommen, aber glücklicherweise kam mir kein Fahrzeug entgegen, sonst wäre es wohl nicht so glimpflich ausgegangen.
Nachdenklich fuhr ich nach Hause. Zwischenzeitlich kam mir die Firma in den Sinn, und dass ich ja noch einiges dort zu erledigen hätte. Doch nach einem Blick auf die Uhr verwarf ich diesen Gedanken schnell wieder. Erstens war es schon ziemlich spät und bevor ich in der Firma ankommen würde, wäre schon Feierabend. Und zweitens, was sollte ich noch dort, wenn ich meinen Plan wirklich durchführen wollte. Durch diese Gedanken wurde mir erst einmal bewusst, wie lange und wie weit ich eigentlich ziellos in der Gegend herumgefahren war.
Als ich an einer Bahnlinie vorbeifuhr, kam mir der Gedanke, mich vor einen Zug zu werfen. Doch auch das verwarf ich recht schnell wieder.
Egal, was ich in Erwägung zog, keine Möglichkeit wollte mir so recht gefallen. Vielleicht war es auch Selbstschutz oder die Angst vor der Endgültigkeit dieser Entscheidung, die mich immer wieder zurückschrecken ließ.
Schließlich entschied ich mich fürs Erhängen und zu Hause angekommen, suchte ich gleich nach einem passenden Strick. Mit diesem ging ich dann in ein nahe gelegenes Waldstück. Es dauerte auch nicht lange, und ich fand eine Eiche mit einem starken, fast waagerecht gewachsenen Ast. Dieser war der unterste auf der mir zugewandten Seite des Baumes und doch etwa drei Meter über dem Boden. Auf der anderen Seite des Baumes konnte ich durch Springen einen dünneren, nicht so hohen Ast erreichen, wodurch ich recht gut hinauf gelangte. Ich setzte mich auf den starken, waagerechten Ast und legte mir die Schlinge um den Hals. Das andere Ende des Strickes befestigte ich so am Baum, dass ich den Boden nicht mit den Füßen erreichen konnte. Nun machte ich mich bereit zu springen. Lange saß ich dort und konnte mich einfach nicht entschließen, diesen Schritt zu tun. Der Zwiespalt in mir war riesig. Einerseits wollte ich mich davonstehlen, allen weiteren Problemen aus dem Weg gehen und dem allen ein für alle Mal ein Ende setzen. Andererseits wehrte sich mein Verstand, der Selbsterhaltungstrieb in mir massiv dagegen. Als ich endlich soweit war, sich die Muskeln in meinen Armen spannten und ich mich vom Ast abstieß, geschah etwas Seltsames. Zuerst hatte ich das Gefühl, dass ich einem Feuer zu nahe gekommen wäre, denn es wurde unheimlich heiß um mich herum. Dann wurde mir kalt, und zwar so kalt, dass ich am Ende die Besinnung verlor. Doch bevor das geschah, hatte ich das Gefühl, ich wäre eingefroren. Ich bekam keine Luft mehr und mein Herz schien stillzustehen. Die Umgebung nahm ich nur noch verschwommen war, seltsame Farbspiele erschienen plötzlich vor meinen Augen und ich war nicht fähig mich zu bewegen. Das letzte, was ich wie durch einen Schleier wahrnahm, war mein Körper, der in verkrampfter Haltung auf dem Ast saß. Verstört schloss ich die Augen.«