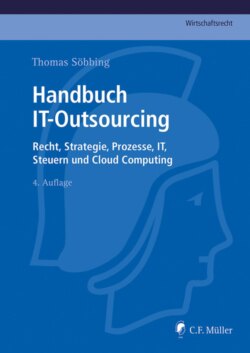Читать книгу Handbuch IT-Outsourcing - Joachim Schrey - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1 › I. Entwicklung
I. Entwicklung
4
In den 80er-Jahren bis in die frühen 90er-Jahre hinein ist es üblich gewesen, ein Produktportfolio breit auszurichten. Die Vorstellung der damaligen Unternehmensstrategie war es, Ausfälle in einem Geschäftsbereich durch einen anderen expandierenden Geschäftsbereich auszugleichen. Eine solche Vorgehensweise wird als „Diversifizierung“ bezeichnet.[1] Hierbei wird eine Risikostreuung durch die Erweiterung der eigenen Aktivitäten auf eine Vielzahl von Märkten erreicht, d.h. die Erzielung größerer Unabhängigkeit von den spezifischen Risiken eines Einzelmarktes.
5
Die Diversifizierung hat die Outsourcing Aktivitäten in Deutschland und weltweit bis in die beginnenden 90er-Jahre geprägt. So gab es bis in den frühen 90er-Jahren nur wenige Outsourcing-Projekte auf dem deutschen Markt. Outsourcing passte einfach nicht zur gängigen Diversifizierungsstrategie wie die der damaligen Daimler Benz AG (heute Daimler AG).[2]Der damalige CEO von Daimler Benz, Edzard Reuter, hatte die Vision, aus dem Automobilhersteller Daimler Benz einen „Technologiekonzern“ zu schaffen. Durch Zukäufe von AEG, Dornier etc. und der Gründung der DASA stellte Edzard Reuter das Produktportfolio von Daimler Benz sehr breit auf und hat sogar mit der Gründung des debis Systemhauses (heute T-Systems) sich in die gegenteilige Richtung von Outsourcing bewegt. So konnte der Daimler-Benz-Konzern bis zu Beginn der 90er-Jahre von der Waschmaschine über Autos bis zum modernen Großraumflugzeug (fast) alles produzieren. Aber auch andere Unternehmen folgten einer Diversifizierungsstrategie und es entstanden solche Mischkonzerne wie AEG, Linde etc. Hierbei ging es nicht um das Umschichten von Aktivitäten, sondern darum, freie Cash-Mittel, die im ursprünglichen Hauptgeschäftszweig erzielt wurden, nicht an die Aktionäre auszuschütten, sondern von der Unternehmensführung zur Absicherung der Existenz des Unternehmens durch Zukauf von Aktivitäten anderer Bereiche zu verwenden. Eine Diversifizierungsstrategie war also verbunden mit einer Wachstumsstrategie und entspricht dem klassischen gesellschaftlichen Unternehmensverständnis, das die Existenz und den Fortbestand eines Unternehmens als Wert an sich – losgelöst von den Wertinteressen der Anteilseigner – betrachtet. Aus diesem Blickwinkel gesehen, erscheint eine Diversifizierungsstrategie als gesellschaftlich förderungswürdig.
6
In der Wissenschaft wurde man in den späten 70er-Jahren gegenüber der Diversifizierungsstrategie skeptisch. Hierbei gewann die durch Vertreter der „Chicago School“[3] geprägte Denkrichtung in den Wirtschaftswissenschaften die Oberhand.[4] Während Milton Friedman[5] als prominentester Vertreter der Chicagoer School eher liberale Grundgedanken der Ökonomie verfasste (z.B. die Rolle der Geldpolitik), waren es eher die Schüler von Milton Friedman als Vertreter der Zweiten Chicago School,[6] die die Diversifizierungsstrategie infrage stellten. Unter dem Aspekt des Shareholder-Value-Gedankens, der vom Management eine Unternehmensführung im ausschließlichen oder jedenfalls überwiegenden Interesse der Wertsteigerung für die Aktionäre fordert, waren Diversifizierungsstrategien fragwürdig geworden, da sie nicht das Interesse der Anleger (Aktionäre) berücksichtigten. Durch einige Studien der Chicagoer School wurde belegt, dass eine Diversifizierung effizienter auf der Ebene des einzelnen Investors durch Streuung seines persönlichen Portfolios erfolgen konnte. Stabilität des Unternehmens als solches wurde nicht mehr als Selbstzweck betrachtet und es wurde nachgewiesen, dass übermäßige Diversifizierung von den Kapitalmärkten mit Kursabschlägen bestraft wurde.[7] Die Folge dieser Kritik war eine Verschlankung und eine Konzentration auf Kernaktivitäten einzelner Konzerne, bei gleichzeitiger Auslagerung von Nicht-Kernprozessen.
7
Seit Anfang/Mitte der 90er-Jahre hat sich mit den Gedanken der Zweiten Chicago School der Trend einer Diversifizierungsstrategie umgekehrt. Die Unternehmensstrategien gehen nicht mehr davon aus, dass ihr Produktportfolio besonders breit ausgerichtet sein sollte. Man beschränkt sich immer mehr darauf, was ein Unternehmen wirklich gut kann, die sogenannten Kernkompetenzen (engl.: core business).[8] Zu dieser Strategie zählt es auch, Bereiche, die nicht zum Kerngeschäft gehören, abzustoßen oder auszulagern und sich im Bereich der Kernkompetenzen durch strategische Zukäufe zu verstärken.[9]
8
Seit dem Antritt von Jürgen Schrempp als neuer CEO von Daimler Benz hat sich auch die Unternehmensstrategie der Daimler AG geändert. Der Konzern, der aus dem Automobilbau kommt, hat sich wieder auf seine Kernkompetenzen zurückbesonnen und verstärkt diesen Bereich nach und nach durch Firmenzukäufe und Fusionen. Währenddessen wurden die Anteile an den Nicht-Kernkompetenzen des Daimler-Chrysler-Konzerns, immer weiter verringert. Auch wurde unter Jürgen Schrempp das eigene IT-Systemhaus (debis) an die Telekom verkauft, welches heute mit den Telekom-Einheiten als T-Systems selbst als großer Outsourcing-Dienstleiser firmiert.
9
Was sich so im Bereich der Unternehmensstrategie widerspiegelt, hat sich auch im Bereich der einzelnen Unternehmensprozesse vollzogen, sodass der Trend mehr und mehr in die Richtung geht, Nicht-Kernprozesse auszugliedern und sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Wurden noch in den 80er-Jahren bis zu 70 % der Automobilteile vom Hersteller des Kfz selbst gefertigt, so hat sich dieser Anteil gegen Ende der 90er-Jahre bei Daimler Chrysler auf nahezu 40 % reduziert.
10
Diese Spezialisierung auf Kernkompetenzen bezieht sich aber nicht nur auf die Zulieferung von Einzelteilen für die Endproduktion. Vielmehr werden ganze Produktionsabschnitte an Fremdunternehmen vergeben. Dies erfolgt unter dem Schlagwort des Outsourcings.
11
Natürlich ist Outsourcing eigentlich nichts völlig Neues. Schon seit den 50er-Jahren gingen einzelne Unternehmen dazu über, sich der Leistungen externer Dienstleistungsunternehmen zu bedienen. Die historische Entwicklung vieler Unternehmen begann damit, dass Erfinder, Unternehmer oder Händler ein Produkt entwickelten oder hieran Rechte erlangt hatten und dieses nunmehr herstellen und vertreiben wollten. Um die Produkte oder den Vertrieb der Produkte als den Hauptbereich ihrer Tätigkeit herum ergab sich für die Unternehmen bald die Notwendigkeit, weitere Abteilungen, Verwaltungseinheiten oder Produktionseinheiten aufzubauen. So lebt ein Produktionsunternehmen nicht alleine davon, dass es eine bestimmte Maschine produziert. Für ihren Bau sind bestimmte Einzelteile notwendig, die ebenfalls produziert werden müssen, Produktionsanlagen müssen instandgehalten werden, das Produkt muss mit Produktbeschreibungen versehen werden und es muss letztendlich über entsprechende Vertriebswege, für die Verwaltungseinheiten notwendig sind, verkauft werden. In diesem Zusammenhang bauten viele Betriebe eigene Instandhaltungsbetriebe, Schreinereien, mechanische Werkstätten, Druckereien, Marketingabteilungen, IT-Abteilungen usw. auf. Die Betreibung dieser Unternehmenseinheiten ist für viele Betriebe aber nur mit erheblichem Einsatz möglich, gerade, weil es sich dabei um Nicht-Kernkompetenzen handelt.
12
Ein geradezu klassisches Beispiel ist der kleine Handwerksbetrieb, in dem der Inhaber (meist der Handwerksmeister) nach Zuschließen der Werkstatt sich noch um die Lohnbuchhaltung kümmern muss. Je nach Motivation des Inhabers sah auch die entsprechende Lohnbuchhaltung aus. Dies ist dem Inhaber aber nicht zu verübeln, da er nach seiner Ausbildung und Profession mehr für eine handwerkliche Tätigkeit geeignet ist und nicht für die buchhalterische Tätigkeit. Die Folgen einer schlechten Lohnbuchhaltung konnten aber erheblich sein oder sogar strafrechtlich relevant werden. Sicherlich ist es aber nur ein logischer Schritt auch von kleinen Handwerksunternehmen, die Lohnbuchhaltung an entsprechende Lohnbuchhaltungsbüros zu vergeben, um sich wieder voll auf die handwerkliche Tätigkeit zu konzentrieren.
13
Der Einsatz, den Unternehmen, egal welcher Größe, beim Betreiben von Nicht-Kernkompetenzen aufwenden müssen, ist in den letzten Jahren so erheblich geworden, dass es den Unternehmen kaum noch gelingt, mit der Entwicklung im Bereich der Nicht-Kernkompetenzen Schritt zu halten. Gerade die rasante Entwicklung im Bereich der Informations-Technologie (IT) zeigt dies deutlich auf (zuletzt durch die Entwicklung des Cloud Computing). Eine Lösung für diese schnelle Entwicklung in der Informations-Technologie wird in der Ausgliederung dieser Nicht-Kernkompetenzen gesehen. Dabei sollte aber nicht übersehen werden, wie wichtig diese Nicht-Kernkompetenzen weiterhin für ein Unternehmen sein können.
14
Aber auch in Non-IT-Bereichen, die nicht zu den Kernkompetenzen eines Unternehmens zählen, fällt es den Unternehmen immer schwerer, sich als „Best-in-Class“ zu behaupten. Aus diesem Grund neigen auch immer mehr Unternehmen dazu, auch gesamte Geschäftsprozesse im Rahmen von sog. Business Process Outsourcing (BPO) an einen Provider zu übergeben. Die Synergieeffekte sind dabei vergleichbar, mit denen schon fast klassischen Bereichen des IT-Outsourcings.
15
Die seit der Mitte der 90er Jahren vor allem im angelsächsischen Raum weit vorbereite Vorgehensweise der Konzentration auf das Kerngeschäft will gleichzeitig Geschäftsprozesse rationalisieren, Prozesskomplexität reduzieren, Managementkapazitäten freisetzen, das Unternehmen flexibilisieren und auf das Kerngeschäft fokussieren („Do what you can do best – outsource the rest“). Kostspielige oder selbst nicht effektive IT- oder Geschäftsprozesse, die nicht zum Kerngeschäft gehören, werden an Outsourcing-Provider ausgelagert. Zum Teil wird ein Outsourcing-Projekt aus Cashflow oder bilanzierungstechnischen Gründen vorgenommen (Vermeidung hoher Investitionen und Mittelbindung, Verbesserung von Kreditratings etc.). Die Auslagerung kann auch Qualitäts-, Sicherheits- und Know-how-Gründe haben, oder aus einem schnellen Wachstum durch Fusionen und Firmenerwerb (M&A-Transaktionen) des Unternehmens resultieren.
16
Ob es Outsourcing schon immer gab oder etwas Neues seit den 90er Jahren des Jahrhunderts ist, kann grundsätzlich offengelassen werden. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass IT-Outsourcing sich mittlerweile als Management-Tool vor allem in den Köpfen der CEOs, CFOs, COOs und CIOs vieler deutscher und internationaler Unternehmen als „Business as usual“ etabliert hat. Aber auch viele Analysten bewerten eine Spezialisierung auf Kernkompetenzen bei gleichzeitigem Outsourcing von Nicht-Kernkompetenzen als eine positive Entscheidung für die langfristige Verbesserung des Shareholder-Values.