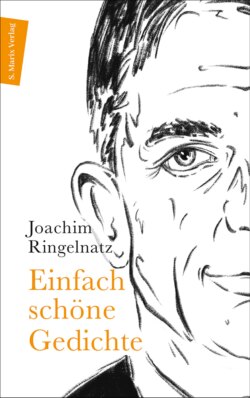Читать книгу Einfach schöne Gedichte - Joachim Ringelnatz - Страница 6
Einleitung
Оглавление»Nein ernst, als ob das komisch wär« Joachim Ringelnatz – Kobold, Artist, Kunstmaler, Wortfeuerwerker
von Alexander Kluy
Spukschlösser gibt es nicht wenige. In Frankreich, in Österreich, in Irland. Natürlich und erst recht im spooky Vereinigten Königreich und Nordirland. Im hohen Norden Englands, am Übergang zu Schottland, steht etwa das so passend benannte wie unheimlich heimgesuchte Chillingham Castle (chill heißt auf Deutsch Schauer oder kühler Hauch). Es gibt Spukburgen und Spukhäuser. Vor Längerem gelesene Bücher spuken durch die Nebel der Erinnerung und des eigenen Gedächtnisses. Gibt es auch längst verstorbene Autoren, die herumspuken? Zumindest gab es einige, die an Geister und an Spukerscheinungen glaubten. Nach weitaus mehr Autorinnen und Autoren sind Häuser benannt und Literaturmuseen, Plätze und Straßen. Joachim Ringelnatz, einst im Leben schon nicht groß, machte sich diesbezüglich noch kleiner. Und trat noch bescheidener auf. Denn selber wünschte er sich im Gedicht Ehrgeiz wahrhaftig nicht viel: nur ein Gässchen, das nach ihm benannt werde, zum alleinigen Herumspuken. München, die Stadt, in der er am längsten lebte, benannte im Jahr 1953 einen rund 100 Meter kurzen schnurgeraden Weg im Stadtteil Solln nach ihm. Er aber hatte sich ein »krummes Gäßchen, mit niedrigen Türchen« gewünscht, »mit steilen Treppchen und feilen Hürchen / Mit Schatten und schiefen Fensterluken«. (In seiner Geburtsstadt Wurzen ist die Ringelnatzstraße noch kürzer als der Weg in München.) Dort, ja dort, in dieser Gasse, »würde ich«, schrieb Ringelnatz, »spuken«. Und nicht auf Chillingham Castle, wohin er nie kam.
Woher kam er denn? Wo kam Joachim Ringelnatz her?
»DER RINGELNATZ kam die bordeauxweinroten Ozeane heruntergeschwommen, zwischen bottle and battle, weiß Gott woher, setzt er unvermittelt auf tiefsten Grund eines Witzes höchste Spitze. Vielleicht aus des Wanderers Rimbaud Lenden entsprungen irgendwo zwischen Abessynien, dem Niederrhein und der Welt.«1 Als Franz Blei 1922 Ringelnatz so im Großen Bestiarium der Literatur besang, war dieser der jüngste Autor, der darin mit spitzer Feder kurzporträtiert wurde. War er doch gerade einmal drei Jahre alt.
»Joachim Ringelnatz« war erst im Dezember 1919 in die Welt und auf ihre Bühnen gesprungen. Von einem Schriftstellersohn erfunden, der geboren wurde im sächsischen Wurzen, in Leipzig aufwuchs, aus romantischer Neigung zur See fuhr und zwischen Surinam, Odessa und Norwegen die Meere durchkreuzte und durchlitt, der zum Hungerkünstler aus Not wurde und in tausend Nöten war, der sich in vielen bürgerlichen Berufen erprobte und in einem jeden scheiterte, der träge Kriegsjahre hinter sich hatte – und 1919 neu erstand: Joachim Ringelnatz. Und mit ihm Kuttel Daddeldu, der Mariner larger than life, in dessen Körper sein Finder/Erfinder, einst Leutnant zur See, derart überzeugend ungebärdig schlüpfte, dass er im Lauf der Jahre so manchen Brief als »Kuttel« zeichnete. Und der ein solch artistisches Verwirrspiel präsentierte, zwischen Raffinesse und Frivolem, zwischen hochamüsantem Pathosbruch und herzbrechender Einfühlsamkeit schillernd, wie es das Publikum bis dato noch nicht erlebt hatte.
Dabei war es in seiner facettenreichen verspielten Art, von vielen fälschlich als naiv eingeordnet, ein anarchisch-modernes Maskenspiel des Ichs, waren seine Gedichte so unverwechselbar und eingängig, dass sie Allgemeingut wurden, populär waren, bis heute rezitiert werden und hinreißend lebendig geblieben sind.
»Der kürzlich verstorbene Joachim Ringelnatz ›Aus Wurzen an der Wurze‹ (= Hans Bötticher 1883–1934) ist gebürtiger Wurzener und der Sohn eines Zeichners aus der Tapetenfabrik, der selbst poetische Schilderungen des Kleinstadtlebens (Allotria, Neues Allotria) brachte. Nach langen Jahren des Umherschweifens als Matrose begann er zu dichten und zu zeichnen, war mehrfach Bibliothekar in großen Privatbüchersammlungen und trat schließlich als Vortragskünstler auf. In seinen Gedichten mischt sich in eigenartiger Weise groteske Phantastik mit warmem Empfinden. Nach Jahren schweren Leidens starb er in völliger Armut in Berlin«, das schrieb bemüht ein sächsischer Lokalhistoriker.2
»Wurzen!?!?! – ach du liebe Zeit! Mein Wurzen.«3 Alles begann in der Mulde-Stadt. Mit Nässe und Feuchtigkeit. Mit Farben. Mit Angst und mit Weinen. Und mit der Sonne. »Ein Dienstmädchen trug mich auf dem Arm oder führte mich an der Hand.« So lautet der erste Satz seines Erinnerungsbuches Mein Leben bis zum Kriege (1931). »Es war noch jemand dabei. Wir standen am Rande eines trostlos schlammfarbenen Wassers, das in die Stadt eingedrungen war und – wenn mein Kleinkindergehirn recht verstand – immer höher stieg. Und der Himmel war gewittergelb. So schlimm, so trostlos war das!«4 Am 7. August 1883 kam Hans Gustav zur Welt. Sein Vater, Georg Bötticher, war gefragter Musterzeichner von Tapeten und Teppichen. Ende März 1888 verließ die Familie Wurzen und zog ins 30 Kilometer entfernte Leipzig. Die Musterzeichnungen des Vaters gingen nach Paris und Schweden, nach Russland und in die USA. Nach 1900 verschlechterte sich seine Sehkraft. Ab dem Jahr 1905 war er nur noch literarisch tätig. Was er schon seit Mitte der 1870-er Jahre gewesen war, er hatte beliebte Humoresken, Parodien, ironische Gedichte verfasst. War Leipzig 1871 die achtgrößte deutsche Großstadt gewesen, so 1895 mit 566 000 Einwohnern nach Berlin, Hamburg und München die vierte. Leipzig war nach der Jahrhundertwende Industriekapitale und Zentrum der Arbeiterbewegung. Und: Leipzig war Bücherstadt, Deutschlands literarisches Epizentrum.
Für den kleinen Hans war »der größte Eindruck der Fluss mit seiner Uferromantik. Zwischen den Löchern und dem wirren Gestrüpp der steilen Abhänge kletternd, kämpfend, forschend, erlebte ich die Abenteuer meiner Sehnsucht voraus. Der Fluss trug seltsame Gegenstände vorbei. Am andern Ufer war eine Pferdeschwemme. Es war ein spannendes Schauspiel, wenn dort Rosse ins Wasser geritten oder geführt wurden. Einmal, zweimal trieben dort Leichen an. Noch unheimlicher waren die hohen alten Pappeln an unserem Ufer. Die hohen Pappeln mit ihrem zitternden und schillernden Blättermillionen-Gewoge. Im Sturme neigten sie sich so beängstigend tief hin und her, als drohten sie, jeden Moment auf uns hereinzubrechen. Sie rauschten unsagbar unheimlich in meine einsame Kinderphantasie.«5
Der Vater war die Leitfigur des Drittgeborenen. Ihm eiferte er nach. Zur Mutter bestand ein eher gespanntes Verhältnis. »Mutterliebe fehlt uns beiden. Schade! aber es muß auch ohne die gehn«, bekannte er Jahre später.6 Hans war ein aufgeweckter Junge, fing sich blaue Flecken und so manche Beule ein. Er fing an zu malen, heitere Verse zu verfassen, kleine Geschichten zu erfinden. Mit neun Jahren schenkte er dem Vater zu Weihnachten ein selbst geschriebenes und eigenhändig illustriertes Büchlein.
Die Schulzeit war bis zum Ende quälend. In den Pausen war er der Allotria treibende Clown, der Streiche spielte, bockte und wider Disziplin und Regeln löckte. Die Zeugnisse stürzten nicht nur ihn in Not und Verzweiflung. Das Betragen des Jungen mit dem hellblonden Haar und dem offenen, gewitzten Gesicht wurde mit der schlechtesten Kopfnote, einer Fünf, bewertet.7 Mit 14 wurde er des Staatsgymnasiums verwiesen. Die Eltern steckten ihren ungebärdigen Sohn in eine der gefürchtetsten »Pressen« Leipzigs, in eine Drill-Einrichtung. Rettung war der weichherzige, sensible Vater. Was Hans durch den öden Alltag des Paukens brachte, war seine Passion fürs Zeichnen und Malen. Und Lesen. Er las viel, sehr viel. Im März 1901 bestand er die Abschlussprüfungen – am verblüfftesten darüber: er selbst. Nun entschied sich Hans Bötticher für Schwankendes. Fürs Meer.
Die Marine löste um 1900 mythische Träume von Macht, Kolonien und einem »Platz an der Sonne« aus. 1901, mit 17, fuhr Hans Bötticher zur See. Statt maritimer Romantik erlebte er mit den O-Beinen, der großen Nase und dem sächsischen Tonfall das Gegenteil: Entbehrungen, Härte und schwere körperliche Arbeit, eine rigide Hackordnung, Hänseleien und Demütigungen. Die abenteuerlichen Szenen an fernen Küsten, die er sich in Leipzig ausgemalt hatte, blieben aus. Er kam weit herum, nach Britisch-Honduras, dem heutigen Belize, nach Großbritannien, befuhr Nord- und Ostsee, die Levante, den Atlantik.
1903 endete sein wechselhafter Dienst. Da Hans Bötticher die neuen gesetzlichen Vorgaben einer bestimmten Sehstärke nicht erfüllte, verbot ihm die Berufsgenossenschaft fürderhin anzuheuern. Nicht übermäßig geknickt, entschied er sich für eine Arbeit als Kaufmann. In Hamburg. Für ein Jahr. 1904 wurde er zum einjährigen Dienst bei der Kriegsmarine eingezogen. Danach retour ins Kaufmannskontor. Die Metamorphose zum bürgerlichen Angestellten schien perfekt: Handelsschule, Tanzkurs, Pianola-Unterricht. Daneben schrieb er. Seine Gedichte und Reime sendete er an Zeitschriften. Und bekam alles retourniert. Nach zwei Jahren brach er aus, reiste nach England. Die Hafenstadt Hull war sein Ziel, in Erinnerung an eine unerfüllt gebliebene amouröse Begegnung aus seiner Matrosenzeit. Bötticher schlug sich als Mandolinensänger durch. Sein Repertoire umfasste nur eine Handvoll Melodien, darunter sein Lieblingslied La Paloma. In Belgien geriet er in Haft und wurde zwangsweise nach Deutschland expediert.
Die nächste Attraktion lag im Süden. München, die Stadt in Oberbayern, brachte Hans Bötticher Anderes, sie ließ ihn Neues ausprobieren und entdecken – sich. In einer Metamorphose. In einer neuen Verwandlungsstufe.
Das Leben war südlich leicht. Und er nahm es so. Er entdeckte Schwabing. München mit seinem speziellen Klima leuchtete jedoch entgegen der Behauptung Thomas Manns nachts nur in begrenztem Umfang. 1907 hatten rund zwei Drittel der Wohnungen in der Altstadt elektrisches Licht, in der Maxvorstadt und in Schwabing war es nur knapp die Hälfte. Um so auffälliger war die Laterne über dem Eingang eines Gasthauses in der Türkenstraße, die zweite Querstraße hinter dem Hauptgebäude der Universität. Diese Straße reicht vom Rand der Altstadt bis zum topografischen, wenn auch nicht kulturellen Auftakt Schwabings, jenem Stadtteil, der einen Ruf genoss als Ort der Boheme, eines fröhlichen Künstlervölkchens, wilder Atelierfeste und ebensolcher Liebespraktiken, als Bezirk politischer Wirrköpfe und Revolutionärer im Exil, von Kaffeehausliteraten, Schnorrern, Lebenskünstlern. Noch auffälliger war im Herbst 1908 das Schild dieses Wirtshauses namens Simplicissimus.
»An einem Nachmittag schlenderten wir durch die Türkenstraße. Da lasen wir ein gelbes Plakat an der Tür eines Restaurants: ›Simplicissimus-Künstlerkneipe‹, illustriert durch einen roten Hund, der eine Sektflasche zu entkorken suchte.
Künstlerkneipe! Künstlerkneipe! Das war ja was wir ersehnten. Wir wagten uns hinein. In dem spärlich beleuchteten Zimmer standen die Stühle noch auf den Tischen. Eine Kellnerin gab uns Auskunft. Die Künstler und Gäste kämen erst abends gegen zehn Uhr.«8 Anfangs war er noch unwissend, wer wer in diesem stets dichtgepackten Lokal war und welcher Poet gerade auf dem winzigen hölzernen Podium stand und eigene Verse rezitierte. Dann, im Fasching, wagte er sich selber darauf, trug Eigenes vor – und fiel krachend, völlig applauslos durch. Er war geknickt. Ließ aber nicht locker. Nach einigen Tagen trat er wieder auf mit einem extra auf die Lokalität gemünzten Poem, das humorvoll und ironisch war, leicht karikierend und in seiner Witzesschärfe genau in die von Alkohol, Geselligkeit und Bonmots aufgeheizte Atmosphäre passte. Als er am Ende des Simplicissimus-Lieds angelangt war, brandete lauter Beifall auf, der kein Ende nehmen wollte. Kathi Kobus, die stämmige, leutselige, finanziell gerissene Wirtin war stolz, derart gewürdigt worden zu sein. Hans Bötticher wurde von ihr zum Leib- und Magenpoeten erkoren.
Der neue Status war mit etwas Geld verbunden. Abends trat er nun regelmäßig im Simplicissimus auf. Er lernte, auch infolge seiner neuen prominenten Position inmitten der Klientel des Künstlertreffpunkts, unzählige neue Menschen kennen. Auch sein Vater kam einmal nach München und erlebte den abendlichen Auftritt des Sohnes mit, der recht kümmerlich honoriert wurde von der Kobus mit einer Mark und einem Teller warmer Suppe pro Abend. Er eröffnete im März 1909 eine Tabakhandlung und musste sie im Dezember desselben Jahres wieder schließen. Er lernte Malerinnen, Künstler, Bohemiens, Komponisten, Autoren und Literaturbesessene kennen, manche Beziehung hielt ein Leben lang. Einige gaben ihm Privatunterricht in alten Sprachen, Geschichte, Literaturhistorie. Ein wenig linderte dies seinen seelischen Minderwertigkeitskomplex wie seinen physischen Selbsthass – Bötticher: »Ich weiß, daß ich häßlich bin. Meine Beine sind krumm. Ich habe ein schiefes, vorstehendes Kinn. In mancher Gesellschaft scherze ich selbst über meine Fehler. Wenn meine Bekannten darüber spaßen, lache ich. In beiden Fällen bin ich unaufrichtig, denn es schmerzt mich innerlich. Ich pflege bei anderen Menschen immer erst auf Kinn und Beine zu sehen. Wie muß das herrlich sein, normale Gliedmaßen zu besitzen. Gewiß ebenso angenehm als das Gefühl gute Kleider, Wäsche und ordentliches Schuhzeug zu haben.«9 Der Journalist René Leclère, der 1910 in der Luxemburger Zeitung einen großen Artikel über den »Simplicissimus« veröffentlichte, erspürte dies beim Auftritt des »Hausdichters«:
Ein hagerer, bleicher Mann, mit einer Adlernase und scharfen, durchdringenden Augen bestieg das Podium.
»Das ist der Bötticher!« raunte mir mein Freund zu.
Der Mann mit dem unruhigen fahlen Gesicht begann Gedichte zu rezitieren.
Gedichte von ihm selbst; aber von solch sprudelnder Lustigkeit, daß es mir unerklärlich war, wie ein Mensch, in dessen Zügen soviel Gram und innere Zerrissenheit lagen, überhaupt noch wissen konnte, was Heiterkeit und Lebensbejahung sei. – Und alles lachte mit ihm; aber ich bemerkte trotzdem, daß in seinen Augen eine endlose Trauer war, eine Trauer, die er zu verbergen suchte und die doch immer hervorsprang, ungebändigt.
Der Hausdichter hielt inne. Man klatschte ihm wütend Beifall. Er dankte kühl und fast wie spöttisch.
Als er an uns vorbeiging, faßte ihn mein Freund am Arm. »Wie geht’s, Bötticher? Setzen Sie sich einen Augenblick zu uns. – Elsa! eine Bowle!«
Der Mann nahm Platz in unserer Nähe.
Bald war ich in ein Gespräch mit ihm vertieft. –
Ich fragte, ob die humoristische Poesie ihm so sehr liege; ob er sich ausschließlich damit beschäftigte. – »Nein«, sagte er darauf, und es schien als sei die Stimmung ernster geworden, – das tue ich, um Geld zu verdienen. Die Leute wollen lachen, und da muß ich mit ihnen lachen.« – »Ein Pierrot- oder Bajazzomotiv«, dachte ich. – Hierauf erzählte er mir lange, daß er andere Gedichtemache, lyrische; wie kein Verleger seine Sachen drucken wolle, weil sie nicht nach dem Geschmack des Publikums seien; wie er es trotzdem nicht lassen könne zu dichten, weil es sein Lebenszweck sei. – Hier sei er lustig, weil er bezahlt werde.10
Seine Unzufriedenheit und Unrast nahmen zu. Aktiv kontaktierte er Verlage. Er wollte die nächste Stufe nehmen: sich, endlich!, als Buchautor gedruckt sehen. 1910 erschien das Kinderbilderbuch Kleine Wesen mit Texten von ihm. Nur wenige Wochen später kam sein erster, dünner Lyrikband heraus. Ein drittes Projekt bahnte sich an, ein autobiografisches, das Schiffsjungentagebuch. Es lag im Januar 1911 in den Buchhandlungen. Im Winter 1911 schwer erkrankt, bedrängten ihn neuerlich akute Geldprobleme. Ein guter Freund lud ihn auf das Anwesen seiner adeligen Familie in Kurland im Baltikum ein. Natur, Idylle, Ruhe! Bald bezog er ein kleines Häuschen in Bilderlingshof (heute Bulduri) von Riga-Strand (heute Jurmala, Lettland). Den Winter verbrachte er dort – und erfror fast. Im Januar 1912 fand er neue Anstellung, beim Grafen Yorck von Wartenburg auf Schloss Klein Oels, Kreis Ohlau, in Niederschlesien, als Bibliothekar (»50 000 Bände u. wertvolle Kunstsammlungen ordnen, 3 Stunden Arbeit täglich; kein Honorar aber alles frei u. Zeit zu eigenen Arbeiten!«).11 Bis Ende 1912 sollte er dort sein. Danach für drei Monate Hannover, Bibliothekar bei Freiherrn Börries von Münchhausen. Anschließend Eisenach in Thüringen. Er kam bei einer Bekannten und literarischen Verehrerin unter, die ein Mädchenpensionat betrieb. Im Jahr 1913 fand er dort seine erste größere Liebe. Verlobung. Entlobung. Dann Bibliothekar auf Burg Lauenstein in Oberfranken – nur gab es dort kein einziges Buch. Stattdessen: Fremdenführer, der Lügenmärchen auftischte. Rückkehr nach München. Er hielt sich mit dem Verkauf antiquarischer Bücher über Wasser. Wieder Boheme-Leben. Groß die Geldsorgen, immer größer die Schulden. Texte, die er an Zeitschriften schickte, wurden abgelehnt.
Dann brach der Krieg aus. Er wurde zur Marine eingezogen. Langweiliger Dienst in der Deutschen Bucht, in Wilhelmshaven, Cuxhaven, Kiel. Nichts mit heldenhaften Kämpfen. Stattdessen: einfache Tätigkeiten, Stillstehen, Kohleschippen, Antreten, Abzählen, Stillstehen, Rekruten schleifen, Exerzieren, Kohlen schaufeln, Antreten, Abzählen. Abwehr feindlicher Kampfschiffe. Die nie kamen. Dann Baltikum, Kiel und Warnemünde. Und wieder Cuxhaven. Er schrieb weiter; und trat bei Weihnachtsfeiern auf. Für ein Gedicht wurde er an Weihnachten 1916 zum Vizefeuerwerker befördert, im Oktober 1917 zum Leutnant. Die letzte Kriegszeit verbrachte er auf einem abgelegenen Außenposten, wo er sich ein Terrarium einrichtete. Anfang 1918 starb der Vater. Nach einigem rastlosem Kreuz- und Quer-Reisen hörte Hans Bötticher auf zu existieren – und es trat auf: Joachim Ringelnatz. »Im November 19 schrieb ich neuartige Gedichte unter dem Pseudonym Wandelhub«, wie er in seiner Autobiografie verrätselt anmerkte.12 Ganz ungewöhnlich waren Umbenennungen damals nicht. So wählte sich der Berliner Journalist Kurt Tucholsky gleich vier Pseudonyme. Gewandelt und herausgehoben hatte sich Hans Bötticher. Aber wie? Und wieso? Und weshalb Ringelnatz, ausgerechnet »Joachim Ringelnatz«?
Einem Freund soll er einmal gesagt haben, der Name »Ringelnatz« habe keinerlei Bedeutung, er gefalle ihm, weil er ihn schützen würde wie eine Tarnkappe.13 Zumindest das Bild von der Tarnkappe sollte sich als gegenstandslos erweisen. Denn Ringelnatz trat mit Macht und bald auch mit Erfolg, mit immer größerem Erfolg auf. Und mit ihm eine andere Figur, Kuttel Daddeldu. Die Physiognomie beider wurde zur literarischen Fusion. Doch vor Kuttel stand anderes. Das erste Nachkriegsbuch nämlich, das unter dem Namen »Joachim Ringelnatz« veröffentlicht wurde, im Oktober 1920, enthielt die skandalös lustigen Turngedichte, die ihm Durchbruch und Anerkennung brachten. Sie waren parodistisch subversiv, weil sie den manisch betriebenen Turnsport tief durch den Kakao zogen. Martialischem Körperpathos entzog Ringelnatz durch grotesken Klamauk und abseitige Pointen und unerwartet große Fallhöhen – nicht jede leibliche Äußerung ist eine diskret kontrollierbare (Stichwort: Darmwind) – jeden Grund. Unter der Hand waren seine so witzsprühenden Poeme hochliterarisch, spielten mit Gedichten Goethes, Heines, anderer heute vergessener, einst beliebter Autoren des 19. Jahrhunderts. Und waren dabei hochmodern, etwa das lautmalerische Gedicht über einen Boxkampf, das so einsetzt: »Bums! – Kock, Canada: – Bums! / Käsow aus Moskau: Puff! Puff! / Kock der Canadier: – Plumps!«.
Ebenfalls 1920 erschien Kuttel Daddeldu oder das schlüpfrige Leid: der zweite, der endgültige Durchbruch. Beide Bücher werden rasch nachgedruckt. Noch rascher wurde Ringelnatz nun gebucht, als Vortragskünstler. Er wurde zum »reisenden Artisten«. Und trug seine Texte auf der Bühne vor, in Sälen, großen Theatern und Cabarets. Die nächsten zwölf Jahre sollte er, neun bis zehn Monate pro Kalenderjahr, unablässig reisen. Fand so neue Stoffe, Themen, Impressionen, etwa für seine Stadtgedichte. Und schrieb immer und überall, Gedichte, Prosa, Briefe, sehr viele Briefe, in der Bahn, im Hotelzimmer, im Restaurant, auf der Aussichtsterrasse. Wurde überaus gefragter und umworbener Mitarbeiter vieler Zeitungen, Zeitschriften und Magazine, die seine Gedichte abdruckten; daneben malte er bemerkenswert gut; das ihm gewidmete feine Museum in Cuxhaven präsentiert heute die größte Auswahl seiner Gemälde.
Mit Kuttel Daddeldu verschmolz er für jene, die glaubten, auch im Privatleben trage Ringelnatz Matrosenanzug und sei immer angetrunken. Das Gegenteil stimmte, er schätzte gepflegte Kleidung und war immens produktiv: In 15 Jahren entstand ein Werk, das insgesamt 3000 (!) Buchseiten umfasst. Kuttel – das ist der Mariner, der alle Vorurteile der »Landratten« über das Leben der Matrosen glänzend bestätigt, ein jederzeit wie allerorten angetrunkener Seebär. Und ein naiver Trickster, sobald er die nassen maritimen Planken verlässt und einen Fuß auf festen Boden setzt. Wetterfest ist er, kosmopolitisch diverse Sprachen miteinander verschneidend – »Gud morning! – Sdrastwuide! – Bong Jur, Daddeldü! / Bon tscherno! Ok phosphor! Tsching – tschung! Bablabü!«14 – aufschneiderisch, bramabarsierend, prahlerisch. Als Schwerenöter sucht er das Herz am rechten Fleck der Seemannsbräute, die allzu oft abgewrackte Huren sind, in Hafenstädten, in denen ihm seine Heuer wie Sand aus den Taschen rinnt.
»Vielleicht«, meinten 1928 Hermann Sinsheimer und Peter Scher in ihrem Buch von München – und Scher war ein langjähriger, enger Freund Ringelnatzens –, »ist es überhaupt die Zeit, die, selber ringelnatzend, ihn erwählt hat, sie in all ihrer verwegenen, munteren und trotz scheinbar übertriebener Sachlichkeit doch eben wieder phantastischen Art so humorvoll auszudrücken.«15
Schon früh verstand sich der Sohn eines Schriftstellers auch als Sprachspieler, hatte Sprachspiele artistisch und verliebt in Klang, Alliteration, Reim und Assonanzen durchexerziert. Er hatte in München Umgang mit Mitgliedern der Hermetischen Gesellschaft gehabt, die, als handele es sich um ein Kloster oder einen Orden, für den Eintritt in ihre Reihen neue Namen ausgegeben hatten.16 Während seiner Jahre auf See hatte er erlebt, dass einem jeden ein Kurz- oder Spitzname angehängt wurde, etwa »Schlangenmensch« für einen gelenkigen Matrosen, »Stiefbeen« für einen ungelenkigen. Er selber war an Bord als Aas, als Bengel oder, seine Nase im Blick, als Specht tituliert worden.17 Er selber hatte seinen Hund »Frau Werner« genannt. Vor allem aber in seinen Korrespondenzen hatte er außergewöhnliche Anreden kreiert: »Mi« und »Bampf« und »Schneehase« für Freundinnen, »Muckelmann« für einen Hamburger Bekannten, »Otterfell« für seine Schwester Ottilie.18 Und die wichtigste Frau seines Lebens, Leonharda Pieper, die ihn um 43 Jahre überleben sollte, nannte er zärtlich »Muschelkalk«.
»Mit meinesgleichen, den sogenannten Humoristen,« klagte schon anno 1918 der österreichische Humorist Alexander Roda Roda, »pflegt sich die Literaturgeschichte nur ganz hinten im Anhang zu befassen, flüchtig und in kleiner Schrift; auch das erst, wenn unsereins lange genug tot ist.«19 »Humoristische«, unterhaltsame, leichte und scheinbar leichthändige Literatur ist noch immer das kleine, schiefe Stiefkind der Germanistik, das nur aus dem Augenwinkel wahrgenommen wird. Offenbar weil dieses Genre sich mit diebischem Vergnügen den humorbefreiten Anstrengungen der Deutungswissenschaften entzieht. Auf Ringelnatzens Schultern standen und stehen Heinz Erhardt und unzählig viele Nachfolgende, vom Hochseil-Lyriker Peter Rühmkorf (der sich eines erbat: »daß ihr vielleicht in die unterste Stufe / der Ringelnatztreppe / meinen Namen einkerbt.«20) bis zu Harry Rowohlt, Heino Jaeger oder Robert Gernhardt – die aber Ringelnatz nie imitieren konnten. Denn dessen an der Oberfläche konventionell gereimte Gedichte scheinen kleingroße À propos, Scheinbar-Nebenher-Verse, zu sein, sind aber ausgefeilt bis ins Kleinste und hochliterarisch – man hört immer wieder Heinrich Heine hindurch, Carl Michael Bellman und andere –, und viel nachdenklicher und tiefer, als das erste Hören, das erste Lachen es glauben machen wollen, die erste Lektüre trügt immer wieder. Sie sind ironisch und tragisch. Trotz der immensen Fülle finden sich in jedem eine überraschende Formulierung, Reiz und Glanz und stilistische Geistesblitzigkeit. Ringelnatz war mehr als »nur« ein »Humorist«, viel mehr als ein Komiker. Er kannte Zerrissenheit und Melancholie und Niederlagen und Aufschwung (nicht nur am Reck) und überschwänglichen Witz und gewaltiges Glück im Moment. Er besaß einen untrüglichen Sensus für den schief-absurden Anhauch der Welt, die von ihm wieder und wieder Lacher und Unterhaltung erwartete. Diesen Zwiespalt von Ablehnung und Rollenerwartung, Konformitätsattitüde und dissonant erklingender origineller Kreativität erkannte Ringelnatz selber und brachte dies im Gedicht Der Komiker auf den Punkt:21
Ein Komiker von erstem Rang
Ging eine Straße links entlang.
Die Leute sagten rings umher
Hindeutend: »Das ist der und der!«
Der Komiker fuhr aus der Haut
Nach Haus und würgte seine Braut.
Nicht etwa wie von ungefähr,
Nein ernst, als ob das komisch wär.
Das Ende von Joachim Ringelnatz war alles andere als komisch. 1930 aus München nach Berlin umgezogen und Autor im namhaften Ernst Rowohlt Verlag, sah er nun akut und scharf die Bedrohung der Demokratie und den Aufstieg der Nationalsozialisten. Ab 1933 konnte er kaum mehr publizieren, verdiente immer weniger, weil seine Bücher nicht nachgedruckt oder aus dem Buchhandel entfernt wurden. Da war er bereits unheilbar an Tuberkulose erkrankt. Er starb am 17. November 1934 im Alter von 51 Jahren. Drei Tage später wurde er auf dem Friedhof an der Heerstraße in Berlin beigesetzt (hier wurde auch Loriot begraben), seine Grabstätte befindet sich noch heute dort (Feld 12-D-21). »Dienstag, ½ 3 Uhr ganz nahe in einem Waldfriedhof, der in dichtem Nebel lag«, so seine Schwester, »war eine wunderschöne kleine Feier in einer mit Kerzen u. Lorbeeren reich geschmückten Halle, auf dem Sarg lag die Fahne u. ein Sträußchen von Muschelkalk u. es erklangen von der Orgel Seemannslieder u. zuletzt ›La Paloma‹ u. unter diesen Klängen wurde der Sarg hinaus getragen.«22
Von Joachim Ringelnatz ausgefüllter Fragebogen im Gästebuch seines Hamburger Freundes Carl H. Wilkens [Hautana, die Antwort bei Nr. 16, war der erste seriell hergestellte und 1913 patentierte Büstenhalter]:23
| 1. Frage: | Was essen Sie am liebsten? | Austern. |
| 2. Frage: | Welches Temperament ist bei Ihnen vorherrschend? | Das linke. |
| 3. Frage: | Haben Sie eine Weltanschauung? | Eine ganz kleine. |
| 4. Frage: | Wie heißt Ihre Lieblingsblume? | Seegras. |
| 5. Frage: | Was ist Ihnen die Erotik? | Heimlicher Sport. |
| 6. Frage: | Welchen Duft schätzen Sie sehr? | W. C. |
| 7. Frage: | Was verstehen Sie unter Glück? | Dito. |
| 8. Frage: | Wie denken Sie über Frauen? | Ähnlich. |
| 9. Frage: | Was trinken Sie am liebsten? | Terpentinöl. |
| 10. Frage: | Welche Meinung haben Sie von der Ehe? | Eine dicke Ehrfurcht. |
| 11. Frage: | Sind Sie diskret? | Warum nicht! |
| 12. Frage: | Warum nicht? | Weshalb denn? |
| 13. Frage: | Haben Sie Takt? | Ja, mehrere. |
| 14. Frage: | Welches Buch lieben Sie vor allem? | Das Hamburger Adreßbuch. |
| 15. Frage: | Wie ist Ihr Verhältnis zu Kunst und Wissenschaft? | Ein inniges. |
| 16. Frage: | Welche Ausdrucksform und Richtung bevorzugen Sie? | Hautana. |
| 17. Frage: | Haben Sie ein Ziel? | Nicht bei mir. |
| 18. Frage: | Was erregt Ihre absolute Abneigung? | Der Tod. |
In dem postum erschienenen Kasperle-Bilderbuch, das Joachim Ringelnatz im Winter 1933 für die kleine Tochter eines Bekannten getextet hatte, ist zu lesen:
Ich komme und gehe wieder,
Ich, der Matrose Ringelnatz.
Die Wellen des Meeres auf und nieder
Tragen mich und meine Lieder
Von Hafenplatz zu Hafenplatz.
Ihr kennt meine lange Nase,
Mein vom Sturm zerknittertes Gesicht.
Daß ich so gern spaße
Nach der harten Arbeit draußen,
Versteht ihr das?
Oder nicht?24
1Franz Blei, Das große Bestiarium der Literatur, hrsg. und mit einem Nachwort von Rolf-Peter Baacke, Hamburg 1995, S. 58 f.
2Heinz Mattick: Wurzen. Landschaft Geschichte Menschen. Ein Führer durch das Städtische Heimatmuseum, zugleich ein Versuch, die Heimatgeschichte vom Gegenständlichen her darzustellen, Wurzen 1938, S. 45
3Joachim Ringelnatz: Das Gesamtwerk in sieben Bänden (GW), hrsg. von Walter Pape, Zürich 1994, Bd. 5, S. 314
4GW, Bd. 6, S. 5
5Ebd., Bd. 6, S. 7
6Joachim Ringelnatz: Briefe, hrsg. von Walter Pape, Berlin 1988, S. 228
7GW, Bd. 6, S. 19
8GW, Bd. 6, S. 222
9GW, Bd. 4, S. 358
10GW, Bd. 6, S. 381
11Joachim Ringelnatz: Briefe, hrsg. von Walter Pape, Berlin 1988, S. 18
12GW, Bd. 5, S. 232
13Herbert Günther: Joachim Ringelnatz mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Reinbek 2011, S. 43
14GW, Bd. 1, S. 131
15Hermann Sinsheimer und Peter Scher: Das Buch von München, München 1928, S. 103
16GW, Bd. 6, S. 282
17GW, Bd. 6, S. 59
18Ringelnatz: Briefe, S. 18, 390
19Rotraut Hackermüller: Einen Handkuß der Gnädigsten. Roda Roda. Bildbiographie, Wien und München 1986, S. 8
20Peter Rühmkorf: Wenn – aber dann. Vorletzte Gedichte, Reinbek 1999, S. 125
21GW, Bd. 1, S. 309
22Ottilie Mitter in einem Brief an ihren Sohn vom 25.11.1934, zit. nach Friederike Schmidt-Möbus und Frank Möbus: Böses Ende 34, in: Frank Möbus, Friederike Schmidt-Möbus, Frank Woesthoff und Indina Woesthoff (Hrsg.): Ringelnatz! Ein Dichter malt seine Welt, Göttingen 2000, S. 256–262, hier S. 261
23Zit. Nach: In memoriam Joachim Ringelnatz. Privatdruck veranstaltet von Muschelkalk Ringelnatz. Leipzig 1937. Neu hrsg. von Frank Möbus, Berlin 2010, S. 79
24Helmut Heintel (Hrsg.): Das Kasperle-Bilderbuch, Ostfildern-Ruit 1993, S. 32