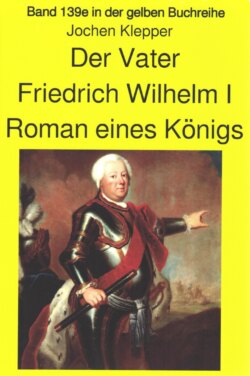Читать книгу Jochen Klepper: Der Vater Roman eines Königs - Jochen Klepper - Страница 4
Der Autor Jochen Klepper
ОглавлениеDer Autor Jochen Klepper
Jochen Kleppers Leben und Werk
(Die folgenden Texte wurden teilweise wikipedia, seinen Büchern und weiteren Quellen entnommen)
Jochen Klepper wurde am 22. März 1903 in Beuthen an der Oder in Schlesien als Sohn eines evangelischen Pfarrers geboren. Er besuchte das Gymnasium in Glogau und studierte anschließend Evangelische Theologie in Erlangen und Breslau.
Prälat Dr. Bernhard Felmberg: Die tragischen Elemente seines Lebens wurden in der nachträglichen Darstellung oft verharmlost. Nicht von ungefähr kommt die Warnung seines wohl besten Freundes aus Schul- und Studienzeiten Harald Poelchau: „Man muss sich hüten, die Biographie Kleppers künstlich zu glätten oder zu idealisieren.“ Doch auch Poelchau, von Paul Tillich stark geprägter religiöser Sozialist, nicht nur Theologe, sondern auch Sozialpädagoge („staatlich geprüfter Fürsorger“), der später Gefängnispfarrer in Tegel war und seit 1941 Mitglied des Kreisauer Kreises, gibt zu: „Meine persönlichen Erinnerungen an das gemeinsame letzte Studienjahr mit Jochen Klepper sind schwer wachzurufen, und sie verformen sich so leicht.“
Kleppers Jugendfreund Harald Poelchau (1903-1972) war eine sehr interessante Persönlichkeit. Ferdinand Schlingensiepen hat ihn sehr gründlich beschrieben. Poelchau, der unzählige Menschen auf ihrem letzten Weg zum Schafott begleitete, verstand es, sehr geschickt, als Gefängnispfarrer in Tegel mit seinen Möglichkeiten als Staatsbeamter bis zum Kriegsende engagiert und mutig vielen Gefangenen, darunter auch Dietrich Bonhoeffer, zu helfen und seelsorgerlich beizustehen, ohne selber der Gestapo ins Netzt zu gehen.
Harald Poelchau
* * *
Rudolf Hermann brachte Jochen Klepper Martin Luther nahe und wurde sein väterlicher Freund. Wegen seines labilen Gesundheitszustandes verzichtete Klepper jedoch darauf, Pfarrer zu werden. Er begann beim Evangelischen Presseverband für Schlesien in Breslau unter Leitung von Kurt Ihlenfeld als Journalist zu arbeiten. Klepper leistete erfolgreiche Pressearbeit und bemühte sich um ein anspruchsvolles Rundfunkprogramm. Währenddessen belastete ihn ein Konflikt mit seinem Vater schwer.
* * *
Am 28. März 1931 heiratete er die um 13 Jahre ältere jüdische Rechtsanwaltswitwe Johanna Stein geborene Gerstel, die ihn bei der Realisierung seines Zieles einer Betätigung als freier Schriftsteller unterstützte. Sie brachte ihre Töchter Brigitte und Renate mit in die Ehe.
Jochen Klepper blieb in seinem ganzen Leben der Tradition des evangelischen Pfarrhauses und dem ursprünglichen Berufsziel verpflichtet. Obwohl er sich nach dem Theologiestudium nicht für den Dienst des Gemeindepfarrers entschied, setzte er sich ständig mit dem geistlichen Amt und dem Pfarrhaus als Lebensraum auseinander und suchte sie auch in seinen anderen Lebensumständen in ihrer geistlich-kulturellen Bedeutung zu verwirklichen. Diese unkonventionelle Erfüllung der geistlichen Tradition in ständiger hellwacher Reflexion kennzeichnet den Menschen Klepper und spricht eindringlich aus seinen Tagebüchern. Aus Verworrenheit und Depressionen der Jugendjahre führte Klepper die Begegnung und Ehe mit Hanni Gerstel heraus. Noch aus den späteren Tagebuchaufzeichnungen geht hervor, in welchem Maß das Verstehen und Vertrauen der reiferen Frau Kleppers Selbstverständnis begründeten und sein künstlerisches Schaffen ermöglichten. Zugleich aber hatte die Verbindung mit einer Jüdin den durch Jahre schmerzvoll erfahrenen Bruch mit Elternhaus und ursprünglichem Berufsziel zur Folge.
Im März 1932 zog die Familie nach Berlin; Jochen Klepper fand eine Anstellung beim Hörfunk, der Funk-Stunde Berlin. Sein Vorgesetzter dort war der Schriftsteller und Filmregisseur Harald Braun.
Sein erster Roman ‚Der Kahn der fröhlichen Leute’, der das Leben an und auf der Oder beschreibt, wurde bei der Deutschen Verlagsanstalt angenommen und 1933 veröffentlicht. Er gilt als anspruchsvolle Heimatdichtung.
Mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten im März 1933 begann die Gleichschaltung des Rundfunks. Da Klepper bis zum Oktober 1932 Mitglied der SPD gewesen war, wurde er Mitte 1933 aus dem Rundfunk entlassen. Er hatte seinerzeit im ‚Vorwärts’ eine Reihe von Reportagen zum Leben der Kinder 1932 geschrieben. Zu dieser Zeit lebte Klepper im Berliner Ortsteil Südende, wo sich heute der Jochen-Klepper-Park mit einem Gedenkstein befindet.
Im Juli 1933 erhielt er eine Stelle im Redaktionsbüro einer Funkzeitschrift. Zum 24. Februar 1934 konnte er seine Aufnahme in die Reichsschrifttumskammer erreichen. 1935 verlor er auch die anschließende Tätigkeit beim Ullstein-Verlag.
Da Johanna und ihre beiden Töchter nach Definition der Nürnberger Rassegesetze Jüdinnen waren, geriet die Familie zunehmend unter Druck. Jochen Klepper sah in der wachsenden Judenfeindlichkeit Frevel an Gott. Er verfolgte das Zeitgeschehen und auch den Weg der evangelischen Kirche zwischen Anpassung und Bekennender Kirche mit großer Anteilnahme und Sorge.
Seit 1933 stellte er seinen Tagebuchaufzeichnungen die Herrnhuter Losungen der Brüdergemeine voran und lebte viel bewusster mit dem Bedenken des Wortes Gottes.
Im Oktober 1934 besuchte er seinen sterbenden Vater in Beuthen an der Oder.
Auf Anregung von Reinhold Schneider schrieb er für die Weißen Blätter; sein erster Artikel erschien dort im Dezember 1935.
Klepper erwog die Flucht ins Ausland, konnte sich aber nicht dazu überwinden.
Auch nachdem eine Sondergenehmigung die Fortführung der schriftstellerischen Tätigkeit ermöglichte, blieb sie von Kontrollen und Einschränkungen belastet.
Kleppers Widerstand gegen das Regime zeichnete sich durch die Bemühung um ein gerechtes Urteil aus: Er versagte sich lange die einseitige Ablehnung, suchte an der Idee des Vaterlandes festzuhalten, wie es nicht zuletzt seine intensive Beschäftigung mit der preußischen Tradition verlangte, zu der ihn ‚Der Vater’ veranlasst hatte. Kleppers Werk und Schicksal brachten ihm Kontakte mit führenden Persönlichkeiten des geistigen Widerstandes.
Am intensivsten war wohl die Freundschaft mit Reinhold Schneider (1903 – 1958).
Reinhold Schneider setzte sich intensiv mit dem totalitären NS-Regime auseinander, schrieb dagegen an und wählte schließlich den Weg der „inneren Emigration“. Er prägte mit seinen Liedern das geistliche Leben christlicher Jugendgruppen der Nachkriegszeit.
Im Jahr 1938 erschien seine kritische Szenenfolge ‚Las Casas vor Karl V.’, in welcher Unterdrückung, Rassenwahn und falsch verstandene Religiosität angeprangert werden (vom Herausgeber dieses Bandes Anfang der 1950er mit großer Anteilnahme gelesen).
Jochen Klepper liebte die Stadt Berlin, Naturerleben, eine gepflegte Häuslichkeit, Blumen und Musik; er pflegte Freundschaften. Er litt darunter, keine leiblichen Kinder zu haben, war oft schwermütig.
* * *
Am 18. Dezember 1938 ließ sich Johanna Klepper in der Martin-Luther-Gedächtniskirche, Berlin-Mariendorf, von Pfarrer Kurzreiter taufen. Anschließend wurde das Ehepaar Klepper kirchlich getraut.
Seine ältere Stieftochter, Brigitte, konnte kurz vor Kriegsausbruch über Schweden nach England ausreisen. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs verschärfte sich die Verfolgung der Juden.
Ab 1938 wohnte die Familie in Berlin-Nikolassee in der Teutonenstraße 23.
Jochen Klepper erhielt am 25. November 1940 die Einberufung zur Wehrmacht und war vom 5. Dezember 1940 bis 8. Oktober 1941 Soldat. Klepper wurde in Polen und auf dem Balkan eingesetzt und nahm schließlich im Stab einer Nachschubeinheit der 76. Infanterie-Division, Heeresgruppe Süd, von Rumänien durch Bessarabien am Angriff auf die Sowjetunion teil.
In seinen sehr interessanten Kriegstagebüchern schildert er seine Erlebnisse in diesem knappen Jahr.
* * *