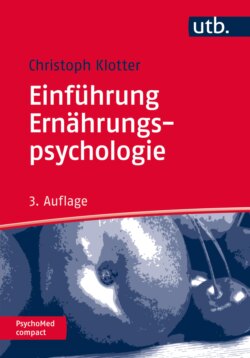Читать книгу Einführung Ernährungspsychologie - Johann Christoph Klotter - Страница 6
ОглавлениеInhalt
Hinweise zur Benutzung dieses Lehrbuches
1 Gesellschaftlich-kulturelle und soziale Determinanten der Ernährung
1.1 Schlaraffenland
1.2 Zwei Ernährungstraditionen: die mediterrane und die „barbarische“
1.3 Kulturelle und soziale Lebensmittelpräferenzen
1.4 Arm und reich: Essen als Mittel der sozialen Distinktion
1.5 Kultur und Essstörungen
1.6 Soziale Lage und Gesundheit
1.7 Soziale Lage und Ernährung
1.8 Sozialisation und Ernährungsverhalten
1.9 Soziologische Modelle der Ernährung
1.10 Zusammenfassung des ersten Kapitels
1.11 Fragen zum ersten Kapitel
2 Psyche, Soma und die Nahrungsaufnahme
2.1 Die klassische Psychosomatik
2.2 Von der klassischen Psychosomatik zum bio-psycho-sozialen Modell
2.3 Ein somatopsychischer Zusammenhang: Wie wirkt sich Ernährung auf die Psyche aus?
2.4 Verhaltensmedizin
2.5 Zusammenfassung des zweiten Kapitels
2.6 Fragen zum zweiten Kapitel
3 Psychologische Schulen und Ansätze: ihre Perspektiven auf ungestörtes/gestörtes Ernährungsverhalten
3.1 Lerntheorien
3.1.1 Pawlow: Klassisches Konditionieren
3.1.2 Skinner: Operantes Konditionieren
3.1.3 Das Menschenbild und das Forschungsprogramm des Konditionierens
3.1.4 Kognitive Lerntheorien
3.2 Psychoanalyse
3.2.1 Die Grundannahmen der Psychoanalyse
3.2.2 Die Triebtheorie
3.3 Humanistische Ansätze
3.3.1 Die Grundannahmen der Humanistischen Ansätze
3.3.2 Maslow
3.3.3 Rogers
3.4 Kognitive Ansätze
3.5 Systemische Ansätze
3.6 Historische Ansätze
3.7 Biografische Ansätze
3.8 Zusammenfassung des dritten Kapitels
3.9 Fragen zum dritten Kapitel
4 Essstörungen
4.1 Was ist eine Krankheit?
4.2 Adipositas
4.2.1 Definition und Diagnose
4.2.2 Epidemiologie
4.2.3 Folgeerkrankungen, psychosoziale Konsequenzen und gesellschaftliche Kosten
4.2.4 Ätiologie
4.2.5 Eine Fall-Vignette zur Adipositas: Frau A
4.3 Bulimia nervosa
4.3.1 Definition und Diagnose
4.3.2 Epidemiologie
4.3.3 Folgeerkrankungen, psychosoziale Konsequenzen und gesellschaftliche Kosten
4.3.4 Ätiologie
4.3.5 Eine Fall-Vignette zur Bulimia nervosa: Frau B
4.4 Anorexia nervosa
4.4.1 Definition und Diagnose
4.4.2 Epidemiologie
4.4.3 Folgeerkrankungen und gesellschaftliche Kosten
4.4.4 Ätiologie
4.4.5 Fall-Vignette zur Anorexia nervosa: Frau C
4.5 „Binge-Eating“-Störung
4.6 Zusammenfassung des vierten Kapitels
4.7 Fragen zum vierten Kapitel
5 Gesundheitspsychologische Modelle und Ernährungsverhalten
5.1 Health Action Process Approach oder Das Sozial-kognitive Prozessmodell gesundheitlichen Handelns nach Schwarzer
5.2 Das Transtheoretische Modell der Verhaltensänderung nach Prochaska
5.3 Salutogenese nach Antonovsky
5.4 Zusammenfassung des fünften Kapitels
5.5 Fragen zum fünften Kapitel
6 Interventionen
6.1 Gesundheitsaufklärung und -erziehung
6.2 Prävention
6.3 Verhaltens- oder Verhältnisprävention
6.4 Gesundheitsförderung
6.5 Beratung
6.5.1 Grundlagen der Beratung
6.5.2 Ein Beispiel für ein Beratungsgespräch
6.6 Psychotherapie
6.6.1 Verhaltenstherapie
6.6.2 Psychoanalyse
6.6.3 Die Gesprächspsychotherapie nach Rogers
6.7 Störungsspezifische Interventionen bei Essstörungen
6.7.1 Störungsspezifische Interventionen bei Adipositas
6.7.2 Störungsspezifische Interventionen bei Bulimia nervosa und Anorexia nervosa
6.8 Effekte von Interventionen gegen Essstörungen
6.8.1 Effekte bei der Adipositasbehandlung
6.8.2 Effekte bei der Behandlung von Bulimia nervosa und Anorexia nervosa
6.9 Public Health und Public Health Nutrition
6.10 Zusammenfassung des sechsten Kapitels
6.11 Fragen zum sechsten Kapitel
7 Wissenschaftstheorie und Forschungsmethoden
7.1 Was ist empirische Forschung?
7.2 Wissenschaftstheorie
7.3 Forschungsmethoden
7.4 Epidemiologie
7.5 Zusammenfassung des siebten Kapitels
7.6 Fragen zum siebten Kapitel
Zitierte Literatur
Weiterführende Literatur
Sachregister