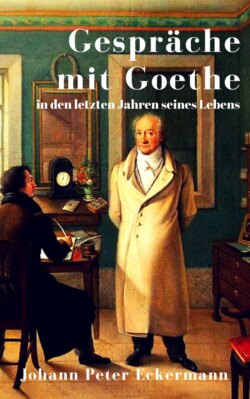Читать книгу Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens - Johann Peter Eckermann - Страница 7
1824
ОглавлениеDienstag, den 27. Januar 1824
Goethe sprach mit mir über die Fortsetzung seiner Lebensgeschichte, mit deren Ausarbeitung er sich gegenwärtig beschäftigt. Es kam zur Erwähnung, daß diese Epoche seines spätern Lebens nicht die Ausführlichkeit des Details haben könne wie die Jugendepoche von ›Wahrheit und Dichtung‹.
»Ich muß«, sagte Goethe, »diese späteren Jahre mehr als Annalen behandeln; es kann darin weniger mein Leben als meine Tätigkeit zur Erscheinung kommen. Überhaupt ist die bedeutendste Epoche eines Individuums die der Entwickelung, welche sich in meinem Fall mit den ausführlichen Bänden von ›Wahrheit und Dichtung‹ abschließt. Später beginnt der Konflikt mit der Welt, und dieser hat nur insofern Interesse, als etwas dabei herauskommt.
Und dann, das Leben eines deutschen Gelehrten, was ist es? Was in meinem Fall daran etwa Gutes sein möchte, ist nicht mitzuteilen, und das Mitteilbare ist nicht der Mühe wert. Und wo sind denn die Zuhörer, denen man mit einigem Behagen erzählen möchte?
Wenn ich auf mein früheres und mittleres Leben zurückblicke und nun in meinem Alter bedenke, wie wenige noch von denen übrig sind, die mit mir jung waren, so fällt mir immer der Sommeraufenthalt in einem Bade ein. Sowie man ankommt, schließt man Bekanntschaften und Freundschaften mit solchen, die schon eine Zeitlang dort waren und die in den nächsten Wochen wieder abgehen. Der Verlust ist schmerzlich. Nun hält man sich an die zweite Generation, mit der man eine gute Weile fortlebt und sich auf das innigste verbindet. Aber auch diese geht und läßt uns einsam mit der dritten, die nahe vor unserer Abreise ankommt und mit der man auch gar nichts zu tun hat.
Man hat mich immer als einen vom Glück besonders Begünstigten gepriesen; auch will ich mich nicht beklagen und den Gang meines Lebens nicht schelten. Allein im Grunde ist es nichts als Mühe und Arbeit gewesen, und ich kann wohl sagen, daß ich in meinen fünfundsiebzig Jahren keine vier Wochen eigentliches Behagen gehabt. Es war das ewige Wälzen eines Steines, der immer von neuem gehoben sein wollte. Meine Annalen werden es deutlich machen, was hiemit gesagt ist. Der Ansprüche an meine Tätigkeit, sowohl von außen als innen, waren zu viele.
Mein eigentliches Glück war mein poetisches Sinnen und Schaffen. Allein wie sehr war dieses durch meine äußere Stellung gestört, beschränkt und gehindert! Hätte ich mich mehr vom öffentlichen und geschäftlichen Wirken und Treiben zurückhalten und mehr in der Einsamkeit leben können, ich wäre glücklicher gewesen und würde als Dichter weit mehr gemacht haben. So aber sollte sich bald nach meinem ›Götz‹ und ›Werther‹ an mir das Wort eines Weisen bewähren, welcher sagte: wenn man der Welt etwas zuliebe getan habe, so wisse sie dafür zu sorgen, daß man es nicht zum zweiten Male tue.
Ein weitverbreiteter Name, eine hohe Stellung im Leben sind gute Dinge. Allein mit all meinem Namen und Stande habe ich es nicht weiter gebracht, als daß ich, um nicht zu verletzen, zu der Meinung anderer schweige. Dieses würde nun in der Tat ein sehr schlechter Spaß sein, wenn ich dabei nicht den Vorteil hätte, daß ich erfahre, wie die anderen denken, aber sie nicht, wie ich.«
Sonntag, den 15. Februar 1824
Heute vor Tisch hatte Goethe mich zu einer Spazierfahrt einladen lassen. Ich fand ihn frühstückend, als ich zu ihm ins Zimmer trat; er schien sehr heiterer Stimmung.
»Ich habe einen angenehmen Besuch gehabt,« sagte er mir freudig entgegen; »ein sehr hoffnungsvoller junger Mann, Meyer aus Westfalen, ist vorhin bei mir gewesen. Er hat Gedichte gemacht, die sehr viel erwarten lassen. Er ist erst achtzehn Jahre alt und schon unglaublich weit.
Ich freue mich,« sagte Goethe darauf lachend, »daß ich jetzt nicht achtzehn Jahre alt bin. Als ich achtzehn war, war Deutschland auch erst achtzehn, da ließ sich noch etwas machen; aber jetzt wird unglaublich viel gefordert, und es sind alle Wege verrannt.
Deutschland selbst steht in allen Fächern so hoch, daß wir kaum alles übersehen können, und nun sollen wir noch Griechen und Lateiner sein, und Engländer und Franzosen dazu! Ja obendrein hat man die Verrücktheit, auch nach dem Orient zu weisen, und da muß denn ein junger Mensch ganz konfus werden.
Ich habe ihm zum Trost meine kolossale Juno gezeigt, als ein Symbol, daß er bei den Griechen verharren und dort Beruhigung finden möge. Er ist ein prächtiger junger Mensch! Wenn er sich vor Zersplitterung in acht nimmt, so kann etwas aus ihm werden.
Aber, wie gesagt, ich danke dem Himmel, daß ich jetzt, in dieser durchaus gemachten Zeit, nicht jung bin. Ich würde nicht zu bleiben wissen. Ja selbst wenn ich nach Amerika flüchten wollte, ich käme zu spät, denn auch dort wäre es schon zu helle.«
Sonntag, den 22. Februar 1824
Zu Tisch mit Goethe und seinem Sohn, welcher letztere uns manches heitere Geschichtchen aus seiner Studentenzeit, namentlich aus seinem Aufenthalt in Heidelberg erzählte. Er hatte mit seinen Freunden in den Ferien manchen Ausflug am Rhein gemacht, wo ihm besonders ein Wirt in gutem Andenken geblieben war, bei dem er einst mit zehn andern Studenten übernachtet und welcher unentgeltlich den Wein hergegeben, bloß damit er einmal seine Freude an einem sogenannten Kommersch haben möge.
Nach Tisch legte Goethe uns kolorierte Zeichnungen italienischer Gegenden vor, besonders des nördlichen Italiens mit den Gebirgen der angrenzenden Schweiz und dem Lago Maggiore. Die Borromäischen Inseln spiegelten sich im Wasser, man sah am Ufer Fahrzeuge und Fischergerät, wobei Goethe bemerklich machte, daß dies der See aus seinen ›Wanderjahren‹ sei. Nordwestlich, in der Richtung nach dem Monte Rosa stand das den See begrenzende Vorgebirge in dunkelen blauschwarzen Massen, so wie es kurz nach Sonnenuntergange zu sein pflegt.
Ich machte die Bemerkung, daß mir, als einem in der Ebene Geborenen, die düstere Erhabenheit solcher Massen ein unheimliches Gefühl errege und daß ich keineswegs Lust verspüre, in solchen Schluchten zu wandern.
»Dieses Gefühl«, sagte Goethe, »ist in der Ordnung. Denn im Grunde ist dem Menschen nur der Zustand gemäß, worin und wofür er geboren worden. Wen nicht große Zwecke in die Fremde treiben, der bleibt weit glücklicher zu Hause. Die Schweiz machte anfänglich auf mich so großen Eindruck, daß ich dadurch verwirrt und beunruhigt wurde; erst bei wiederholtem Aufenthalt, erst in späteren Jahren, wo ich die Gebirge bloß in mineralogischer Hinsicht betrachtete, konnte ich mich ruhig mit ihnen befassen.«
Wir besahen darauf eine große Folge von Kupferstichen nach Gemälden neuer Künstler aus einer französischen Galerie. Die Erfindung in diesen Bildern war fast durchgehende schwach, so daß wir unter vierzig Stücken kaum vier bis fünf gute fanden. Diese guten waren: ein Mädchen, das sich einen Liebesbrief schreiben läßt; eine Frau in einem maison à vendre, das niemand kaufen will; ein Fischfang; Musikanten vor einem Muttergottesbilde. Auch eine Landschaft in Poussins Manier war nicht übel, wobei Goethe sich folgendermaßen äußerte: »Solche Künstler«, sagte er, »haben den allgemeinen Begriff von Poussins Landschaften aufgefaßt, und mit diesem Begriff wirken sie fort. Man kann ihre Bilder nicht gut und nicht schlecht nennen. Sie sind nicht schlecht, weil überall ein tüchtiges Muster hindurchblickt; aber man kann sie nicht gut heißen, weil den Künstlern gewöhnlich Poussins große Persönlichkeit fehlt. Es ist unter den Poeten nicht anders, und es gibt deren, die sich z. B. in Shakespeares großer Manier sehr unzulänglich ausnehmen würden.«
Zum Schluß Rauchs Modell zu Goethes Statue, für Frankfurt bestimmt, lange betrachtet und besprochen.
Dienstag, den 24. Februar 1824
Heute um ein Uhr zu Goethe. Er legte mir Manuskripte vor, die er für das erste Heft des fünften Bandes von ›Kunst und Altertum‹ diktiert hatte. Zu meiner Beurteilung des deutschen ›Paria‹ fand ich von ihm einen Anhang gemacht, sowohl in bezug auf das französische Trauerspiel als seine eigene lyrische Trilogie, wodurch denn dieser Gegenstand gewissermaßen in sich geschlossen war.
»Es ist gut,« sagte Goethe, »daß Sie bei Gelegenheit Ihrer Rezension sich die indischen Zustände zu eigen gemacht haben; denn wir behalten von unsern Studien am Ende doch nur das, was wir praktisch anwenden.«
Ich gab ihm recht und sagte, daß ich bei meinem Aufenthalt auf der Akademie diese Erfahrung gemacht, indem ich von den Vorträgen der Lehrer nur das behalten, zu dessen Anwendung eine praktische Richtung in mir gelegen; dagegen hätte ich alles, was nicht später bei mir zur Ausübung gekommen, durchaus vergessen. »Ich habe«, sagte ich, »bei Heeren alte und neue Geschichte gehört, aber ich weiß davon kein Wort mehr. Würde ich aber jetzt einen Punkt der Geschichte in der Absicht studieren, um ihn etwa dramatisch darzustellen, so würde ich solche Studien mir sicher für immer zu eigen machen.«
»Überhaupt«, sagte Goethe, »treibt man auf Akademien viel zu viel und gar zu viel Unnützes. Auch dehnen die einzelnen Lehrer ihre Fächer zu weit aus, bei weitem über die Bedürfnisse der Hörer. In früherer Zeit wurde Chemie und Botanik als zur Arzneikunde gehörig vorgetragen, und der Mediziner hatte daran genug. Jetzt aber sind Chemie und Botanik eigene unübersehbare Wissenschaften geworden, deren jede ein ganzes Menschenleben erfordert, und man will sie dem Mediziner mit zumuten! Daraus aber kann nichts werden; das eine wird über das andere unterlassen und vergessen. Wer klug ist, lehnet daher alle zerstreuende Anforderungen ab und beschränkt sich auf ein Fach und wird tüchtig in einem.«
Darauf zeigte mir Goethe eine kurze Kritik, die er über Byrons ›Kain‹ geschrieben und die ich mit großem Interesse las.
»Man sieht,« sagte er, »wie einem freien Geiste wie Byron die Unzulänglichkeit der kirchlichen Dogmen zu schaffen gemacht und wie er sich durch ein solches Stück von einer ihm aufgedrungenen Lehre zu befreien gesucht. Die englische Geistlichkeit wird es ihm freilich nicht Dank wissen; mich soll aber wundern, ob er nicht in Darstellung nachbarlicher biblischer Gegensätze fortschreiten wird, und ob er sich ein Sujet wie den Untergang von Sodom und Gomorrha wird entgehen lassen.«
Nach diesen literarischen Betrachtungen lenkte Goethe mein Interesse auf die bildende Kunst, indem er mir einen antiken geschnittenen Stein zeigte, von welchem er schon tags vorher mit Bewunderung gesprochen. Ich war entzückt bei der Betrachtung der Naivität des dargestellten Gegenstandes. Ich sah einen Mann, der ein schweres Gefäß von der Schulter genommen, um einen Knaben daraus trinken zu lassen. Diesem aber ist es noch nicht bequem, noch nicht mundgerecht genug, das Getränk will nicht fließen, und indem er seine beiden Händchen an das Gefäß legt, blickt er zu dem Manne hinauf und scheint ihn zu bitten, es noch ein wenig zu neigen.
»Nun, wie gefällt Ihnen das?« sagte Goethe. »Wir Neueren«, fuhr er fort, »fühlen wohl die große Schönheit eines solchen rein natürlichen, rein naiven Motivs, wir haben auch wohl die Kenntnis und den Begriff, wie es zu machen wäre, allein wir machen es nicht, der Verstand herrschet vor, und es fehlet immer diese entzückende Anmut.«
Wir betrachteten darauf eine Medaille von Brandt in Berlin, den jungen Theseus darstellend, wie er die Waffen seines Vaters unter dem Stein hervornimmt. Die Stellung der Figur hatte viel Löbliches, jedoch vermißten wir eine genugsame Anstrengung der Glieder gegen die Last des Steines. Auch erschien es keineswegs gut gedacht, daß der Jüngling schon in der einen Hand die Waffen hält, während er noch mit der andern den Stein hebt; denn nach der Natur der Sache wird er zuerst den schweren Stein zur Seite werfen und dann die Waffen aufnehmen. »Dagegen«, sagte Goethe, »will ich Ihnen eine antike Gemme zeigen, worauf derselbe Gegenstand von einem Alten behandelt ist.«
Er ließ von Stadelmann einen Kasten herbeiholen, worin sich einige hundert Abdrücke antiker Gemmen fanden, die er bei Gelegenheit seiner italienischen Reise sich aus Rom mitgebracht. Da sah ich nun denselbigen Gegenstand von einem alten Griechen behandelt, und zwar wie anders! Der Jüngling stemmt sich mit aller Anstrengung gegen den Stein, auch ist er einer solchen Last gewachsen, denn man sieht das Gewicht schon überwunden und den Stein bereits zu dem Punkt gehoben, um sehr bald zur Seite geworfen zu werden. Seine ganze Körperkraft wendet der junge Held gegen die schwere Masse, und nur seine Blicke richtet er niederwärts auf die unten vor ihm liegenden Waffen.
Wir freuten uns der großen Naturwahrheit dieser Behandlung.
»Meyer pflegt immer zu sagen,« fiel Goethe lachend ein, » wenn nur das Denken nicht so schwer wäre! – Das Schlimme aber ist,« fuhr er heiter fort, »daß alles Denken zum Denken nichts hilft; man muß von Natur richtig sein, so daß die guten Einfälle immer wie freie Kinder Gottes vor uns dastehen und uns zurufen: da sind wir!«
Mittwoch, den 25. Februar 1824
Goethe zeigte mir heute zwei höchst merkwürdige Gedichte, beide in hohem Grade sittlich in ihrer Tendenz, in einzelnen Motiven jedoch so ohne allen Rückhalt natürlich und wahr, daß die Welt dergleichen unsittlich zu nennen pflegt, weshalb er sie denn auch geheimhielt und an eine öffentliche Mitteilung nicht dachte.
»Könnten Geist und höhere Bildung«, sagte er, »ein Gemeingut werden, so hätte der Dichter ein gutes Spiel; er könnte immer durchaus wahr sein und brauchte sich nicht zu scheuen, das Beste zu sagen. So aber muß er sich immer in einem gewissen Niveau halten; er hat zu bedenken, daß seine Werke in die Hände einer gemischten Welt kommen, und er hat daher Ursache, sich in acht zu nehmen, daß er der Mehrzahl guter Menschen durch eine zu große Offenheit kein Ärgernis gebe. Und dann ist die Zeit ein wunderlich Ding. Sie ist ein Tyrann, der seine Launen hat und der zu dem, was einer sagt und tut, in jedem Jahrhundert ein ander Gesicht macht. Was den alten Griechen zu sagen erlaubt war, will uns zu sagen nicht mehr anstehen, und was Shakespeares kräftigen Mitmenschen durchaus anmutete, kann der Engländer von 1820 nicht mehr ertragen, so daß in der neuesten Zeit ein Family-Shakespeare ein gefühltes Bedürfnis wird.«
»Auch liegt sehr vieles in der Form«, fügte ich hinzu. »Das eine jener beiden Gedichte, in dem Ton und Versmaß der Alten, hat weit weniger Zurückstoßendes. Einzelne Motive sind allerdings an sich widerwärtig, allein die Behandlung wirft über das Ganze so viel Großheit und Würde, daß es uns wird, als hörten wir einen kräftigen Alten, und als wären wir in die Zeit griechischer Heroen zurückversetzt. Das andere Gedicht dagegen, in dem Ton und der Versart von Meister Ariost, ist weit verfänglicher. Es behandelt ein Abenteuer von heute, in der Sprache von heute, und indem es dadurch ohne alle Umhüllung ganz in unsere Gegenwart hereintritt, erscheinen die einzelnen Kühnheiten bei weitem verwegener.«
»Sie haben recht,« sagte Goethe, »es liegen in den verschiedenen poetischen Formen geheimnisvolle große Wirkungen. Wenn man den Inhalt meiner ›Römischen Elegien‹ in den Ton und die Versart von Byrons ›Don Juan‹ übertragen wollte, so müßte sich das Gesagte ganz verrucht ausnehmen.«
Die französischen Zeitungen wurden gebracht. Der beendigte Feldzug der Franzosen in Spanien unter dem Herzog von Angoulême hatte für Goethe großes Interesse. »Ich muß die Bourbons wegen dieses Schrittes durchaus loben,« sagte er, »denn erst hiedurch gewinnen sie ihren Thron, indem sie die Armee gewinnen. Und das ist erreicht. Der Soldat kehret mit Treue für seinen König zurück, denn er hat aus seinen eigenen Siegen sowie aus den Niederlagen der vielköpfig befehligten Spanier die Überzeugung gewonnen, was für ein Unterschied es sei, einem einzelnen gehorchen oder vielen. Die Armee hat den alten Ruhm behauptet und an den Tag gelegt, daß sie fortwährend in sich selber brav sei und daß sie auch ohne Napoleon zu siegen vermöge.«
Goethe wendete darauf seine Gedanken in der Geschichte rückwärts und sprach sehr viel über die preußische Armee im Siebenjährigen Kriege, die durch Friedrich den Großen an ein beständiges Siegen gewöhnt und dadurch verwöhnt worden, so daß sie in späterer Zeit aus zu großem Selbstvertrauen so viele Schlachten verloren. Alle einzelnen Details waren ihm gegenwärtig, und ich hatte sein glückliches Gedächtnis zu bewundern.
»Ich habe den großen Vorteil,« fuhr er fort, »daß ich zu einer Zeit geboren wurde, wo die größten Weltbegebenheiten an die Tagesordnung kamen und sich durch mein langes Leben fortsetzten, so daß ich vom Siebenjährigen Krieg, sodann von der Trennung Amerikas von England, ferner von der Französischen Revolution, und endlich von der ganzen Napoleonischen Zeit bis zum Untergange des Helden und den folgenden Ereignissen lebendiger Zeuge war. Hiedurch bin ich zu ganz anderen Resultaten und Einsichten gekommen, als allen denen möglich sein wird, die jetzt geboren werden und die sich jene großen Begebenheiten durch Bücher aneignen müssen, die sie nicht verstehen.
Was uns die nächsten Jahre bringen werden, ist durchaus nicht vorherzusagen; doch ich fürchte, wir kommen so bald nicht zur Ruhe. Es ist der Welt nicht gegeben, sich zu bescheiden: den Großen nicht, daß kein Mißbrauch der Gewalt stattfinde, und der Masse nicht, daß sie in Erwartung allmählicher Verbesserungen mit einem mäßigen Zustande sich begnüge. Könnte man die Menschheit vollkommen machen, so wäre auch ein vollkommener Zustand denkbar; so aber wird es ewig herüber- und hinüberschwanken, der eine Teil wird leiden, während der andere sich wohl befindet, Egoismus und Neid werden als böse Dämonen immer ihr Spiel treiben, und der Kampf der Parteien wird kein Ende haben.
Das Vernünftigste ist immer, daß jeder sein Metier treibe, wozu er geboren ist und was er gelernt hat, und daß er den andern nicht hindere, das seinige zu tun. Der Schuster bleibe bei seinem Leisten, der Bauer hinter dem Pflug, und der Fürst wisse zu regieren. Denn dies ist auch ein Metier, das gelernt sein will, und das sich niemand anmaßen soll, der es nicht versteht.«
Goethe kam darauf wieder auf die französischen Zeitungen. »Die Liberalen«, sagte er, »mögen reden, denn wenn sie vernünftig sind, hört man ihnen gerne zu; allein den Royalisten, in deren Händen die ausübende Gewalt ist, steht das Reden schlecht, sie müssen handeln. Mögen sie Truppen marschieren lassen und köpfen und hängen, das ist recht; allein in öffentlichen Blättern Meinungen bekämpfen und ihre Maßregeln rechtfertigen, das will ihnen nicht kleiden. Gäbe es ein Publikum von Königen, da möchten sie reden.
In dem, was ich selber zu tun und zu treiben hatte,« fuhr Goethe fort, »habe ich mich immer als Royalist behauptet. Die anderen habe ich schwatzen lassen, und ich habe getan, was ich für gut fand. Ich übersah meine Sache und wußte, wohin ich wollte. Hatte ich als einzelner einen Fehler begangen, so konnte ich ihn wieder gutmachen hätte ich ihn aber zu dreien und mehreren begangen, so wäre ein Gutmachen unmöglich gewesen, denn unter vielen ist zu vielerlei Meinung.«
Darauf bei Tisch war Goethe von der heitersten Laune. Er zeigte mir das Stammbuch der Frau von Spiegel, worin er sehr schöne Verse geschrieben. Es war ein Platz für ihn zwei Jahre lang offen gelassen, und er war nun froh, daß es ihm gelungen, ein altes Versprechen endlich zu erfüllen. Nachdem ich das Gedicht an Frau von Spiegel gelesen, blätterte ich in dem Buche weiter, wobei ich auf manchen bedeutenden Namen stieß. Gleich auf der nächsten Seite stand ein Gedicht von Tiedge, ganz in der Gesinnung und dem Tone seiner ›Urania‹ geschrieben. »In einer Anwandlung von Verwegenheit«, sagte Goethe, »war ich im Begriff einige Verse darunter zu setzen; es freut mich aber, daß ich es unterlassen, denn es ist nicht das erste Mal, daß ich durch rückhaltlose Äußerungen gute Menschen zurückgestoßen und die Wirkung meiner besten Sachen verdorben habe.
Indessen«, fuhr Goethe fort, »habe ich von Tiedges ›Urania‹ nicht wenig auszustehen gehabt; denn es gab eine Zeit, wo nichts gesungen und nichts deklamiert wurde als die ›Urania‹ Wo man hinkam, fand man die ›Urania‹ auf allen Tischen; die ›Urania‹ und die Unsterblichkeit war der Gegenstand jeder Unterhaltung. Ich möchte keineswegs das Glück entbehren, an eine künftige Fortdauer zu glauben; ja ich möchte mit Lorenzo von Medici sagen, daß alle diejenigen auch für dieses Leben tot sind, die kein anderes hoffen; allein solch unbegreifliche Dinge liegen zu fern, um ein Gegenstand täglicher Betrachtung und gedankenzerstörender Spekulation zu sein. Und ferner: wer eine Fortdauer glaubt, der sei glücklich im stillen, aber er hat nicht Ursache, sich darauf etwas einzubilden. Bei Gelegenheit von Tiedges ›Urania‹ indes machte ich die Bemerkung, daß, eben wie der Adel, so auch die Frommen eine gewisse Aristokratie bilden. Ich fand dumme Weiber, die stolz waren, weil sie mit Tiedge an Unsterblichkeit glaubten, und ich mußte es leiden, daß manche mich über diesen Punkt auf eine sehr dünkelhafte Weise examinierten. Ich ärgerte sie aber, indem ich sagte: es könne mir ganz recht sein, wenn nach Ablauf dieses Lebens uns ein abermaliges beglücke; allein ich wolle mir ausbitten, daß mir drüben niemand von denen begegne, die hier daran geglaubt hätten. Denn sonst würde meine Plage erst recht angehen! Die Frommen würden um mich herumkommen und sagen: Haben wir nicht recht gehabt? Haben wir es nicht vorhergesagt? Ist es nicht eingetroffen? Und damit würde denn auch drüben der Langenweile kein Ende sein.
Die Beschäftigung mit Unsterblichkeitsideen«, fuhr Goethe fort, »ist für vornehme Stände und besonders für Frauenzimmer, die nichts zu tun haben. Ein tüchtiger Mensch aber, der schon hier etwas Ordentliches zu sein gedenkt und der daher täglich zu streben, zu kämpfen und zu wirken hat, läßt die künftige Welt auf sich beruhen und ist tätig und nützlich in dieser. Ferner sind Unsterblichkeitsgedanken für solche, die in Hinsicht auf Glück hier nicht zum besten weggekommen sind, und ich wollte wetten, wenn der gute Tiedge ein besseres Geschick hätte, so hätte er auch bessere Gedanken.«
Donnerstag, den 26. [?] Februar 1824
Mit Goethe zu Tisch. Nachdem gegessen und abgeräumt war, ließ er durch Stadelmann große Portefeuilles mit Kupferstichen herbeischleppen. Auf den Mappen hatte sich einiger Staub gesammelt, und da keine passende Tücher zum Abwischen in der Nähe waren, so ward Goethe unwillig und schalt seinen Diener. »Ich erinnere dich zum letzten Mal,« sagte er, »denn gehst du nicht noch heute, die oft verlangten Tücher zu kaufen, so gehe ich morgen selbst, und du sollst sehen, daß ich Wort halte.« Stadelmann ging.
»Ich hatte einmal einen ähnlichen Fall mit dem Schauspieler Becker,« fuhr Goethe gegen mich heiter fort, »der sich weigerte, einen Reiter im ›Wallenstein‹ zu spielen. Ich ließ ihm aber sagen, wenn er die Rolle nicht spielen wolle, so würde ich sie selber spielen. Das wirkte. Denn sie kannten mich beim Theater und wußten, daß ich in solchen Dingen keinen Spaß verstand und daß ich verrückt genug war, mein Wort zu halten und das Tollste zu tun.«
»Und würden Sie im Ernst die Rolle gespielt haben?«fragte ich.
»Ja,« sagte Goethe, »ich hätte sie gespielt und würde den Herrn Becker heruntergespielt haben, denn ich kannte die Rolle besser als er.«
Wir öffneten darauf die Mappen und schritten zur Betrachtung der Kupfer und Zeichnungen. Goethe verfährt hiebei in bezug auf mich sehr sorgfältig, und ich fühle, daß es seine Absicht ist, mich in der Kunstbetrachtung auf eine höhere Stufe der Einsicht zu bringen. Nur das in seiner Art durchaus Vollendete zeigt er mir und macht mir des Künstlers Intention und Verdienst deutlich, damit ich erreichen möge, die Gedanken der Besten nachzudenken und den Besten gleich zu empfinden. »Dadurch«, sagte er heute, »bildet sich das, was wir Geschmack nennen. Denn den Geschmack kann man nicht am Mittelgut bilden, sondern nur am Allervorzüglichsten. Ich zeige Ihnen daher nur das Beste; und wenn Sie sich darin befestigen, so haben Sie einen Maßstab für das übrige, das Sie nicht überschätzen, aber doch schätzen werden. Und ich zeige Ihnen das Beste in jeder Gattung, damit Sie sehen, daß keine Gattung gering zu achten, sondern daß jede erfreulich ist, sobald ein großes Talent darin den Gipfel erreichte. Dieses Bild eines französischen Künstlers z. B. ist galant wie kein anderes und daher ein Musterstück seiner Art.«
Goethe reichte mir das Blatt, und ich sah es mit Freuden. In einem reizenden Zimmer eines Sommerpalais, wo man durch offene Fenster und Türen die Aussicht in den Garten hat, sieht man eine Gruppe der anmutigsten Personen. Eine sitzende schöne Frau von etwa dreißig, Jahren hält ein Notenbuch, woraus sie soeben gesungen zu haben scheint. Etwas tiefer, an ihrer Seite sitzend, lehnt sich ein junges Mädchen von etwa fünfzehn. Rückwärts am offenen Fenster steht eine andere junge Dame, sie hält eine Laute und scheint noch Töne zu greifen. In diesem Augenblick ist ein junger Herr hereingetreten, auf den die Blicke der Frauen sich richten; er scheint die musikalische Unterhaltung unterbrochen zu haben, und indem er mit einer leichten Verbeugung vor ihnen steht, macht er den Eindruck, als sagte er entschuldigende Worte, die vor den Frauen mit Wohlgefallen gehört werden.
»Das, dächte ich,« sagte Goethe, »wäre so galant wie irgendein Stück von Calderon, und Sie haben nun in dieser Art das Vorzüglichste gesehen. Was aber sagen Sie hiezu?«
Mit diesen Worten reichte er mir einige radierte Blätter des berühmten Tiermalers Roos, lauter Schafe, und diese Tiere in allen ihren Lagen und Zuständen. Das Einfältige der Physiognomien, das Häßliche, Struppige der Haare, alles mit der äußersten Wahrheit, als wäre es die Natur selber.
»Mir wird immer bange,« sagte Goethe, »wenn ich diese Tiere ansehe. Das Beschränkte, Dumpfe, Träumende, Gähnende ihres Zustandes zieht mich in das Mitgefühl desselben hinein man fürchtet, zum Tier zu werden, und möchte fast glauben, der Künstler sei selber eins gewesen. Auf jeden Fall bleibt es im hohen Grade erstaunenswürdig, wie er sich in die Seelen dieser Geschöpfe hat hineindenken und hineinempfinden können, um den innern Charakter in der äußern Hülle mit solcher Wahrheit durchblicken zu lassen. Man sieht aber, was ein großes Talent machen kann, wenn es bei Gegenständen bleibt, die seiner Natur analog sind.«
»Hat denn dieser Künstler«, sagte ich, »nicht auch Hunde, Katzen und Raubtiere mit einer ähnlichen Wahrheit gebildet? Ja, hat er, bei der großen Gabe, sich in einen fremden Zustand hineinzufühlen, nicht auch menschliche Charaktere mit einer gleichen Treue behandelt?«
»Nein,« sagte Goethe, »alles das lag außer seinem Kreise; dagegen die frommen, grasfressenden Tiere, wie Schafe, Ziegen, Kühe und dergleichen, ward er nicht müde ewig zu wiederholen; dies war seines Talentes eigentliche Region, aus der er auch zeitlebens nicht herausging. Und daran tat er wohl! Das Mitgefühl der Zustände dieser Tiere war ihm angeboren, die Kenntnis ihres Psychologischen war ihm gegeben, und so hatte er denn auch für deren Körperliches ein so glückliches Auge. Andere Geschöpfe dagegen waren ihm vielleicht nicht so durchsichtig, und es fehlte ihm daher zu ihrer Darstellung sowohl Beruf als Trieb.«
Durch diese Äußerung Goethes ward manches Analoge in mir aufgeregt, das mir wieder lebhaft vor die Seele trat. So hatte er mir vor einiger Zeit gesagt, daß dem echten Dichter die Kenntnis der Welt angeboren sei und daß er zu ihrer Darstellung keineswegs vieler Erfahrung und einer großen Empirie bedürfe. »Ich schrieb meinen ›Götz von Berlichingen‹«, sagte er, »als junger Mensch von zweiundzwanzig und erstaunte zehn Jahre später über die Wahrheit meiner Darstellung. Erlebt und gesehen hatte ich bekanntlich dergleichen nicht, und ich mußte also die Kenntnis mannigfaltiger menschlicher Zustände durch Antizipation besitzen.
Überhaupt hatte ich nur Freude an der Darstellung meiner innern Welt, ehe ich die äußere kannte. Als ich nachher in der Wirklichkeit fand, daß die Welt so war, wie ich sie mir gedacht hatte, war sie mir verdrießlich, und ich hatte keine Lust mehr sie darzustellen. Ja, ich möchte sagen: hätte ich mit Darstellung der Welt so lange gewartet, bis ich sie kannte, so wäre meine Darstellung Persiflage geworden.«
»Es liegt in den Charakteren«, sagte er ein andermal, »eine gewisse Notwendigkeit, eine gewisse Konsequenz, vermöge welcher bei diesem oder jenem Grundzuge eines Charakters gewisse sekundäre Züge stattfinden. Dieses lehrt die Empirie genugsam, es kann aber auch einzelnen Individuen die Kenntnis davon angeboren sein. Ob bei mir Angeborenes und Erfahrung sich vereinige, will ich nicht untersuchen –, aber so viel weiß ich: wenn ich jemanden eine Viertelstunde gesprochen habe, so will ich ihn zwei Stunden reden lassen.«
So hatte Goethe von Lord Byron gesagt, daß ihm die Welt durchsichtig sei und daß ihm ihre Darstellung durch Antizipation möglich. Ich äußerte darauf einige Zweifel, ob es Byron z. B. gelingen möchte, eine untergeordnete tierische Natur darzustellen, indem seine Individualität mir zu gewaltsam erscheine, um sich solchen Gegenständen mit Liebe hinzugeben. Goethe gab dieses zu und erwiderte, daß die Antizipation sich überall nur so weit erstrecke, als die Gegenstände dem Talent analog seien, und wir wurden einig, daß in dem Verhältnis, wie die Antizipation beschränkt oder umfassend sei, das darstellende Talent selbst von größerem oder geringerem Umfange befunden werde.
»Wenn Eure Exzellenz behaupten,« sagte ich darauf, »daß dem Dichter die Welt angeboren sei, so haben Sie wohl nur die Welt des Innern dabei im Sinne, aber nicht die empirische Welt der Erscheinung und Konvenienz; und wenn also dem Dichter eine wahre Darstellung derselben gelingen soll, so muß doch wohl die Erforschung des Wirklichen hinzukommen?«
»Allerdings,« erwiderte Goethe, »es ist so. Die Region der Liebe, des Hasses, der Hoffnung, der Verzweiflung, und wie die Zustände und Leidenschaften der Seele heißen, ist dem Dichter angeboren, und ihre Darstellung gelingt ihm. Es ist aber nicht angeboren, wie man Gericht hält, oder wie man im Parlament oder bei einer Kaiserkrönung verfährt; und um nicht gegen die Wahrheit solcher Dinge zu verstoßen, muß der Dichter sie aus Erfahrung oder Überlieferung sich aneignen. So konnte ich im ›Faust‹ den düstern Zustand des Lebensüberdrusses im Helden, sowie die Liebesempfindungen Gretchens recht gut durch Antizipation in meiner Macht haben; allein um z. B. zu sagen:
| Wie traurig steigt die unvollkommne ScheibeDes späten Monds mit feuchter Glut heran – |
bedurfte es einiger Beobachtung der Natur.« »Es ist aber«, sagte ich, »im ganzen ›Faust‹ keine Zeile, die nicht von sorgfältiger Durchforschung der Welt und des Lebens unverkennbare Spuren trüge, und man wird keineswegs erinnert, als sei Ihnen das alles, ohne die reichste Erfahrung, nur so geschenkt worden.«
»Mag sein,« antwortete Goethe; »allein hätte ich nicht die Welt durch Antizipation bereits in mir getragen, ich wäre mit sehenden Augen blind geblieben, und alle Erforschung und Erfahrung wäre nichts gewesen als ein ganz totes vergebliches Bemühen. Das Licht ist da, und die Farben umgeben uns; allein trügen wir kein Licht und keine Farben im eigenen Auge, so würden wir auch außer uns dergleichen nicht wahrnehmen.«
Sonnabend, den 28. [Mittwoch, den 25.] Februar 1824
»Es gibt vortreffliche Menschen,« sagte Goethe, »die nichts aus dem Stegreife, nichts obenhin zu tun vermögen, sondern deren Natur es verlangt, ihre jedesmaligen Gegenstände mit Ruhe tief zu durchdringen. Solche Talente machen uns oft ungeduldig, indem man selten von ihnen erlangt, was man augenblicklich wünscht; allein auf diesem Wege wird das Höchste geleistet.«
Ich brachte das Gespräch auf Ramberg. »Das ist freilich ein Künstler ganz anderer Art,« sagte Goethe, »ein höchst erfreuliches Talent, und zwar ein improvisierendes, das nicht seinesgleichen hat. Er verlangte einst in Dresden von mir eine Aufgabe. Ich gab ihm den Agamemnon, wie er, von Troja in seine Heimat zurückkehrend, vom Wagen steigt, und wie es ihm unheimlich wird, die Schwelle seines Hauses zu betreten. Sie werden zugeben, daß dies ein Gegenstand der allerschwierigsten Sorte ist, der bei einem anderen Künstler die reiflichste Überlegung würde erfordert haben.
Ich hatte aber kaum das Wort ausgesprochen, als Ramberg schon an zu zeichnen fing, und zwar mußte ich bewundern, wie er den Gegenstand sogleich richtig auffaßte. Ich kann nicht leugnen, ich möchte einige Blätter von Rambergs Hand besitzen.«
Wir sprachen sodann über andere Künstler, die in ihren Werken leichtsinnig verfahren und zuletzt in Manier zugrunde gehen.
»Die Manier«, sagte Goethe, »will immer fertig sein und hat keinen Genuß an der Arbeit. Das echte, wahrhaft große Talent aber findet sein höchstes Glück in der Ausführung. Roos ist unermüdlich in emsiger Zeichnung der Haare und Wolle seiner Ziegen und Schafe, und man sieht an dem unendlichen Detail, daß er während der Arbeit die reinste Seligkeit genoß und nicht daran dachte fertig zu werden.
Geringeren Talenten genügt nicht die Kunst als solche; sie haben während der Ausführung immer nur den Gewinn vor Augen, den sie durch ein fertiges Werk zu erreichen hoffen. Bei so weltlichen Zwecken und Richtungen aber kann nichts Großes zustande kommen.«
Sonntag, den 29. Februar 1824
Ich ging um zwölf Uhr zu Goethe, der mich vor Tisch zu einer Spazierfahrt hatte einladen lassen. Ich fand ihn frühstückend, als ich zu ihm hereintrat, und setzte mich ihm gegenüber, indem ich das Gespräch auf die Arbeiten brachte, die uns gemeinschaftlich in bezug auf die neue Ausgabe seiner Werke beschäftigten. Ich redete ihm zu, sowohl seine ›Götter, Helden und Wieland‹ als auch seine ›Briefe des Pastors‹ in diese neue Edition mit aufzunehmen.
»Ich habe«, sagte Goethe, »auf meinem jetzigen Standpunkt über jene jugendlichen Produktionen eigentlich kein Urteil. Da mögt ihr Jüngeren entscheiden. Ich will indes jene Anfänge nicht schelten; ich war freilich noch dunkel und strebte in bewußtlosem Drange vor mir hin, aber ich hatte ein Gefühl des Rechten, eine Wünschelrute, die mir anzeigte, wo Gold war.«
Ich machte bemerklich, daß dieses bei jedem großen Talent der Fall sein müsse, indem es sonst bei seinem Erwachen in der gemischten Welt nicht das Rechte ergreifen und das Verkehrte vermeiden würde.
Es war indes angespannt, und wir fuhren den Weg nach Jena hinaus. Wir sprachen verschiedene Dinge, Goethe erwähnte die neuen französischen Zeitungen.
»Die Konstitution in Frankreich,« sagte er, »bei einem Volke, das so viele verdorbene Elemente in sich hat, ruht auf ganz anderem Fundament als die in England. Es ist in Frankreich alles durch Bestechungen zu erreichen, ja die ganze Französische Revolution ist durch Bestechungen geleitet worden.«
Darauf erzählte mir Goethe die Nachricht von dem Tode Eugen Napoleons, Herzog von Leuchtenberg, die diesen Morgen eingegangen, welcher Fall ihn tief zu betrüben schien. »Er war einer von den großen Charakteren,« sagte Goethe, »die immer seltener werden, und die Welt ist abermals um einen bedeutenden Menschen ärmer. Ich kannte ihn persönlich; noch vorigen Sommer war ich mit ihm in Marienbad zusammen. Er war ein schöner Mann von etwa zweiundvierzig Jahren, aber er schien älter zu sein, und das war kein Wunder, wenn man bedenkt, was er ausgestanden und wie in seinem Leben sich ein Feldzug und eine große Tat auf die andere drängte. Er teilte mir in Marienbad einen Plan mit, über dessen Ausführung er viel mit mir verhandelte. Er ging nämlich damit um, den Rhein mit der Donau durch einen Kanal zu vereinigen. Ein riesenhaftes Unternehmen, wenn man die widerstrebende Lokalität bedenkt. Aber jemandem, der unter Napoleon gedient und mit ihm die Welt erschüttert hat, erscheint nichts unmöglich. Karl der Große hatte schon denselbigen Plan und ließ auch mit der Arbeit anfangen; allein das Unternehmen geriet bald in Stocken: der Sand wollte nicht Stich halten, die Erdmassen fielen von beiden Seiten immer wieder zusammen.«
Montag, den 22. März 1824
Mit Goethe vor Tisch nach seinem Garten gefahren.
Die Lage dieses Gartens, jenseits der Ilm, in der Nähe des Parks, an dem westlichen Abhange eines Hügelzuges, hat etwas sehr Trauliches. Vor Nord- und Ostwinden geschützt, ist er den erwärmenden und belebenden Einwirkungen des südlichen und westlichen Himmels offen, welches ihn besonders im Herbst und Frühling zu einem höchst angenehmen Aufenthalte macht.
Der in nordwestlicher Richtung liegenden Stadt ist man so nahe, daß man in wenigen Minuten dort sein kann, und doch, wenn man umherblickt, sieht man nirgend ein Gebäude oder eine Turmspitze ragen, die an eine solche städtische Nähe erinnern könnte; die hohen dichten Bäume des Parks verhüllen alle Aussicht nach jener Seite. Sie ziehen sich links, nach Norden zu, unter dem Namen des Sternes, ganz nahe an den Fahrweg heran, der unmittelbar vor dem Garten vorüberführt.
Gegen Westen und Südwesten blickt man frei über eine geräumige Wiese hin, durch welche in der Entfernung eines guten Pfeilschusses die Ilm in stillen Windungen vorbeigeht. Jenseits des Flusses erhebt sich das Ufer gleichfalls hügelartig, an dessen Abhängen und auf dessen Höhen, in den mannigfaltigen Laubschattierungen hoher Erlen, Eschen, Pappelweiden und Birken, der sich breit hinziehende Park grünet, indem er den Horizont gegen Mittag und Abend in erfreulicher Entfernung begrenzet.
Diese Ansicht des Parkes über die Wiese hin, besonders im Sommer, gewährt den Eindruck, als sei man in der Nähe eines Waldes, der sich stundenweit ausdehnt. Man denkt, es müsse jeden Augenblick ein Hirsch, ein Reh auf die Wiesenfläche hervorkommen. Man fühlt sich in den Frieden tiefer Natureinsamkeit versetzt, denn die große Stille ist oft durch nichts unterbrochen als durch die einsamen Töne der Amsel oder durch den pausenweise abwechselnden Gesang einer Walddrossel.
Aus solchen Träumen gänzlicher Abgeschiedenheit erwecket uns jedoch das gelegentliche Schlagen der Turmuhr, das Geschrei der Pfauen von der Höhe des Parks herüber, oder das Trommeln und Hörnerblasen des Militärs der Kaserne. Und zwar nicht unangenehm; denn es erwacht mit solchen Tönen das behagliche Nähegefühl der heimatlichen Stadt, von der man sich meilenweit versetzt glaubte.
Zu gewissen Tages- und Jahreszeiten sind diese Wiesenflächen nichts weniger als einsam. Bald sieht man Landleute, die nach Weimar zu Markt oder in Arbeit gehen und von dort zurückkommen, bald Spaziergänger aller Art längs den Krümmungen der Ilm, besonders in der Richtung nach Oberweimar, das zu gewissen Tagen ein sehr besuchten Ort ist. Sodann die Zeit der Heuernte belebt diese Räume auf das heiterste. Hinterdrein sieht man weidende Schafherden, auch wohl die stattlichen Schweizerkühe der nahen Ökonomie.
Heute jedoch war von allen diesen die Sinne erquickenden Sommererscheinungen noch keine Spur. Auf den Wiesen waren kaum einige grünende Stellen sichtbar, die Bäume des Parks standen noch in braunen Zweigen und Knospen; doch verkündigte der Schlag der Finken sowie der hin und wieder vernehmbare Gesang der Amsel und Drossel das Herannahen des Frühlings.
Die Luft war sommerartig, angenehm; es wehte ein sehr linder Südwestwind. Einzelne kleine Gewitterwolken zogen am heitern Himmel herüber; sehr hoch bemerkte man sich auflösende Cirrusstreifen. Wir betrachteten die Wolken genau und sahen, daß sich die ziehenden geballten der untern Region gleichfalls auflösten, woraus Goethe schloß, daß das Barometer im Steigen begriffen sein müsse.
Goethe sprach darauf sehr viel über das Steigen und Fallen des Barometers welches er die Wasserbejahung und Wasserverneinung nannte. Er sprach über das Ein- und Ausatmen der Erde nach ewigen Gesetzen, über eine mögliche Sündflut bei fortwährender Wasserbejahung. Ferner: daß jeder Ort seine eigene Atmosphäre habe, daß jedoch in den Barometerständen von Europa eine große Gleichheit stattfinde. Die Natur sei inkommensurabel, und bei den großen Irregularitäten sei es sehr schwer, das Gesetzliche zu finden.
Während er mich so über höhere Dinge belehrte, gingen wir in dem breiten Sandwege des Gartens auf und ab. Wir traten in die Nähe des Hauses, das er seinem Diener aufzuschließen befahl, um mir später das Innere zu zeigen. Die weißabgetünchten Außenseiten sah ich ganz mit Rosenstöcken umgeben, die, von Spalieren gehalten, sich bis zum Dache hinaufgerankt hatten. Ich ging um das Haus herum und bemerkte zu meinem besonderen Interesse an den Wänden in den Zweigen des Rosengebüsches eine große Zahl mannigfaltiger Vogelnester, die sich von vorigem Sommer her erhalten hatten und jetzt bei mangelndem Laube den Blicken freistanden, besonders Nester der Hänflinge und verschiedener Art Grasemücken, wie sie höher oder niedriger zu bauen Neigung haben.
Goethe führte mich darauf in das Innere des Hauses, das ich vorigen Sommer zu sehen versäumt hatte. Unten fand ich nur ein wohnbares Zimmer, an dessen Wänden einige Karten und Kupferstiche hingen, desgleichen ein farbiges Porträt Goethes in Lebensgröße, und zwar von Meyer gemalt bald nach der Zurückkunft beider Freunde aus Italien. Goethe erscheint hier im kräftigen mittleren Mannesalter, sehr braun und etwas stark. Der Ausdruck des wenig belebten Gesichtes ist sehr ernst; man glaubt einen Mann zu sehen, dem die Last künftiger Taten auf der Seele liegt.
Wir gingen die Treppe hinauf in die oberen Zimmer; ich fand deren drei und ein Kabinettchen, aber alle sehr klein und ohne eigentliche Bequemlichkeit. Goethe sagte, daß er in früheren Jahren hier eine ganze Zeit mit Freuden gewohnt und sehr ruhig gearbeitet habe.
Die Temperatur dieser Zimmer war etwas kühl, und wir trachteten wieder nach der milden Wärme im Freien. In dem Hauptwege in der Mittagssonne auf und ab gehend, kam das Gespräch auf die neueste Literatur, auf Schelling, und unter andern auch auf einige neue Schauspiele von Platen.
Bald jedoch kehrte unsere Aufmerksamkeit auf die uns umgebende nächste Natur zurück. Die Kaiserkronen und Lilien sproßten schon mächtig, auch kamen die Malven zu beiden Seiten des Weges schon grünend hervor.
Der obere Teil des Gartens, am Abhange des Hügels, liegt als Wiese mit einzelnen zerstreut stehenden Obstbäumen. Wege schlängeln sich hinauf, längs der Höhe hin und wieder herunter, welches einige Neigung in mir erregte, mich oben umzusehen. Goethe schritt, diese Wege hinansteigend, mir rasch voran, und ich freute mich über seine Rüstigkeit.
Oben an der Hecke fanden wir eine Pfauhenne, die vom fürstlichen Park herübergekommen zu sein schien; wobei Goethe mir sagte, daß er in Sommertagen die Pfauen durch ein beliebtes Futter herüberzulocken und herzugewöhnen pflege.
An der anderen Seite den sich schlängelnden Weg herabkommend, fand ich von Gebüsch umgeben einen Stein mit den eingehauenen Versen des bekannten Gedichtes:
Hier im Stillen gedachte der Liebende seiner Geliebten –
und ich hatte das Gefühl, daß ich mich an einer klassischen Stelle befinde.
Ganz nahe dabei kamen wir auf eine Baumgruppe halbwüchsiger Eichen, Tannen, Birken und Buchen. Unter den Tannen fand ich ein herabgeworfenes Gewölle eines Raubvogels; ich zeigte es Goethen, der mir erwiderte, daß er dergleichen an dieser Stelle häufig gefunden, woraus ich schloß, daß diese Tannen ein beliebter Aufenthalt einiger Eulen sein mögen, die in dieser Gegend häufig gefunden werden.
Wir traten um die Baumgruppe herum und befanden uns wieder an dem Hauptwege in der Nähe des Hauses. Die soeben umschrittenen Eichen, Tannen, Birken und Buchen, wie sie untermischt stehen, bilden hier einen Halbkreis, den innern Raum grottenartig überwölbend, worin wir uns auf kleinen Stühlen setzten, die einen runden Tisch umgaben. Die Sonne war so mächtig, daß der geringe Schatten dieser blätterlosen Bäume bereits als eine Wohltat empfunden ward. »Bei großer Sommerhitze«, sagte Goethe, »weiß ich keine bessere Zuflucht als diese Stelle. Ich habe die Bäume vor vierzig Jahren alle eigenhändig gepflanzt, ich habe die Freude gehabt, sie heranwachsen zu sehen, und genieße nun schon seit geraumer Zeit die Erquickung ihres Schattens. Das Laub dieser Eichen und Buchen ist der mächtigsten Sonne undurchdringlich; ich sitze hier gerne an warmen Sommertagen nach Tische, wo denn auf diesen Wiesen und auf dem ganzen Park umher oft eine Stille herrscht, von der die Alten sagen würden: daß der Pan schlafe.«
Indessen hörten wir es in der Stadt zwei Uhr schlagen und fuhren zurück.
Dienstag, den 30. März 1824
Abends bei Goethe. – Ich war alleine mit ihm. Wir sprachen vielerlei und tranken eine Flasche Wein dazu. Wir sprachen über das französische Theater im Gegensatz zum deutschen.
»Es wird schwer halten,« sagte Goethe, »daß das deutsche Publikum zu einer Art von reinem Urteil komme, wie man es etwa in Italien und Frankreich findet. Und zwar ist uns besonders hinderlich, daß auf unseren Bühnen alles durcheinander gegeben wird. An derselbigen Stelle, wo wir gestern den ›Hamlet‹ sahen, sehen wir heute den ›Staberle‹, und wo uns morgen die ›Zauberflöte‹ entzückt, sollen wir übermorgen an den Späßen des ›Neuen Sonntagskindes‹ Gefallen finden. Dadurch entsteht beim Publikum eine Konfusion im Urteil, eine Vermengung der verschiedenen Gattungen, die es nie gehörig schätzen und begreifen lernt. Und dann hat jeder seine individuellen Forderungen und seine persönlichen Wünsche, mit denen er sich wieder nach der Stelle wendet, wo er sie realisiert fand. An demselbigen Baum, wo er heute Feigen gepflückt, will er sie morgen wieder pflücken, und er würde ein sehr verdrießliches Gesicht machen, wenn etwa über Nacht Schlehen gewachsen wären. Ist aber jemand Freund von Schlehen, der wendet sich an die Dornen.
Schiller hatte den guten Gedanken, ein eigenes Haus für die Tragödie zu bauen, auch jede Woche ein Stück bloß für Männer zu geben. Allein dies setzte eine sehr große Residenz voraus und war in unsern kleinen Verhältnissen nicht zu realisieren.«
Wir sprachen über die Stücke von Iffland und Kotzebue, die Goethe in ihrer Art sehr hoch schätzte. »Eben aus dem gedachten Fehler,« sagte er, »daß niemand die Gattungen gehörig unterscheidet, sind die Stücke jener Männer oft sehr ungerechterweise getadelt worden. Man kann aber lange warten, ehe ein paar so populare Talente wieder kommen.«
Ich lobte Ifflands ›Hagestolzen‹, die mir von der Bühne herunter sehr wohl gefallen hatten. »Es ist ohne Frage Ifflands bestes Stück,« sagte Goethe; »es ist das einzige, wo er aus der Prosa ins Ideelle geht.«
Er erzählte mir darauf von einem Stück, welches er mit Schiller als Fortsetzung der ›Hagestolzen‹ gemacht, aber nicht geschrieben, sondern bloß gesprächsweise gemacht. Goethe entwickelte mir die Handlung Szene für Szene; es war sehr artig und heiter, und ich hatte daran große Freude.
Goethe sprach darauf über einige neue Schauspiele von Platen. »Man sieht«, sagte er, »an diesen Stücken die Einwirkung Calderons. Sie sind durchaus geistreich und in gewisser Hinsicht vollendet, allein es fehlt ihnen ein spezifisches Gewicht, eine gewisse Schwere des Gehalts. Sie sind nicht der Art, um im Gemüt des Lesers ein tiefes und nachwirkendes Interesse zu erregen, vielmehr berühren sie die Saiten unseres Innern nur leicht und vorübereilend. Sie gleichen dem Kork, der auf dem Wasser schwimmend keinen Eindruck macht, sondern von der Oberfläche sehr leicht getragen wird.
Der Deutsche verlangt einen gewissen Ernst, eine gewisse Größe der Gesinnung, eine gewisse Fülle des Innern, weshalb denn auch Schiller von allen so hoch gehalten wird. Ich zweifle nun keinesfalls an Platens sehr tüchtigem Charakter, allein das kommt, wahrscheinlich aus einer abweichenden Kunstansicht, hier nicht zur Erscheinung. Er entwickelt eine reiche Bildung, Geist, treffenden Witz und sehr viele künstlerische Vollendung; allein damit ist es, besonders bei uns Deutschen, nicht getan.
Überhaupt: der persönliche Charakter des Schriftstellers bringt seine Bedeutung beim Publikum hervor, nicht die Künste seines Talents. Napoleon sagte von Corneille: ›S'il vivait, je le ferais Prince‹ – und er las ihn nicht. Den Racine las er, aber von diesem sagte er es nicht. Deshalb steht auch der Lafontaine bei den Franzosen in so hoher Achtung, nicht seines poetischen Verdienstes wegen, sondern wegen der Großheit seines Charakters, der aus seinen Schriften hervorgeht.«
Wir kamen sodann auf die ›Wahlverwandtschaften‹ zu reden, und Goethe erzählte mir von einem durchreisenden Engländer, der sich scheiden lassen wolle, wenn er nach England zurückkäme. Er lachte über solche Torheit und erwähnte mehrere Beispiele von Geschiedenen, die nachher doch nicht hätten voneinander lassen können.
»Der selige Reinhard in Dresden«, sagte er, »wunderte sich oft über mich, daß ich in bezug auf die Ehe so strenge Grundsätze habe, während ich doch in allen übrigen Dingen so läßlich denke.«
Diese Äußerung Goethes war mir aus dem Grunde merkwürdig, weil sie ganz entschieden an den Tag legt, wie er es mit jenem so oft gemißdeuteten Romane eigentlich gemeint hat.
Wir sprachen darauf über Tieck und dessen persönliche Stellung zu Goethe.
»Ich bin Tiecken herzlich gut,« sagte Goethe, »und er ist auch im ganzen sehr gut gegen mich gesinnt; allein es ist in seinem Verhältnis zu mir doch etwas, wie es nicht sein sollte. Und zwar bin ich daran nicht schuld, und er ist es auch nicht, sondern es hat seine Ursachen anderer Art.
Als nämlich die Schlegel anfingen bedeutend zu werden, war ich ihnen zu mächtig, und um mich zu balancieren, mußten sie sich nach einem Talent umsehen, das sie mir entgegenstellten. Ein solches fanden sie in Tieck, und damit er mir gegenüber in den Augen des Publikums genugsam bedeutend erscheine, so mußten sie mehr aus ihm machen, als er war. Dieses schadete unserm Verhältnis; denn Tieck kam dadurch zu mir, ohne es sich eigentlich bewußt zu werden, in eine schiefe Stellung.
Tieck ist ein Talent von hoher Bedeutung, und es kann seine außerordentlichen Verdienste niemand besser erkennen als ich selber; allein wenn man ihn über ihn selbst erheben und mir gleichstellen will, so ist man im Irrtum. Ich kann dieses geradeheraus sagen, denn was geht es mich an, ich habe mich nicht gemacht. Es wäre ebenso, wenn ich mich mit Shakespeare vergleichen wollte, der sich auch nicht gemacht hat und der doch ein Wesen höherer Art ist, zu dem ich hinaufblicke und das ich zu verehren habe.«
Goethe war diesen Abend besonders kräftig, heiter und aufgelegt. Er holte ein Manuskript ungedruckter Gedichte herbei, woraus er mir vorlas. Es war ein Genuß ganz einziger Art, ihm zuzuhören, denn nicht allein daß die originelle Kraft und Frische der Gedichte mich in hohem Grade anregte, sondern Goethe zeigte sich auch beim Vorlesen von einer mir bisher unbekannten höchst bedeutenden Seite. Welche Mannigfaltigkeit und Kraft der Stimme! Welcher Ausdruck und welches Leben des großen Gesichtes voller Falten! Und welche Augen!
Mittwoch, den 14. April 1824
Um ein Uhr mit Goethe spazieren gefahren. Wir sprachen über den Stil verschiedener Schriftsteller.
»Den Deutschen«, sagte Goethe, »ist im ganzen die philosophische Spekulation hinderlich, die in ihren Stil oft ein unsinnliches, unfaßliches, breites und aufdröselndes Wesen hineinbringt. Je näher sie sich gewissen philosophischen Schulen hingeben, desto schlechter schreiben sie. Diejenigen Deutschen aber, die als Geschäfts- und Lebemenschen bloß aufs Praktische gehen, schreiben am besten. So ist Schillers Stil am prächtigsten und wirksamsten, sobald er nicht philosophiert, wie ich noch heute an seinen höchst bedeutenden Briefen gesehen, mit denen ich mich grade beschäftige.
Gleicherweise gibt es unter deutschen Frauenzimmern geniale Wesen, die einen ganz vortrefflichen Stil schreiben, so daß sie sogar manche unserer gepriesenen Schriftsteller darin übertreffen.
Die Engländer schreiben in der Regel alle gut, als geborene Redner und als praktische, auf das Reale gerichtete Menschen.
Die Franzosen verleugnen ihren allgemeinen Charakter auch in ihrem Stil nicht. Sie sind geselliger Natur und vergessen als solche nie das Publikum, zu dem sie reden; sie bemühen sich klar zu sein, um ihren Leser zu überzeugen, und anmutig, um ihm zu gefallen.
Im ganzen ist der Stil eines Schriftstellers ein treuer Abdruck seines Innern; will jemand einen klaren Stil schreiben, so sei es ihm zuvor klar in seiner Seele; und will jemand einen großartigen Stil schreiben, so habe er einen großartigen Charakter.«
Goethe sprach darauf über seine Gegner und daß dieses Geschlecht nie aussterbe. »Ihre Zahl ist Legion,« sagte er, »doch ist es nicht unmöglich, sie einigermaßen zu klassifizieren.
Zuerst nenne ich meine Gegner aus Dummheit; es sind solche, die mich nicht verstanden und die mich tadelten, ohne mich zu kennen. Diese ansehnliche Masse hat mir in meinem Leben viele Langeweile gemacht; doch es soll ihnen verziehen sein, denn sie wußten nicht, was sie taten.
Eine zweite große Menge bilden sodann meine Neider. Diese Leute gönnen mir das Glück und die ehrenvolle Stellung nicht, die ich durch mein Talent mir erworben. Sie zerren an meinem Ruhm und hätten mich gerne vernichtet. Wäre ich unglücklich und elend, so würden sie aufhören.
Ferner kommt eine große Anzahl derer, die aus Mangel an eigenem Sukzeß meine Gegner geworden. Es sind begabte Talente darunter, allein sie können mir nicht verzeihen, daß ich sie verdunkele.
Viertens nenne ich meine Gegner aus Gründen. Denn da ich ein Mensch bin und als solcher menschliche Fehler und Schwächen habe, so können auch meine Schriften davon nicht frei sein. Da es mir aber mit meiner Bildung ernst war und ich an meiner Veredelung unablässig arbeitete, so war ich im beständigen Fortstreben begriffen, und es ereignete sich oft, daß sie mich wegen eines Fehlers tadelten, den ich längst abgelegt hatte. Diese Guten haben mich am wenigsten verletzt; sie schossen nach mir, wenn ich schon meilenweit von ihnen entfernt war. Überhaupt war ein abgemachtes Werk mir ziemlich gleichgültig; ich befaßte mich nicht weiter damit und dachte sogleich an etwas Neues.
Eine fernere große Masse zeigt sich als meine Gegner aus abweichender Denkungsweise und verschiedenen Ansichten. Man sagt von den Blättern eines Baumes, daß deren kaum zwei vollkommen gleich befunden werden, und so möchten sich auch unter tausend Menschen kaum zwei finden, die in ihrer Gesinnungs- und Denkungsweise vollkommen harmonieren. Setze ich dieses voraus, so sollte ich mich billig weniger darüber wundern, daß die Zahl meiner Widersacher so groß ist, als vielmehr darüber, daß ich noch so viele Freunde und Anhänger habe. Meine ganze Zeit wich von mir ab, denn sie war ganz in subjektiver Richtung begriffen, während ich in meinem objektiven Bestreben im Nachteile und völlig allein stand.
Schiller hatte in dieser Hinsicht vor mir große Avantagen. Ein wohlmeinender General gab mir daher einst nicht undeutlich zu verstehen, ich möchte es doch machen wie Schiller. Darauf setzte ich ihm Schillers Verdienste erst recht auseinander, denn ich kannte sie doch besser als er. Ich ging auf meinem Wege ruhig fort, ohne mich um den Sukzeß weiter zu bekümmern, und von allen meinen Gegnern nahm ich so wenig Notiz als möglich.«
Wir fuhren zurück und waren darauf bei Tische sehr heiter. Frau von Goethe erzählte viel von Berlin, woher sie vor kurzem gekommen; sie sprach mit besonderer Wärme von der Herzogin von Cumberland, die ihr viel Freundliches erwiesen. Goethe erinnerte sich dieser Fürstin, die als sehr junge Prinzeß eine Zeitlang bei seiner Mutter gewohnt, mit besonderer Neigung.
Abends hatte ich bei Goethe einen musikalischen Kunstgenuß bedeutender Art, indem ich den ›Messias‹ von Händel teilweise vortragen hörte, wozu einige treffliche Sänger sich unter Eberweins Leitung vereinigt hatten. Auch Gräfin Karoline von Egloffstein, Fräulein von Froriep, sowie Frau von Pogwisch und Frau von Goethe hatten sich den Sängerinnen angeschlossen und wirkten dadurch zur Erfüllung eines lange gehegten Wunsches von Goethe auf das freundlichste mit.
Goethe, in einiger Ferne sitzend, im Zuhören vertieft, verlebte einen glücklichen Abend, voll Bewunderung des großartigen Werkes.
Montag, den 19. April 1824
Der größte Philologe unserer Zeit, Friedrich August Wolf aus Berlin, ist hier, auf seiner Durchreise nach dem südlichen Frankreich begriffen. Goethe gab ihm zu Ehren heute ein Diner, wobei von weimarischen Freunden Generalsuperintendent Röhr, Kanzler von Müller, Oberbaudirektor Coudray, Professor Riemer und Hofrat Rehbein außer mir anwesend waren. Über Tisch ging es äußerst heiter zu: Wolf gab manchen geistreichen Einfall zum besten; Goethe, in der anmutigsten Laune, spielte immer den Gegner. »Ich kann mit Wolf nicht anders auskommen,« sagte Goethe mir später, »als daß ich immer als Mephistopheles gegen ihn agiere. Auch geht er sonst mit seinen inneren Schätzen nicht hervor.«
Die geistreichen Scherze über Tisch waren zu flüchtig und zu sehr die Frucht des Augenblicks, als daß man sich ihrer hätte bemächtigen können. Wolf war in witzigen und schlagenden Antworten und Wendungen sehr groß, doch kam es mir vor, als ob Goethe dennoch eine gewisse Superiorität über ihn behauptet hätte.
Die Stunden bei Tisch entschwunden wie mit Flügeln, und es war sechs Uhr geworden, ehe man es sich versah. Ich ging mit dem jungen Goethe ins Theater, wo man die ›Zauberflöte‹ gab. Später sah ich auch Wolf in der Loge mit dem Großherzog Carl August.
Wolf blieb bis zum 25. in Weimar, wo er in das südliche Frankreich abreiste. Der Zustand seiner Gesundheit war derart, daß Goethe die innigste Besorgnis über ihn nicht verhehlte.
Sonntag, den 2. Mai 1824
Goethe machte mir Vorwürfe, daß ich eine hiesige angesehene Familie nicht besucht. »Sie hätten«, sagte er, »im Laufe des Winters dort manchen genußreichen Abend verleben, auch die Bekanntschaft manches bedeutenden Fremden dort machen können; das ist Ihnen nun, Gott weiß durch welche Grille, alles verloren gegangen.«
»Bei meiner erregbaren Natur«, antwortete ich, »und bei meiner Disposition, vielseitig Interesse zu nehmen und in fremde Zustände einzugehen, hätte mir nichts lästiger und verderblicher sein können als eine zu große Fülle neuer Eindrücke. Ich bin nicht zu Gesellschaften erzogen und nicht darin hergekommen. Meine früheren Lebenszustände waren der Art, daß es mir ist, als hätte ich erst seit der kurzen Zeit zu leben angefangen, die ich in Ihrer Nähe bin. Nun ist mir alles neu. Jeder Theaterabend, jede Unterredung mit Ihnen macht in meinem Innern Epoche. Was an anders kultivierten und anders gewöhnten Personen gleichgültig vorübergeht, ist bei mir im höchsten Grade wirksam; und da die Begier, mich zu belehren, groß ist, so ergreift meine Seele alles mit einer gewissen Energie und saugt daraus so viele Nahrung als möglich. Bei solcher Lage meines Innern hatte ich daher im Laufe des letzten Winters am Theater und dem Verkehr mit Ihnen vollkommen genug, und ich hätte mich nicht neuen Bekanntschaften und anderem Umgange hingeben können, ohne mich im Innersten zu zerstören.«
»Ihr seid ein wunderlicher Christ,« sagte Goethe lachend; »tut, was Ihr wollt, ich will Euch gewähren lassen.«
»Und dann«, fuhr ich fort, »trage ich in die Gesellschaft gewöhnlich meine persönlichen Neigungen und Abneigungen und ein gewisses Bedürfnis zu lieben und geliebt zu werden. Ich suche eine Persönlichkeit, die meiner eigenen Natur gemäß sei; dieser möchte ich mich gerne hingeben und mit den andern nichts zu tun haben.«
»Diese Ihre Naturtendenz«, erwiderte Goethe, »ist freilich nicht geselliger Art; allein was wäre alle Bildung, wenn wir unsere natürlichen Richtungen nicht wollten zu überwinden suchen. Es ist eine große Torheit, zu verlangen, daß die Menschen zu uns harmonieren sollen. Ich habe es nie getan. Ich habe einen Menschen immer nur als ein für sich bestehendes Individuum angesehen, das ich zu erforschen und das ich in seiner Eigentümlichkeit kennen zu lernen trachtete, wovon ich aber durchaus keine weitere Sympathie verlange. Dadurch habe ich es nun dahin gebracht, mit jedem Menschen umgehen zu können, und dadurch allein entsteht die Kenntnis mannigfaltiger Charaktere sowie die nötige Gewandtheit im Leben. Denn gerade bei widerstrebenden Naturen muß man sich zusammennehmen, um mit ihnen durchzukommen, und dadurch werden alle die verschiedenen Seiten in uns angeregt und zur Entwickelung und Ausbildung gebracht, so daß man sich denn bald jedem Vis-à-vis gewachsen fühlt. So sollen Sie es auch machen. Sie haben dazu mehr Anlage, als Sie selber glauben; und das hilft nun einmal nichts, Sie müssen in die große Welt hinein, Sie mögen sich stellen, wie Sie wollen.«
Ich merkte mir diese guten Worte und nahm mir vor, soviel wie möglich danach zu handeln.
Gegen Abend hatte Goethe mich zu einer Spazierfahrt einladen lassen. Unser Weg ging durch Oberweimar über die Hügel, wo man gegen Westen die Ansicht des Parkes hat. Die Bäume blühten, die Birken waren schon belaubt und die Wiesen durchaus ein grüner Teppich, über welche die sinkende Sonne herstreifte. Wir suchten malerische Gruppen und konnten die Augen nicht genug auftun. Es ward bemerkt, daß weißblühende Bäume nicht zu malen, weil sie kein Bild machen, sowie daß grünende Birken nicht im Vordergrunde eines Bildes zu gebrauchen, indem das schwache Laub dem weißen Stamme nicht das Gleichgewicht zu halten vermöge; es bilde keine große Partieen, die man durch mächtige Licht- und Schattenmassen herausheben könne. »Ruysdael«, sagte Goethe, »hat daher nie belaubte Birken in den Vordergrund gestellt, sondern bloße Birken- Stämme, abgebrochene, die kein Laub haben. Ein solcher Stamm paßt vortrefflich in den Vordergrund, denn seine helle Gestalt tritt auf das mächtigste heraus.«
Wir sprachen sodann, nach flüchtiger Berührung anderer Gegenstände, über die falsche Tendenz solcher Künstler, welche die Religion zur Kunst machen wollen, während ihnen die Kunst Religion sein sollte. »Die Religion«, sagte Goethe, »steht in demselbigen Verhältnis zur Kunst wie jedes andere höhere Lebensinteresse auch. Sie ist bloß als Stoff zu betrachten, der mit allen übrigen Lebensstoffen gleiche Rechte hat. Auch sind Glaube und Unglaube durchaus nicht diejenigen Organe, mit welchen ein Kunstwerk aufzufassen ist, vielmehr gehören dazu ganz andere menschliche Kräfte und Fähigkeiten. Die Kunst aber soll für diejenigen Organe bilden, mit denen wir sie auffassen; tut sie das nicht, so verfehlt sie ihren Zweck und geht ohne die eigentliche Wirkung an uns vorüber. Ein religiöser Stoff kann indes gleichfalls ein guter Gegenstand für die Kunst sein, jedoch nur in dem Fall, wenn er allgemein menschlich ist. Deshalb ist eine Jungfrau mit dem Kinde ein durchaus guter Gegenstand, der hundertmal behandelt worden und immer gern wieder gesehen wird.«
Wir waren indes um das Gehölz, das Webicht, gefahren und bogen in der Nähe von Tiefurt in den Weg nach Weimar zurück, wo wir die untergehende Sonne im Anblick hatten. Goethe war eine Weile in Gedanken verloren, dann sprach er zu mir die Worte eines Alten:
Untergehend sogar ists immer dieselbige Sonne.
»Wenn einer fünfundsiebzig Jahre alt ist,« fuhr er darauf mit großer Heiterkeit fort, »kann es nicht fehlen, daß er mitunter an den Tod denke. Mich läßt dieser Gedanke in völliger Ruhe, denn ich habe die feste Überzeugung, daß unser Geist ein Wesen ist ganz unzerstörbarer Natur; es ist ein fortwirkendes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist der Sonne ähnlich, die bloß unsern irdischen Augen unterzugehen scheint, die aber eigentlich nie untergeht, sondern unaufhörlich fortleuchtet.«
Die Sonne war indes hinter dem Ettersberge hinabgegangen; wir spürten in dem Gehölz einige Abendkühle und fuhren desto rascher in Weimar hinein und an seinem Hause vor. Goethe bat mich, noch ein wenig mit hinaufzukommen, welches ich tat. Er war in äußerst guter, liebenswürdiger Stimmung. Er sprach darauf besonders viel über die Farbenlehre, über seine versteckten Gegner, und daß er das Bewußtsein habe, in dieser Wissenschaft etwas geleistet zu haben.
»Um Epoche in der Welt zu machen,« sagte er bei dieser Gelegenheit, »dazu gehören bekanntlich zwei Dinge: erstens, daß man ein guter Kopf sei, und zweitens, daß man eine große Erbschaft tue. Napoleon erbte die Französische Revolution, Friedrich der Große den Schlesischen Krieg, Luther die Finsternis der Pfaffen, und mir ist der Irrtum der Newtonischen Lehre zuteil geworden. Die gegenwärtige Generation hat zwar keine Ahnung, was hierin von mir geleistet worden; doch künftige Zeiten werden gestehen, daß mir keineswegs eine schlechte Erbschaft zugefallen.«
Goethe hatte mir heute früh ein Konvolut Papiere in bezug auf das Theater zugesendet; besonders fand ich darin zerstreute einzelne Bemerkungen, die Regeln und Studien enthaltend, die er mit Wolf und Grüner durchgemacht, um sie zu tüchtigen Schauspielern zu bilden. Ich fand diese Einzelnheiten von Bedeutung und für junge Schauspieler in hohem Grade lehrreich, weshalb ich mir vornahm, sie zusammenzustellen und daraus eine Art von Theaterkatechismus zu bilden. Goethe billigte dieses Vorhaben, und wir sprachen die Angelegenheit weiter durch. Dies gab Veranlassung, einiger bedeutender Schauspieler zu gedenken, die aus seiner Schule hervorgegangen, und ich fragte bei dieser Gelegenheit unter andern auch nach der Frau von Heygendorf. »Ich mag auf sie gewirkt haben,«sagte Goethe, »allein meine eigentliche Schülerin ist sie nicht. Sie war auf den Brettern wie geboren und gleich in allem sicher und entschieden gewandt und fertig, wie die Ente auf dem Wasser. Sie bedurfte meiner Lehre nicht, sie tat instinktmäßig das Rechte, vielleicht ohne es selber zu wissen.«
Wir sprachen darauf über die manchen Jahre seiner Theaterleitung, und welche unendliche Zeit er damit für sein schriftstellerisches Wirken verloren. »Freilich,« sagte Goethe, »ich hätte indes manches gute Stück schreiben können, doch wenn ich es recht bedenke, gereut es mich nicht. Ich habe all mein Wirken und Leisten immer nur symbolisch angesehen, und es ist mir im Grunde ziemlich gleichgültig gewesen, ob ich Töpfe machte oder Schüsseln.«
Donnerstag, den 6. [Sonntag, den 16.] Mai 1824
Als ich im vorigen Sommer nach Weimar kam, war es, wie gesagt, nicht meine Absicht, hier zu bleiben, ich wollte vielmehr bloß Goethes persönliche Bekanntschaft machen und dann an den Rhein gehen, wo ich an einem passenden Ort längere Zeit zu verweilen gedachte.
Gleichwohl ward ich in Weimar durch Goethes besonderes Wohlwollen gefesselt; auch gestaltete sich mein Verhältnis zu ihm immer mehr zu einem praktischen, indem er mich immer tiefer in sein Interesse zog und mir, als Vorbereitung einer vollständigen Ausgabe seiner Werke, manche nicht unwichtige Arbeit übertrug.
So stellte ich im Laufe dieses Winters unter andern verschiedene Abteilungen ›Zahmer Xenien‹ aus den konfusesten Konvoluten zusammen, redigierte einen Band neuer Gedichte sowie den erwähnten Theaterkatechismus und eine skizzierte Abhandlung über den Dilettantismus in den verschiedenen Künsten.
Jener Vorsatz, den Rhein zu sehen, war indes in mir beständig wach geblieben, und damit ich nicht ferner den Stachel einer unbefriedigten Sehnsucht in mir tragen möchte, so riet Goethe selber dazu, einige Monate dieses Sommers auf einen Besuch jener Gegenden zu verwenden.
Es war jedoch sein ganz entschiedener Wunsch, daß ich nach Weimar zurückkehren möchte. Er führte an, daß es nicht gut sei, kaum geknüpfte Verhältnisse wieder zu zerreißen, und daß alles im Leben, wenn es gedeihen wolle, eine Folge haben müsse. Er ließ dabei nicht undeutlich merken, daß er mich in Verbindung mit Riemer dazu ausersehen, ihn nicht allein bei der bevorstehenden neuen Ausgabe seiner Werke tätigst zu unterstützen, sondern auch jenes Geschäft mit gedachtem Freunde allein zu übernehmen, im Fall er bei seinem hohen Alter abgerufen werden sollte.
Er zeigte mir diesen Morgen große Konvolute seiner Korrespondenz, die er im sogenannten Büstenzimmer hatte auseinander legen lassen. »Es sind dies alles Briefe,« sagte er, »die seit Anno 1780 von den bedeutendsten Männern der Nation an mich eingegangen; es steckt darin ein wahrer Schatz von Ideen, und es soll ihre öffentliche Mitteilung Euch künftig vorbehalten sein. Ich lasse jetzt einen Schrank machen, wohinein diese Briefe nebst meinem übrigen literarischen Nachlasse gelegt werden. Das sollen Sie erst alles in Ordnung und beieinander sehen, bevor Sie Ihre Reise antreten, damit ich ruhig sei und eine Sorge weniger habe.«
Er eröffnete mir sodann, daß er diesen Sommer Marienbad abermals zu besuchen gedenke, daß er jedoch erst Ende Juli gehen könne, wovon er mir alle Gründe zutraulich entdeckte. Er äußerte den Wunsch, daß ich noch vor seiner Abreise zurück sein möchte, um mich vorher noch zu sprechen.
Ich besuchte darauf nach einigen Wochen meine Lieben zu Hannover, verweilte dann während der Monate Juni und Juli am Rhein, wo ich, besonders zu Frankfurt, Heidelberg und Bonn, unter Goethes Freunden manche werte Bekanntschaft machte.
Dienstag, den 10. August 1824
Seit etwa acht Tagen bin ich von meiner Rheinreise zurück. Goethe äußerte bei meiner Ankunft eine lebhafte Freude, und ich meinerseits war nicht weniger glücklich, wieder bei ihm zu sein. Er hatte sehr viel zu reden und mitzuteilen, so daß ich die ersten Tage wenig von seiner Seite kam. Seine frühere Absicht, nach Marienbad zu gehen, hat er aufgegeben, er will diesen Sommer gar keine Reise machen. »Nun da Sie wieder hier sind,« sagte er gestern, »kann es noch einen recht hübschen August für mich geben.«
Vor einigen Tagen kommunizierte er mir die Anfänge einer Fortsetzung von ›Wahrheit und Dichtung‹, ein auf Quartblättern geschriebenes Heft, kaum von der Stärke eines Fingers. Einiges ist ausgeführt, das meiste jedoch nur in Andeutungen enthalten. Doch ist bereits eine Abteilung in fünf Bücher gemacht, und die schematisierten Blätter sind so zusammengelegt, daß man bei einigem Studium den Inhalt des Ganzen wohl übersehen kann.
Das bereits Ausgeführte erscheint mir nun so vortrefflich und der Inhalt des Schematisierten von solcher Bedeutung, daß ich auf das lebhafteste bedaure, eine so viel Belehrung und Genuß versprechende Arbeit ins Stocken geraten zu sehen, und daß ich Goethe auf alle Weise zu einer baldigen Fortsetzung und Vollendung treiben werde.
Die Anlage des Ganzen hat sehr viel vom Roman. Zartes, anmutiges, leidenschaftliches Liebesverhältnis, heiter im Entstehen, idyllisch im Fortgange; tragisch am Ende durch ein stillschweigendes gegenseitigem Entsagen, schlingt sich durch vier Bücher hindurch und verbindet diese zu einem wohlgeordneten Ganzen. Der Zauber von Lilis Wesen, im Detail geschildert ist geeignet jeden Leser zu fesseln, so wie er den Liebenden selbst dergestalt in Banden hielt, daß er sich nur durch eine wiederholte Flucht zu retten imstande war.
Die dargestellte Lebensepoche ist gleichfalls höchst romantischer Natur, oder sie wird es, indem sie sich an dem Hauptcharakter entwickelt. Von ganz besonderer Bedeutung und Wichtigkeit aber ist sie dadurch, daß sie, als Vorepoche der weimarischen Verhältnisse, für das ganze Leben entscheidet. Wenn also irgendein Abschnitt aus Goethes Leben Interesse hat und den Wunsch einer detaillierten Darstellung rege macht, so ist es dieser.
Um nun bei Goethe für die unterbrochene und seit Jahren ruhende Arbeit neue Lust und Liebe zu erregen, habe ich diese Angelegenheit nicht allein sogleich mündlich mit ihm besprochen, sondern ich habe ihm auch heute folgende Notizen zugehen lassen, damit es ihm vor die Augen trete, was vollendet ist und welche Stellen noch einer Ausführung und anderweiten Anordnung bedürfen.
Erstes Buch
Dieses Buch, welches der anfänglichen Absicht gemäß als fertig anzusehen ist, enthält eine Art von Exposition, indem namentlich darin der Wunsch nach Teilnahme an Weltgeschäften ausgesprochen wird, auf dessen Erfüllung das Ende der ganzen Epoche durch die Berufung nach Weimar abläuft. Damit es sich aber dem Ganzen noch inniger anschließen möge, so rate ich, das durch die folgenden vier Bücher gehende Verhältnis zu Lili schon in diesem ersten Buche anzuknüpfen und fortzuführen bis zu der Ausflucht nach Offenbach. Dadurch würde auch dieses erste Buch an Umfang und Bedeutung gewinnen und ein allzu starkes Anwachsen des zweiten verhütet werden.
Zweites Buch
Das idyllische Leben zu Offenbach eröffnete sodann dieses zweite Buch und führte das glückliche Liebesverhältnis durch, bis es zuletzt einen bedenklichen, ernsten, ja tragischen Charakter anzunehmen beginnt. Hier ist nun die Betrachtung ernster Dinge, wie sie das Schema in bezug auf Stilling verspricht, wohl am Platze, und es läßt sich aus den nur mit wenigen Worten angedeuteten Intentionen auf viel Belehrendes von hoher Bedeutung schließen.
Drittes Buch
Das dritte Buch, welches den Plan zu einer Fortsetzung des ›Faust‹ usw. enthält, ist als Episode zu betrachten, welche sich durch den noch auszuführenden Versuch der Trennung von Lili den übrigen Büchern gleichfalls anschließt.
Ob nun dieser Plan zu ›Faust‹ mitzuteilen oder zurückzuhalten sein wird, dieser Zweifel dürfte sich dann beseitigen lassen, wenn man die bereits fertigen Bruchstücke zur Prüfung vor Augen hat und erst darüber klar ist, ob man überall die Hoffnung einer Fortsetzung des ›Faust‹ aufgeben muß oder nicht.
Viertes Buch
Das dritte Buch schlösse mit dem Versuch einer Trennung von Lili. Dieses vierte beginnt daher sehr passend mit der Ankunft der Stolberge und Haugwitzens, wodurch die Schweizerreise und mithin die erste Flucht von Lili motiviert wird. Das über dieses Buch vorhandene ausführliche Schema verspricht uns die interessantesten Dinge und erregt den Wunsch nach möglichst detaillierter Ausführung auf das lebendigste. Die immer wieder hervorbrechende, nicht zu unterdrückende Leidenschaft zu Lili durchwärmt auch dieses Buch mit der Glut jugendlicher Liebe und wirft auf den Zustand des Reisenden eine höchst eigene, angenehme, zauberische Beleuchtung.
Fünftes Buch
Dieses schöne Buch ist gleichfalls beinahe vollendet. Fortgang und Ende, welche an das unerforschliche höchste Schicksalswesen hinanstreifen, ja es aussprechen, sind wenigstens als durchaus fertig anzusehen, und es bedarf nur noch mit wenigem der Einleitung, worüber ja auch bereits ein sehr klares Schema vorliegt. Die Ausführung dieses ist aber um so notwendiger und wünschenswerter, als dadurch die weimarischen Verhältnisse zuerst zur Sprache kommen und das Interesse für sie zuerst rege gemacht wird.
Montag, den 16. August 1824
Der Verkehr mit Goethe war in diesen Tagen sehr reichhaltig, ich jedoch mit anderen Dingen zu beschäftigt, als daß es mir möglich gewesen, etwas Bedeutendes aus der Fülle seiner Gespräche niederzuschreiben.
Nur folgende Einzelheiten finden sich in meinem Tagebuche notiert, wovon ich die Verbindung und die Anlässe vergessen, aus denen sie hervorgegangen:
»Menschen sind schwimmende Töpfe, die sich aneinanderstoßen.«
»Am Morgen sind wir am klügsten, aber auch am sorglichsten; denn auch die Sorge ist eine Klugheit, wiewohl nur eine passive. Die Dummheit weiß von keiner Sorge.«
»Man muß keine Jugendfehler ins Alter hineinnehmen, denn das Alter führt seine eigenen Mängel mit sich.«
»Das Hofleben gleicht einer Musik, wo jeder seine Takte und Pausen halten muß.«
»Die Hofleute müßten vor Langerweile umkommen, wenn sie ihre Zeit nicht durch Zeremonie auszufüllen wüßten.«
»Es ist nicht gut einem Fürsten zu raten, auch in der geringfügigsten Sache abzudanken.«
»Wer Schauspieler bilden will, muß unendliche Geduld haben.«
Dienstag, den 9. November 1824
Abends bei Goethe. Wir sprachen über Klopstock und Herder, und ich hörte ihm gerne zu, wie er die großen Verdienste dieser Männer gegen mich auseinandersetzte.
»Unsere Literatur«, sagte er, »wäre ohne die gewaltigen Vorgänger das nicht geworden, was sie jetzt ist. Mit ihrem Auftreten waren sie der Zeit voran und haben sie gleichsam nach sich gerissen; jetzt aber ist die Zeit ihnen vorangeeilt, und sie, die einst so notwendig und wichtig waren, haben jetzt aufgehört Mittel zu sein. Ein junger Mensch, der heutzutage seine Kultur aus Klopstock und Herder ziehen wollte, würde sehr zurückbleiben.«
Wir sprachen über Klopstocks ›Messias‹ und seine ›Oden‹ und gedachten ihrer Verdienste und Mängel. Wir waren einig, daß Klopstock zur Anschauung und Auffassung der sinnlichen Welt und Zeichnung von Charakteren keine Richtung und Anlage gehabt, und daß ihm also das Wesentlichste zu einem epischen und dramatischen Dichter, ja man könnte sagen, zu einem Dichter überhaupt, gefehlt habe.
»Mir fällt hier jene Ode ein,« sagte Goethe, »wo er die deutsche Muse mit der britischen einen Wettlauf machen läßt und in der Tat, wenn man bedenkt, was es für ein Bild gibt, wenn die beiden Mädchen miteinander laufen und die Beine werfen und den Staub mit ihren Füßen erregen, so muß man wohl annehmen, der gute Klopstock habe nicht lebendig vor Augen gehabt und sich nicht sinnbildlich ausgebildet, was er machte, denn sonst hätte er sich unmöglich so vergreifen können.«
Ich fragte Goethe, wie er in der Jugend zu Klopstock gestanden und wie er ihn in jener Zeit angesehen.
»Ich verehrte ihn«, sagte Goethe, »mit der Pietät, die mir eigen war; ich betrachtete ihn wie meinen Oheim. Ich hatte Ehrfurcht vor dem, was er machte, und es fiel mir nicht ein, darüber denken und daran etwas aussetzen zu wollen. Sein Vortreffliches ließ ich auf mich wirken und ging übrigens meinen eigenen Weg.«
Wir kamen auf Herder zurück, und ich fragte Goethe, was er für das beste seiner Werke halte. »Seine ›Ideen zur Geschichte der Menschheit‹«, antwortete Goethe, »sind unstreitig das vorzüglichste. Später warf er sich auf die negative Seite, und da war er nicht erfreulich.«
»Bei der großen Bedeutung Herders«, versetzte ich, »kann ich nicht mit ihm vereinigen, wie er in gewissen Dingen so wenig Urteil zu haben schien. Ich kann ihm z. B. nicht vergeben, daß er, zumal bei dem damaligen Stande der deutschen Literatur, das Manuskript des ›Götz von Berlichingen‹ ohne Würdigung seines Guten mit spöttelnden Anmerkungen zurücksandte. Es mußte ihm doch für gewisse Gegenstände an allen Organen fehlen.«
»In dieser Hinsicht war es arg mit Herder,« erwiderte Goethe; »ja wenn er als Geist in diesem Augenblick hier gegenwärtig wäre,« fügte er lebhaft hinzu, »er würde uns nicht verstehen.«
»Dagegen muß ich den Merck loben,« sagte ich, »daß er Sie trieb, den ›Götz‹ drucken zu lassen.«
»Das war freilich ein wunderlicher bedeutender Mensch«, erwiderte Goethe. »›Laß das Zeug drucken!‹ sagte er; ›es taugt zwar nichts, aber laß es nur drucken!‹ Er war nicht für das Umarbeiten und er hatte recht; denn es wäre wohl anders geworden, aber nicht besser.«
Mittwoch, den 24. November 1824
Ich besuchte Goethe abends vor dem Theater und fand ihn sehr wohl und heiter. Er erkundigte sich nach den hier anwesenden jungen Engländern, und ich sagte ihm, daß ich die Absicht habe, mit Herrn Doolan eine deutsche Übersetzung des Plutarch zu lesen. Dies führte das Gespräch auf die römische und griechische Geschichte, und Goethe äußerte sich darüber folgendermaßen:
»Die römische Geschichte«, sagte er, »ist für uns eigentlich nicht mehr an der Zeit. Wir sind zu human geworden, als daß uns die Triumphe des Cäsar nicht widerstehen sollten. So auch die griechische Geschichte bietet wenig Erfreuliches. Wo sich dieses Volk gegen äußere Feinde wendet, ist es zwar groß und glänzend, allein die Zerstückelung der Staaten und der ewige Krieg im Innern, wo der eine Grieche die Waffen gegen den andern kehrt, ist auch desto unerträglicher. Zudem ist die Geschichte unserer eigenen Tage durchaus groß und bedeutend, die Schlachten von Leipzig und Waterloo ragen so gewaltig hervor, daß jene von Marathon und ähnliche andere nachgerade verdunkelt werden. Auch sind unsere einzelnen Helden nicht zurückgeblieben: die französischen Marschälle und Blücher und Wellington sind denen des Altertums völlig an die Seite zu setzen.«
Das Gespräch wendete sich auf die neueste französische Literatur und der Franzosen täglich zunehmendes Interesse an deutschen Werken.
»Die Franzosen«, sagte Goethe, »tun sehr wohl, daß sie anfangen, unsere Schriftsteller zu studieren und zu übersetzen; denn beschränkt in der Form und beschränkt in den Motiven, wie sie sind, bleibt ihnen kein anderes Mittel, als sich nach außen zu wenden. Mag man uns Deutschen eine gewisse Formlosigkeit vorwerfen, allein wir sind ihnen doch an Stoff überlegen. Die Theaterstücke von Kotzebue und Iffland sind so reich an Motiven, daß sie sehr lange daran werden zu pflücken haben, bis alles verbraucht sein wird. Besonders aber ist ihnen unsere philosophische Idealität willkommen; denn jedes Ideelle ist dienlich zu revolutionären Zwecken.
Die Franzosen«, fuhr Goethe fort, »haben Verstand und Geist, aber kein Fundament und keine Pietät. Was ihnen im Augenblick dient, was ihrer Partei zugute kommen kann, ist ihnen das Rechte. Sie loben uns daher auch nie aus Anerkennung unserer Verdienste, sondern nur, wenn sie durch unsere Ansichten ihre Partei verstärken können.«
Wir sprachen darauf über unsere eigene Literatur, und was einigen unserer neuesten jungen Dichter hinderlich.
»Der Mehrzahl unserer jungen Poeten«, sagte Goethe, »fehlt weiter nichts, als daß ihre Subjektivität nicht bedeutend ist und daß sie im Objektiven den Stoff nicht zu finden wissen. Im höchsten Falle finden sie einen Stoff, der ihnen ähnlich ist, der ihrem Subjekte zusagt; den Stoff aber um sein selbst willen, weil er ein poetischer ist, auch dann zu ergreifen, wenn er dem Subjekt widerwärtig wäre, daran ist nicht zu denken.
Aber, wie gesagt, wären es nur bedeutende Personagen, die durch große Studien und Lebensverhältnisse gebildet würden, so möchte es, wenigstens um unsere jungen Dichter lyrischer Art, dennoch sehr gut stehen.«
Freitag, den 3. Dezember 1824
Es war mir in diesen Tagen ein Antrag zugekommen, für ein englisches Journal unter sehr vorteilhaften Bedingungen monatliche Berichte über die neuesten Erzeugnisse deutscher Literatur einzusenden. Ich war sehr geneigt, das Anerbieten anzunehmen, doch dachte ich, es wäre vielleicht gut, die Angelegenheit zuvor mit Goethe zu bereden.
Ich ging deshalb diesen Abend zur Zeit des Lichtanzündens zu ihm. Er saß bei herabgelassenen Rouleaux vor einem großen Tisch, auf welchem gespeist worden und wo zwei Lichter brannten, die zugleich sein Gesicht und eine kolossale Büste beleuchteten, die vor ihm auf dem Tische stand und mit deren Betrachtung er sich beschäftigte. »Nun,« sagte Goethe, nachdem er mich freundlich begrüßt, auf die Büste deutend, »wer ist das?« – »Ein Poet, und zwar ein Italiener scheint es zu sein«, sagte ich. »Es ist Dante«, sagte Goethe. »Er ist gut gemacht, es ist ein schöner Kopf, aber er ist doch nicht ganz erfreulich. Er ist schon alt, gebeugt, verdrießlich, die Züge schlaff und herabgezogen, als wenn er eben aus der Hölle käme. Ich besitze eine Medaille, die bei seinen Lebzeiten gemacht worden, da ist alles bei weitem schöner.« Goethe stand auf und holte die Medaille. »Sehen Sie, was hier die Nase für Kraft hat, wie die Oberlippe so kräftig aufschwillet, und das Kinn so strebend ist und mit den Knochen der Kinnlade so schön zusammenfließt! Die Partie um die Augen, die Stirn ist in diesem kolossalen Bilde fast dieselbige geblieben, alles übrige ist schwächer und älter. Doch damit will ich das neue Werk nicht schelten, das im ganzen sehr verdienstlich und sehr zu loben ist.«
Goethe erkundigte sich sodann, wie ich in diesen Tagen gelebt und was ich gedacht und getrieben. Ich sagte ihm, daß mir eine Aufforderung zugekommen, unter sehr vorteilhaften Bedingungen für ein englisches Journal monatliche Berichte über die neuesten Erzeugnisse deutscher schöner Prosa einzureichen, und daß ich sehr geneigt sei, das Anerbieten anzunehmen.
Goethes Gesicht, das bisher so freundlich gewesen, zog sich bei diesen Worten ganz verdrießlich, und ich konnte in jeder seiner Mienen die Mißbilligung meines Vorhabens lesen.
»Ich wollte,« sagte er, »Ihre Freunde hätten Sie in Ruhe gelassen. Was wollen Sie sich mit Dingen befassen, die nicht in Ihrem Wege liegen und die den Richtungen Ihrer Natur ganz zuwider sind? Wir haben Gold, Silber und Papiergeld, und jedes hat seinen Wert und seinen Kurs, aber um jedes zu würdigen, muß man den Kurs kennen. Mit der Literatur ist es nicht anders. Sie wissen wohl die Metalle zu schätzen, aber nicht das Papiergeld, Sie sind darin nicht hergekommen, und da wird Ihre Kritik ungerecht sein, und Sie werden die Sachen vernichten. Wollen Sie aber gerecht sein und jedes in seiner Art anerkennen und gelten lassen, so müssen Sie sich zuvor mit unserer mittleren Literatur ins Gleichgewicht setzen und sich zu keinen geringen Studien bequemen. Sie müssen zurückgehen und sehen, was die Schlegel gewollt und geleistet, und dann alle neuesten Autoren: Franz Horn, Hoffmann, Clauren usw., alle müssen Sie lesen. Und das ist nicht genug. Auch alle Zeitschriften, vom ›Morgenblatt‹ bis zur ›Abendzeitung‹ müssen Sie halten, damit Sie von allem Neuhervortretenden sogleich in Kenntnis sind, und damit verderben Sie Ihre schönsten Stunden und Tage. Und dann, alle neuen Bücher, die Sie einigermaßen gründlich anzeigen wollen, müssen Sie doch auch nicht bloß durchblättern, sondern sogar studieren. Wie würde Ihnen das munden! Und endlich, wenn Sie das Schlechte schlecht finden, dürfen Sie es nicht einmal sagen, wenn Sie sich nicht der Gefahr aussetzen wollen, mit aller Welt in Krieg zu geraten.
Nein, wie gesagt, schreiben Sie das Anerbieten ab, es liegt nicht in Ihrem Wege. Überhaupt hüten Sie sich vor Zersplitterung und halten Sie Ihre Kräfte zusammen. Wäre ich vor dreißig Jahren so klug gewesen, ich würde ganz andere Dinge gemacht haben. Was habe ich mit Schiller an den ›Horen‹ und ›Musenalmanachen‹ nicht für Zeit verschwendet! Grade in diesen Tagen, bei Durchsicht unserer Briefe ist mir alles recht lebendig geworden, und ich kann nicht ohne Verdruß an jene Unternehmungen zurückdenken, wobei die Welt uns mißbrauchte und die für uns selbst ganz ohne Folge waren. Das Talent glaubt freilich, es könne das auch, was es andere Leute tun sieht; allein es ist nicht so, und es wird seine faux-frais bereuen. Was haben wir davon, wenn unsere Haare auf eine Nacht gewickelt sind? Wir haben Papier in den Haaren, das ist alles, und am andern Abend sind sie doch wieder schlicht.
Es kommt darauf an,« fuhr Goethe fort, »daß Sie sich ein Kapital bilden, das nie ausgeht. Dieses werden Sie erlangen in dem begonnenen Studium der englischen Sprache und Literatur. Halten Sie sich dazu und benutzen Sie die treffliche Gelegenheit der jungen Engländer zu jeder Stunde. Die alten Sprachen sind Ihnen in der Jugend größtenteils entgangen, deshalb suchen Sie in der Literatur einer so tüchtigen Nation, wie die Engländer, einen Halt. Zudem ist ja unsere eigene Literatur größtenteils aus der ihrigen hergekommen. Unsere Romane, unsere Trauerspiele, woher haben wir sie denn als von Goldsmith, Fielding und Shakespeare? Und noch heutzutage, wo wollen Sie denn in Deutschland drei literarische Helden finden, die dem Lord Byron, Moore und Walter Scott an die Seite zu setzen wären? Also noch einmal, befestigen Sie sich im Englischen, halten Sie Ihre Kräfte zu etwas Tüchtigem zusammen, und lassen Sie alles fahren, was für Sie keine Folge hat und Ihnen nicht gemäß ist.«
Ich freute mich, daß ich Goethe zu reden gebracht, und war in meinem Innern vollkommen beruhigt und entschlossen, nach seinem Rat in alle Wege zu handeln.
Herr Kanzler von Müller ließ sich melden und setzte sich zu uns. Und so kam das Gespräch wieder auf die vor uns stehende Büste des Dante und dessen Leben und Werke. Besonders ward der Dunkelheit jener Dichtungen gedacht, wie seine eigenen Landsleute ihn nie verstanden, und daß es einem Ausländer um so mehr unmöglich sei, solche Finsternisse zu durchdringen. »Ihnen«, wendete sich Goethe freundlich zu mir, »soll das Studium dieses Dichters von Ihrem Beichtvater hiemit durchaus verboten sein.«
Goethe bemerkte ferner, daß der schwere Reim an jener Unverständlichkeit vorzüglich mit schuld sei. Übrigens sprach Goethe von Dante mit aller Ehrfurcht, wobei es mir merkwürdig war, daß ihm das Wort Talent nicht genügte, sondern daß er ihn eine Natur nannte, als womit er ein Umfassenderes, Ahndungsvolleres, tiefer und weiter um sich Blickendes ausdrücken zu wollen schien.
Donnerstag, den 9. Dezember 1824
Ich ging gegen Abend zu Goethe. Er reichte mir freundlich die Hand entgegen und begrüßte mich mit dem Lobe meines Gedichtes zu Schellhorns Jubiläum. Ich brachte ihm dagegen die Nachricht, daß ich geschrieben und das englische Anerbieten abgelehnt habe.
»Gottlob,« sagte er, »daß Sie wieder frei und in Ruhe sind. Nun will ich Sie gleich noch vor etwas warnen. Es werden die Komponisten kommen und eine Oper haben wollen; aber da seien Sie gleichfalls nur standhaft und lehnen Sie ab, denn das ist auch eine Sache, die zu nichts führt und womit man seine Zeit verdirbt.«
Goethe erzählte mir darauf, daß er dem Verfasser des ›Paria‹ durch Nees von Esenbeck den Komödienzettel nach Bonn geschickt habe, woraus der Dichter sehen möge, daß sein Stück hier gegeben worden. »Das Leben ist kurz,« fügte er hinzu, »man muß sich einander einen Spaß zu machen suchen.«
Die Berliner Zeitungen lagen vor ihm, und er erzählte mir von der großen Wasserflut in Petersburg. Er gab mir das Blatt, daß ich es lesen möchte. Er sprach dann über die schlechte Lage von Petersburg und lachte beifällig über eine Äußerung Rousseaus, welcher gesagt habe, daß man ein Erdbeben dadurch nicht verhindern könne, daß man in die Nähe eines feuerspeienden Berges eine Stadt baue. »Die Natur geht ihren Gang,« sagte er, »und dasjenige, was uns als Ausnahme erscheint, ist in der Regel.«
Wir gedachten darauf der großen Stürme, die an allen Küsten gewütet, sowie der übrigen gewaltsamen Naturäußerungen, welche die Zeitungen gemeldet, und ich fragte Goethe, ob man wohl wisse, wie dergleichen zusammenhänge. »Das weiß niemand,« antwortete Goethe, »man hat kaum bei sich von solchen geheimen Dingen eine Ahndung, viel weniger könnte man es aussprechen.«
Oberbaudirektor Coudray ließ sich melden, desgleichen Professor Riemer; beide gesellten sich zu uns, und so wurde denn die Wassersnot von Petersburg abermals durchgesprochen, wobei Coudray uns durch Zeichnung des Planes jener Stadt die Einwirkungen der Newa und übrige Lokalität deutlich machte.