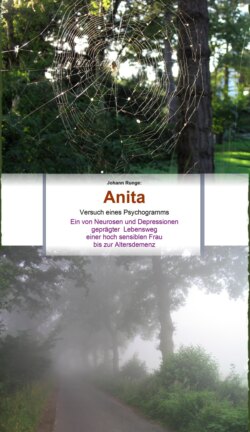Читать книгу Anita - Ein von Neurosen und Depressionen geprägter Lebensweg einer hoch sensiblen Frau bis zur Altersdemenz - Johann Runge - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorbemerkung
ОглавлениеZum besseren Verständnis dieses Versuchs eines Psychogramms sei hier aus dem Ende der 1960er Jahre erschienenen Buch von Norbert Lebert zitiert:
Krankheit ist kein Zufall
(alternativer Titel: Psychopotenz)
Die Seele – das Wort ist ausgesprochen, und schon sind wir von bösen Zweifeln heimgesucht. Gibt es denn überhaupt eine Seele? Ist das nicht eine Sache des Glaubens, eine Frage der Religion, der Philosophie? Was hat sie mit der Medizin zu tun? Der Pathologe Rudolf Virchow, einer der größten Mediziner des vergangenen Jahrhunderts, hat ihr deutlich abgeschworen: „Ich habe tausend Leichen seziert und nie eine Seele gefunden.“
Wir wissen, dass Sigmund Freud sie sozusagen entdeckt hat, dass er sie kühn in ein medizinisches Lehrgebäude eingebaut hat. Welche Rolle sie heute in der Medizin spielt – damit wollen wir uns hier beschäftigen.
Seele bedeutet entsprechend dem griechischen „Psyche“ und dem lateinischen „Anima“ soviel wie Hauch, Atem, Wind, etwas Flüchtiges also, nicht greifbare Materie, kein Objekt, nichts Fassbares. Wenn sich der Arzt heute um sie bemüht, so tut er es anders als der Priester. Beide verstehen unter Seele nicht dasselbe. Christliche Seelsorge und angewandte Psychologie haben nichts miteinander zu tun. Sie bewegen sich auf verschiedenen Ebenen. Wo der eine von Sünde spricht, diagnostiziert der andere vielleicht eine Neurose.
Ob sie unsterblich ist, unsere Seele, das kann der Arzt nicht entscheiden. Natürlich drängt sich die Frage auf: Wenn nicht von der unsterblichen Seele die Rede ist, von welcher sprechen wir dann? Was sollen wir uns darunter vorstellen?
Nun, es scheint, der Begriff Seele ist für die Beschreibung der Wirklichkeit eines Menschen unentbehrlich. Ohne die Idee einer Seele, die in uns wohnt, kommt niemand aus. Der Theologe muss sie zitieren, der Philosoph, der Arzt. Der Tübinger Professor für Psychiatrie und Neurologie Ernst Kretschmer definierte sie so: „Seele nennen wir das unmittelbare Erleben. Seele ist alles Empfundene, Wahrgenommene, Gefühlte, Vorgestellte, Gewollte. Seele ist die Welt als Erlebnis.“
Die Tiefenpsychologie hat klargemacht, was die Erlebnissphäre eines Menschen bedeutet. Wir leben nicht nur bewusst, vom Verstand her, wir leben auch unbewusst. Wir machen Erfahrungen, von denen wir gar nicht wissen, dass wir sie gemacht haben. Diese Erfahrungen werden aber sehr wohl registriert, in einer Schicht unterhalb unseres Bewusstseins, die Freud das „Es“ genannt hat.
Was uns speziell das Unbewusstsein alles antun kann, werden wir noch sehen. Fest steht, dass das Phänomen Seele damit noch lange nicht erklärt ist. Denn da ist noch das Gewissen, das „Über-Ich“ also, eine Kontrollinstanz, deren Existenz schwer zu leugnen ist. Auch dem Ungläubigen schlägt das Gewissen, auch er kennt Schuldgefühle, auch ihn mahnt eine innere Stimme.
Die Frage, wo diese Seele in unserem Körper beheimatet sein könnte, hat der große Physiker Max Planck als ein Scheinproblem bezeichnet. Die Aufteilung in Leib und Seele sei gar nicht möglich. Der Mensch müsse als eine untrennbare Einheit gesehen werden. Planck betonte, seelische und körperliche, Vorgänge vollzögen sich so gleichzeitig, dass sie als ein und derselbe Vorgang angesehen werden müssten.
Nun, die Gleichzeitigkeit lässt sich nicht bestreiten. Das kann jeder Mensch an sich selbst beobachten. Wenn man erschrickt, wird man blass. In gewissen Situationen bekommt man eine Gänsehaut: Wenn man sich aufregt, bricht einem der Schweiß aus. In einer Schrecksekunde kann das Herz stillstehen.
…Experimente mit der Galle und der Schilddrüse deuten an, wie sehr der gesamte Organismus mitfühlt. Vom dieser Seite her ist die Erforschung des Menschen zweifellos lange vernachlässigt worden.
Die Medizin hätte die Seele des Menschen gern dem Beichtvater überlassen, ging nur sehr zögernd daran, sich nun auch noch um „diese Dinge“ zu kümmern. Zunächst waren es nur Außenseiter, die dazu aufforderten, den Menschen nicht nur als einen anatomischen und physiologischen Mechanismus zu betrachten, sondern als ein Wesen, das von Liebe und Haas, von Trieben und Leidenschaften beherrscht wird, die durchaus imstande sind, körperliche Krankheiten zu produzieren.
Erst in den letzten … Jahrzehnten geriet die Medizin in Bewegung. Die psychosomatische Medizin wurde geboren. 1943 erschien das erste richtige Lehrbuch. Es setzte neue Maßstäbe und wurde von den Ärzten in der ganzen Welt beachtet.
Nicht dass die Psychosomatiker etwa von exakten wissenschaftlichen. Methoden abrückten, dass sie etwa einen Laborbefund unterschätzten oder die sorgfältige körperliche Untersuchung der Kranken nicht für wichtig hielten – keineswegs, aber dass dies das einzige Kriterium sein sollte, dass bei der Betrachtung von Krankheiten nur diese Befunde berücksichtigt wurden, leuchtete ihnen nicht ein, dagegen begannen sie nun Sturm zu laufen.
Die Krankheit, so stellten sie fest, darf nicht vom lebenden Menschen abgelöst werden, so, als stände sie in keiner tieferen Beziehung zu ihm. Die Psychosomatiker machten deutlich, dass viele Krankheitsprozesse sich diesem Schema entzogen, dass sie nur von der Persönlichkeit des Kranken her zu begreifen waren.
In der Praxis sieht das dann so aus, dass sich ein chronischer Durchfall als eine Art Gemütskrankheit entpuppt. Jede gezielte Darmtherapie versagt, muss versagen, weil die Ursache des Leidens überhaupt nicht organischer Natur ist. Soll der Darm wieder vernünftig arbeiten, so muss der Arzt die seelischen Hintergründe aufdecken, den Patienten nach seiner Ehe fragen, nach seinem Beruf, nach seinen Sorgen und Nöten.
Damit wir uns nicht falsch verstehen: Dies ist kein sehr ausgefallenes Beispiel. Wir werden später noch sehen, wie sehr unser Darm auf bestimmte psychische Zustände reagiert und welches dramatische Geschehen ausgelöst werden kann.
Die psychosomatische Medizin ist keine Spezialdisziplin, ganz bestimmt keine neue Wunderlehre. Was sie neu entwickelt, wozu sie auffordert: eine andere Krankheitsauffassung.