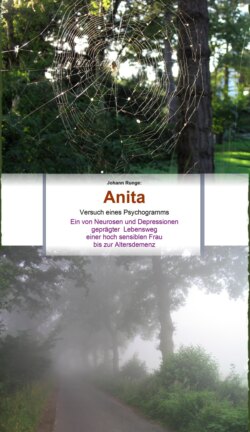Читать книгу Anita - Ein von Neurosen und Depressionen geprägter Lebensweg einer hoch sensiblen Frau bis zur Altersdemenz - Johann Runge - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Anita – Herkunft, Kindheit, Jugend
ОглавлениеAnita kam vor Ausbruch des 2. Weltkrieges in einer heute zu Polen gehörenden preußisch-pommerschen Verwaltungs- und Beamtenstadt als drittes Kind der Familie zur Welt.
Ihr Vater Franz war drittes Kind eines einfachen Arbeiters, der im 1. Weltkrieg „für Kaiser und Reich“ gefallen war. Seine Mutter war als Kriegerwitwe darauf angewiesen, die karge Versorgungsrente durch eigene Arbeit (Fischverkauf) aufzubessern. Franz’ Lehrer rieten der Muter, den begabten Jungen das Gymnasium besuchen zu lassen. Doch diese wehrte ab: „Die älteren Brüder durften das auch nicht. Also braucht es auch Franz nicht.“ Der Geigenunterricht wurde abgebrochen, als der wilde Junge damit auf der Treppe stürzte und das Instrument dabei Schaden nahm. Durch diese frühen falschen Weichenstellungen wurde der weitere Lebensweg des hoch begabten Franz entscheidend auf falsche Geleise geführt, so dass er sich später beispielsweise Anerkennung bei Frauen auch außerhalb der Ehe suchte. Alkoholmissbrauch kam hinzu, der sich besonders krass auswirkte, weil Franz unter Alkoholeinfluss oft sehr aggressiv und unbeherrscht reagierte. Einer seiner älteren Brüder soll ich „tot gesoffen“ haben.
Wie heißt es doch schon in dem alten Buch? – 2. Mose, Kapitel 36 – „…der die Missetat der Väter heimsucht auf Kinder und Kindeskinder bis ins dritte und vierte Glied…“ Eine geborgene glückliche Kindheit – das wussten schon die Vorväter – ist die Grundvoraussetzung für eine gesunde Lebensentwicklung.
Anitas Mutter Emma stammte aus kleinbürgerlichen Verhältnissen. Sie hatte zwei ältere Brüder und eine ältere Schwester. Als sie vor der Ehe schwanger wurde, wollte der Erzeuger nicht zu seiner Vaterschaft stehen: „Deine Schwester ist doch Krankenschwester, da wird sich wohl ein Weg finden lassen!“ Aber Emma lebte nach dem Grundsatz: „Lieber eins auf dem Kissen, als auf dem Gewissen!“ So verheimliche sie die Schwangerschaft, solange es ging. In der Verwandtschaft gab es mehrere Frauen, die ihren Gang zur ‚Engelmacherin’ mit folgender Kinderlosigkeit bezahlten. Emmas Eltern akzeptierten ihre Mutterschaft nicht: „Was sollen denn die Nachbarn denken?!“ Ein uneheliches („unehrliches“) Kind galt damals noch als Schande. Sie musste das Kind in einer Klinik in einer größeren Stadt entbinden, wo sich niemand aus der Familie um sie kümmerte: „Wenn andere Besuch bekamen, drehte ich mich zur Wand und weinte bitterlich.“ Das Kind – ein Knabe – kam in ein Säuglingsheim, weil die Großeltern weiterhin ablehnend waren. Zunächst sollte die Vaterschaft und die Unterhaltszahlungen des Erzeugers geklärt werden. Von Hospitalismus und den daraus resultierenden schweren Störungen ahnte man nichts. Erst, als die Oma sah, wie sich die verheerenden Entwicklungsrückstände auch körperlich zeigten, nahmen sie das Kind auf und taten nun alles, um den Kleinen wieder aufzupeppeln. Dort bei den Großeltern wuchs das Kind dann auf und musste die frühkindlichen psychischen Schäden später als erwachsener Mann schmerzhaft psychotherapeutisch aufarbeiten. Seine Begabungen und sein enormer Fleiß ließen ihn in Eigeninitiative mehrere Sprachen erlernen und sich beruflich qualifizieren.
Als der Erzeuger der Mutter Emma dann irgendwann doch die Ehe anbot, war es zu spät. Inzwischen hatte Emma – war es Liebe oder Torschlusspanik? – den Franz kennen gelernt und geheiratet. Der hatte zuvor auch bereits zwei Kinder vorehelich in die Welt gesetzt.
Franz und Emma hatten zusammen zunächst zwei Söhne, bevor Anita geboren wurde. Beide Jungen waren sehr begabt, vor allem der Älteste. Der Jüngere befand sich natürlich als ‚zweiter Bruder’ in einer schwierigen Familienkonstellation, zumal ihm ständig sein begabter älterer Bruder als Vorbild vor Augen gehalten wurde. Der hoch begabte Ältere, dem alles zuflog, hat dennoch sein das Studium abschließende Examen verpatzt, weil er – der früher immer sehr solide lebte – sich als Student dem Suff hingab. Erst im zweiten Anlauf riss er sich zusammen und schaffte den Abschluss doch noch. Er ging dann seinen beruflichen Weg zwar erfolgreich, aber sein älterer Halbbruder meinte kritisch, er habe es bei der Begabung mit mehr Zielstrebigkeit erheblich weiter bringen können.
Als Anita geboren war, war ihr Vater überglücklich, einer Tochter zum Leben verholfen zu haben.
Da es „dem Führer“ teils durch günstige Konstellationen, teils durch massive Aufrüstung gelang, die große Arbeitslosigkeit zu überwinden, jubelten ihm Ende der 1930er viele Deutsche zu. Auch Vater Franz war wieder in Arbeit und Brot. Obwohl Franz immer wieder zu Alkoholabusus neigte und dann gewalttätig werden konnte, sorgte er doch durch regelmäßige Arbeit als Verwaltungsangestellter für seine Familie. In einer Zeit, zu der man noch keine digitalen Rechner kannte, waren seine Kopfrechenkünste sehr gefragt. Daher gelang es ihm auch später als Soldat, sich als Rechnungsführer in der heimischen Garnison als ‚Etappenhengst’ lange als unabkömmlich vom Fronteinsatz frei zu halten.
So wuchs Anita in früher Kindheit – trotzt immer wieder erlebter schmerzlicher Erfahrungen mit dem doch geliebten Vater – trotz ambivalenter Erlebnisse zunächst recht geborgen auf.
Anita konnte ihren Eltern, besonders der Mutter nie verzeihen, dass sie rauchten und Nikotin-abhängig waren. Als sie mal ein Arzt fragte, ob sie geraucht habe, war ihre Antwort: „Ich war eine pränatale Kettenraucherin.“ Nach einer ihrer Entbindungen fragte die Mutter den Arzt unmittelbar nach der Geburt: „Herr Doktor, jetzt kann ich mir doch eine anstecken?“ Zwar hatte Emma sich das Rauchen einige Jahre vor ihrem Tode „mit eisernem Willen“ abgewöhnt, starb aber dennoch an Lungenkrebs.
War eines der Kinder krank, gab es etwas Besonderes, um das das kranke Kind von den Geschwistern beneidet wurde, zum Beispiel eine heiße Zitrone oder ein Brötchen. Ob das dazu beigetragen haben könnte, dass Anita gerne ‚in Krankheit flüchtete’? Ihr Halbbruder schenkte ihr später mal, als sie schon erwachsen war, ein Buch mit dem Titel ‚Krankheit als Weg’.
Anita war ein hübsches Mädchen, hatte aber einen ‚Silberblick’, eine Augenmuskelschwächung, unter der sie, je älter und eitler sie wurde, litt. Eine Hausnachbarin damals zur Mutter: „Auch, wenn sie hübsche Löckchen hat, aber sie schielt.“ Dieser Sehfehler wurde Jahrzehnte später im Erwachsenenalter durch eine kosmetische Augenoperation behoben, so dass dann die durch die Misere bedingten die Persönlichkeit beeinflussenden Minderwertigkeitsgefühle teilweise abgebaut werden konnten.
Das Kind Anita sang und tanzte gerne. Es war von Anfang an immer ganz an die älteren Brüder gewöhnt, bei denen es sich geschützt und geborgen fühlte, von denen es viel lernte, auch die von den Brüdern oder den Eltern gesungenen Lieder und Schlager der Zeit. Auch die Gedichte und Balladen, die die Brüder meist laut auswendig lernten, verinnerlichte sie und konnte die Texte noch nach Jahrzehnten zitieren. Die Liedtexte waren sogar im hohen Alter bei fortgeschrittener Demenz und Verlust des Namensgedächtnisses bei Anstimmen der Melodie immer noch präsent.
Als Mutter von vier Kindern stand Emma nicht nur das „Mutterkreuz“, sondern auch ein „Pflichtjahrmädchen“ (Reichsarbeitsdienst) zu. Auch, als ‚der Führer’ zunächst Polen, dann andere Länder überfallen und besiegt hatte und danach in seiner Hybris auch in die Sowjetunion einfiel, wo er ‚Lebensraum’ für seine germanischen Volksgenossen erobern wollte, blieb es in Hinterpommern trotz alliierter Luftangriffe auf deutsche Großstädte und der Wende an der Ostfront noch sehr lange fast idyllisch ruhig.
So blieb die hinterpommersche Heimatstadt für Anita lebenslang ihr Paradies.
Bis ins hohe Alter ‚lebte’ sie mit ihren Erinnerungen in dieser Zeit der frühen Kindheit. Ihre Erinnerungen gehen erstaunlich weit in die frühe Kindheit zurück. Ihre sehr sensible Grundstruktur lässt sie alles im Detail erfassen und bildhaft beschreiben. Hier einige Texte aus ihrer Feder, in denen sie aus dieser ihrer Kindheit berichtet:
Beim morgendlichen Aufwachen freue ich mich schon riesig über die Sonnenstrahlen, die unser Kinderzimmer in eine Leuchtstube verwandelt haben. Dann darf ich heute auch gewiss mein schönstes Sommerkleid anziehen; das ganz dünne Weiße, aus durchsichtigem Voile, mit den bunten Blümchen darauf gestickt. Und ich brauche keine Schuhe anzuziehen. Herrlich, diese Leichtigkeit! Aber Schleifen hat mir die Mutter ins Haar gebunden, und im Spiegel schaut mir fast ein pastellfarbener Schmetterling entgegen, der sogar fröhlich singen kann. Eine kindliche Unbekümmertheit nistet sich in mir ein, so als könne mir niemand diesen goldenen Sommertag verderben. Geschwind laufe ich die Treppen herunter und spiele mit anderen Kindern auf der Straße Murmeln knipsen. Spielend kullern die kleinen Kugeln aus Ton, aber die Begehrtesten sind die aus Glas mit bunten schillernden Farbmustern darin. Meine nackten Füße bohren sich in den lockeren Sand hinein. Die warme Luft liebkost meinen kleinen fast nackten Körper. Später laufe ich durstig und hungrig zur Mutter in die Wohnung. Heute gibt es etwas Besonderes zu essen: Grießbrei mit Blaubeeren.
Nach dem Mittagsschlaf wird es draußen zunehmend dunkler. Es ist sehr schwül geworden, immer mehr dunkle Wolken rücken dicht zusammen. Dann folgen Blitz und Donner, und schon fallen die ersten Regentropfen auf die staubige und durstige Straße. Ich stehe gespannt am Fenster und schaue mir das wahrhaft himmlische Naturereignis an. Jetzt prasselt der Regen in dicken Tropfen laut an die Glasscheiben. Doch nach einer Weile hört es schon wieder auf zu regnen. Auf der Straße fließt nun im Rinnstein ein liebliches Bächlein entlang. Wohlig ist es, mit den nackten Füßen in der warmen Matsche zu wühlen, wie in einer dunklen Breimasse. Im weichen nassen Sand kann ich meine kleinen Fußabdrücke hinterlassen. Die Luft ist frischer geworden und der Himmel wieder blau und klar.
Am Abend gehen die Eltern, eine Tante und meine Brüder zusammen mit mir in unseren großen schönen Garten. Wir Geschwister spielen noch Fangen miteinander, über Beete hinweg und durch Wege entlang, hinter Hecken, Büschen und Sträuchern geduckt. Die letzten weißen Johannisbeeren, die die Mutter beim Pflücken übersehen hatte, schmecken mir köstlich. Ringelblumen, Löwenmäulchen, Kapuzinerkresse und all die vielen schmackhaften Früchte geben dem Garten eine ganz besondere Stimmung, eine bunte lachende Fröhlichkeit, wie in einem Paradiesgarten, zumindest für Kinder; denn manchmal höre ich die Mutter stöhnen, wenn sie gebückt in der Sonne das massenweise Unkraut jätet. Wenn sie aber die Blätter der Gurken etwas hochnimmt und die großen langen Früchte sieht, frohlockt sie: „Oh, oh.“ Wir Geschwister warten heute ungeduldig darauf, dass es dunkel wird. So lange darf ich sonst nicht aufbleiben. Aber heute ist ja ein ganz besonderer Tag, an dem wir den Sommer feiern wollen. Unsere Tante hat uns nämlich Lampions mitgebracht, die von eigenwilliger Schönheit sind. Meine Brüder bekommen Papierlaternen in Form eines Truthahns und Gockelhahns geschenkt, und ich darf einen schillernd bunten Erpel-Lampion mein eigen nennen. Endlich fängt es langsam an zu schummern, und ich setze mich schon erwartungsvoll in die gemütliche Laube auf die rustikale Holzbank, die mein Vater gezimmert hat. Diese Laube ist ringsherum dicht mit Stangenbohnen umwachsen, und auch die Blätter der rankenden Gemüsepflanze ergeben ein dichtes schützendes grünes Dach. Ich fühle mich in dieser Behausung wie in einem Naturparadies, einem Ort der Glückseligkeit.
Mit frischen Möhren, die noch Wassertropfen an ihren Spitzen haben, kommen die Brüder von der Regentonne her gelaufen und geben auch mir etwas „Futter“ gegen den aufkommenden Hunger. Danach holt unsere Mutter die Kerzen aus der Tasche, die sie von zu Hause mitgebracht hat. Das Aufstecken der Lichter in den Laternen und das Richten der Haltegriffe ist offenbar Vatersache. Inzwischen ist es auch tatsächlich dunkel geworden, und es weht kein Wind. Mit einem Streichholz zündet unser Vater die Lichter in den wunderschönen Lampions an, und erst jetzt kommen die Farben so richtig zu ihrer Geltung. Und alle Seligkeit auf Erden hat in meinem kleinen Kinderherz Platz. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich so dasaß, mit dieser herrlich bunten Papierlaterne in der kleinen Hand, die ich als Leuchtkugel hoch gegen den tiefdunkelblauen Sommernachthimmel hielt. Aber ich bin gewiss, dass dieser goldene Sommertag einer der schönsten Tage in meinem Leben war.
An meine fröhliche Mutter
Ich denke jetzt mit zunehmenden Jahren so oft
in großer Dankbarkeit an dich.
Du hast mich vom beginnenden Frühling,
wenn im Wald die ersten gelben Schlüsselblumen blühten,
bis in den späten bunten Herbst hinein
fast jeden Nachmittag in deinen großen
wunderschönen Garten mitgenommen.
Du warst eine liebevolle fröhliche Gärtnerin.
Ich habe dich niemals stöhnen gehört,
auch wenn im Sommer die Sonne heiß
vom blauen wolkenlosen Himmel schien,
hast du mit Freuden den großen Korb
mit roten Erdbeeren randvoll gefüllt
und bis nach Hause geschleppt.
Liebe Mutter, ich sehe dich noch heute,
wie du mit dem abgerundeten Holzstil der Harke,
in die vorbereiteten Beete
Rillen in die fein geharkte Erde gezogen
und dann mit dem Samentütchen in der Hand
Radieschen, Möhren, Kapuzinerkresse,
Ringelblumen und Goldlack
in gebückter Haltung ausgesät
und mit deiner fleißigen Hand
mit Erde zugedeckt hast.
Die schönste Laube mit den rot blühenden Stangenbohnen
war aus Glück geflochten, sie schenkte mir,
wenn ich auf der Holzbank in der Naturlaube saß,
Geborgenheit und Glückseligkeit.
Und wenn ich leicht wie ein bunter Schmetterling
auf den Wegen durch den fruchtigen Paradiesgarten hüpfte,
von den roten und weißen süßen Johannisbeeren
und zarten Schoten naschte,
war ich im Himmel auf Erden.
In sehr dankbarer Erinnerung
an meine längst verstorbene
fröhliche Mutter und begeisterte Gärtnerin.
Als Kind hab ich
die Schlüsselblumen gepflückt,
die da blühten im nahen Wald.
Der Mai war da
und Muttertag.
Ich wollte den Dank
an meine Mutter
reichlich und sichtbar
in meinen kleinen
festen Händen haben.
Wenn es draußen ungemütlich wird und die ersten Nachtfröste im Wetterbericht angekündigt werden, dann werden immer noch alte Kindheitserinnerungen in mir wach. Damals vor über 70 Jahren hatten in Hinterpommern die Wohnungen für die kalte Jahreszeit alle Doppelfenster, die im Sommer in der Bodenkammer aufbewahrt wurden. Wenn aber die ersten kalten Herbststürme um die Häuser Blasmusik machten, und die letzten Blätter von den Bäumen fegten, dann schleppte mein Vater die schützenden Doppelfenster die vielen Treppenstufen vom Dachboden bis in unsere Wohnung. Doch bevor der Vater den ‚Kälteschutz’ einsetzte, putzte meine Mutter die Glasscheiben erst blitzblank. Im Wohnzimmer stand ein großer brauner Kachelofen, der eine behagliche Wärme verbreitete. Das Heizmaterial für diesen Wärmespender wurde rechtzeitig beim Kohlenhändler bestellt. Ich kann mich noch heute an die Männer erinnern, wie sie von der schweren Last gebeugt, ihre dunklen Kapuzen über ihre Köpfe gezogen hatten, und die gefüllten Säcke mit Kohlen, Holz und Briketts in unseren Keller trugen. Es war dann unseres Vaters Amt, die anthrazitfarbenen glänzenden Briketts fein säuberlich an einer Kellerwand aufzustapeln. Auf einem Hackklotz spaltete der Familienvater die dicken Holzscheite zu feinem Anmachholz, immer etwas auf Vorrat, damit die Mutter von dieser Arbeit befreit war.
Meine fleißige und fürsorgliche Mutter hatte in einem anderen Kellerraum einen nicht zu übersehenden Vorrat an verschiedenem Gemüse und vor allem auch Obstsorten, die sie im eigenen großen Garten selber geerntet hatte. Die zahlreichen Weckgläser, die die reiche Ernte beherbergten, standen fein säuberlich aufgereiht in den Holzregalen, die der Vater eigens dafür gebaut hatte. In einer großen Kiste lagerten etliche Zentner Kartoffeln. Diese wertvolle Nahrung musste mengenmäßig bis zur Ernte der Frühkartoffeln im eigenen Garten reichen. In den Gemüseläden und Lebensmittelgeschäften wurden damals im Winter keine Kartoffeln in kleinen Mengen angeboten.
In Hinterpommern waren damals vor über siebzig Jahren die Winter sehr beständig. Der Schnee lag öfter wochenlang, und es war bitterkalt. Man brauchte im Winter die Doppelfenster. Der Vater hatte sie rechtzeitig im Herbst aus der Dachkammer, in der sie den Sommer über stationiert waren, herunter getragen und in die Rahmen eingesetzt. Von der Mutter waren die Glasscheiben blitzblank geputzt worden. Es war alles für den Einzug des Winters vorbereitet. Auch das Brennholz und die Briketts zum Beheizen der Kachelöfen waren im Keller aufgestapelt.
Eines Nachmittags, der Himmel war schon den ganzen Tag über so grau, schneevolle Wolken hingen tief und schwer, fing es ganz langsam an zu schneien. Weiße Flocken tanzten lustig auf die Erde hernieder. Das kleine Mädchen hatte aus Steinbauklötzen Häuser gebaut, in denen die „Mensch-ärgere-Dich-nicht“-Puppen zu lebendigen Menschen wurden. Es war ganz in dieses Spiel versunken, da rief einer der beiden älteren Brüder: „Es schneit, guck mal, es schneit!“ Schnell lief das Mädchen ans Fenster und drückte das Näschen neugierig an die Scheibe, und das Herz hüpfte vor Freude, machte Luftsprünge beim Anblick des fallenden Schnees. Verzaubert sahen Bäume, Zäune, die ganze Erde aus. Temperamentvoll bat es gleich den Vater, ihr doch den Rodelschlitten vom Boden zu holen. Aber der machte ihm verständlich, dass erst noch viel mehr Schnee fallen müsse, damit der Schlitten auch gleiten könne.
Aufgeregt, erwartungsvoll und ungeduldig blieb das Kind dann auch eine ganze Zeit am Fenster stehen, bis der Vater die Schneedecke für hoch genug zum Rodeln befand. Es ließ ihm auch nicht eher Ruhe, bis er den Schlitten die Treppen herunter getragen hatte. Inzwischen hatte es sich Trainingshosen, Mantel, Mütze und Handschuhe angezogen. Die älteren Brüder wollten natürlich auch im ersten Schnee dieses Winters rodeln. Zum Lenken brauchte sie ohnehin noch einen verlässlichen Steuermann. Sie stapften gemeinsam durch den pulvrigen Schnee und zogen vereint den Schlitten hinter sich her. Am größten Berg angekommen, fuhren sie die steilsten Abhänge, glattesten Bahnen herunter.
Kalter Wind sauste um ihre Köpfe. Mit geröteten Wangen zogen sie den Schlitten nach jeder Abwärtsfahrt wieder den Berg hinauf. Die Herzen jubelten, die Kinder lachten, der Schnee wurde aufgewirbelt. Ehe sie es bemerkten, legte die Dunkelheit ihren schwarzen Mantel sanft über die weiße Pracht.
Nasse Wollhandschuhe, kalte Füße, leere Mägen, so zogen sie etwas müde, aber herrlich ausgetobt, zufrieden ihren Schlitten an vereister Schnur nach Hause. Bei Muttern war es wohlig warm, und sie hängten die nassen Kleidungsstücke neben den großen Kachelofen zum Trocknen auf. Aus der Ofenröhre kamen Düfte zischen der Bratäpfel. Sie labten sich an dieser heißen süßen Köstlichkeit und gingen dann selig trunken in ihre Betten. Nachts träumte das kleine Mädchen, dass der Schnee noch lange liegen bleiben möge.
Das kleine Mädchen wartet auf das schönste Erlebnis, an das es sich erinnern kann. Und so fragt es voller Ungeduld immer wieder: „Mama, wie lange dauert es noch bis Weihnachten ist?“ – „Jetzt musst du nur noch dreimal schlafen, dann ist Weihnachten“, sagt die verständnisvolle Mutter. Die freudige Spannung wächst von Tag zu Tag in dem fröhlichen Kind. Es spielt hingebungsvoll mit seinen Puppen. In dieses Spiel versunken spricht die Puppenmutter mit ihren Kindern: „Dreimal müsst ihr noch schlafen, dann ist endlich Weihnachten“, sagt sie und legt das Julchen und den Peter ins Puppenbettchen und deckt sie beide fürsorglich zu. Die große Vorfreude steigert sich in dem Kind in einen spannungsvollen Zustand. Es weiß aus der Erinnerung, dass das Weihnachtsfest etwas Wunderbares ist.
Am Heiligenabend steht der duftende grüne Nadelbaum im Wohnzimmer auf einem Tisch. Geschmückt mit gelben Lichtern, blauen und roten Kugeln, silbernen Glöckchen und einem niedlichen Schneemann bestaunt das Kind andächtig den Baum, als käme er aus einem verzauberten Märchenwald. Immer wieder entlockt die Erwartungsvolle dem silbernen Glöckchen einen hellen lieblichen Klang. Auf dem Tisch liegt eine Decke, die die Mutter nur zu Weihnachten auflegt. Sie hat auf den weißen Stoff grüne Tannenzweiglein und gelbe Lichter gestickt. Die Eltern, die Brüder und auch das Nesthäkchen sind festlich gekleidet. Zuerst singt die Familie viele frohe Weihnachtslieder. Zwischendurch schweifen die Augen des aufgeregten Mädchens immer wieder zu dem Gabentisch, auf dem einige Schachteln, Kartons und Beutel liegen. Der Vater versteht die Ungeduld der Kinder besonders gut. Auf allen hübsch verpackten Geschenken steht der Name des Empfängers. Weil das kleine Mädchen noch nicht lesen kann, hat die Mutter auf seine Schachteln ein großes rotes Herz gemalt. Rasch entfernt das Kind mit seinen kleinen Händen die Verpackung. Die Augen werden sehr groß und das Herz vor Freude weit. Ein blechernes Puppen – Kaffeeservice das mit Märchenbildern aus „Schneewittchen und den sieben Zwergen“ bunt bemalt ist, lässt das Herz des Kindes vor Freude glückselig hüpfen. Dann spielt es ganz versunken und deckt den Tisch für seine Puppenkinder mit einer nicht zu übersehenden Hingabe. Einen runden braunen Pfefferkuchen bricht die Puppenmutter in kleine Stöckchen, verteilt sie auf die ‚Märchenteller’ und füttert ihr Julchen und ihren Peter mit dem köstlichen Backwerk und den Worten: „So, jetzt sind wir ganz reich und haben selber Teller, Tassen und eine Kaffeekanne.“ – So einfach ist es, ein kleines Mädchen glücklich zu machen!
Dann kommt das Mädchen in ein Alter, in dem es selber für Mutter und Vater eigene kleine Geschenke bastelt. Die Mutter bekommt ein selbst genähtes Nadelkissen. Und Vater freut sich über ein bunt gestaltetes Lesezeichen. Dies geschieht alles aus einem inneren Bedürfnis heraus. Jahre gehen ins Land. Als Auszubildende bekommt die junge Frau am Heiligenabend von ihrem Chef, dem Zahnarzt, dem sie das ganze Jahr über fleißig assistiert und unzählige Überstunden leistet, einen nicht sehr großen Geldschein geschenkt. Zusammen schlendert sie mit ihrer gleichaltrigen Kollegin nach Praxisschluss in froher Stimmung durch die Einkaufsstraße. Einen dringend benötigten Regenschirm ersteht sie für ihre weiten Fußmärsche zur Arbeitsstelle bei Wind und Regen. Für die Mutter kauft sie ein Paar dünne Damenstrümpfe, die immer gebraucht werden. Die Krönung ersteht sie im Blumenladen. Einen Mimosenstrauß, so zart und so gelb, wickelt die Floristin in weißes Papier. Mit diesen kleinen leuchtenden Sonnen im kalten Winter erwärmt sie das Herz der fürsorglichen Mutter. „Mama, ich möchte dir mit deinen Lieblingsblumen danke sagen, für das oftmals späte Abendbrot, das du mir so liebevoll zubereitest.“
Zaunlos der Garten
meiner Kindheit.
Die vorderen Beete
lieblich umschlungen
von rotgelber Kapuzinerkresse.
Das kleine fröhliche Mädchen
ist achtsam hinübergesprungen.
Kapuzinerkresse wird für mich immer
Kindheit, Sommer und Glück
in sich vereinen.
An meine Großmutter väterlicherseits habe ich immer noch sehr intensive und wertvolle Erinnerungen. Sie war eher eine schlichte, aber herzliche Frau. Rein äußerlich erschien sie streng mit ihrer glatten Frisur mit einem Mittelscheitel und einem gesteckten Nackenknoten. Doch sie war nicht so streng wie meine Mutter zu mir. Ihre Kleider waren von bedeckter Farbe, meistens dunkelblau oder braun mit winzigen weißen Tupfen. Darüber trug sie fast immer ein gehäkeltes wollenes Schultertuch, vorne am Hals mit einer runden Brosche zusammengehalten. Vor allem aber strahlte sie eine wohltuende Ruhe aus. Wenn meine Mutter ihren großen Waschtag hatte, kochte die Oma für uns alle das Mittagessen und hatte für uns Kinder immer ein liebes Wort. Meine beiden älteren Brüder und ich besuchten sie aber auch sehr gerne, obwohl der Weg zu ihr weit war. Dann verwöhnte sie uns mit heißen Würstchen und Schokoladenpudding. Mit viel Geduld brachte sie mir auch das Stricken der rechten Maschen bei: „Einpicken, umschlagen und den Faden durchholen.“ Diese Worte klingen mir noch sanft in meinen Ohren. Nach Kriegsende 1945 waren wir dann leider räumlich weit getrennt. Meiner Großmutter fiel es schwer, ihre Heimat zu verlassen. So blieb sie noch unter polnischer Verwaltung im Osten. Dann wurde sie ausgewiesen. Danach war sie dann 1947 für ein paar Wochen bei uns zu Besuch. Es war Sommer, und wir pflückten gemeinsam echte Kamille, die sie gebündelt zum Trocknen auf den Boden hing. Sie wollte Tee davon bereiten. In diesen Wochen schliefen wir gemeinsam im Kinderzimmer. Ich hörte sie oft abends im Dunkeln, wenn ich noch nicht schlafen konnte, inbrünstig das Vaterunser beten. Wie schade, dass ich sie danach nicht mehr erleben konnte. Sie starb in der Ferne in einem Altersheim auf Nordstrand, wo ich ihr Grab nach langen Jahren wiederfand.
Wie wichtig sie für mich als Kind war, hat sie vielleicht gar nicht gewusst. Großmütter können so wertvoll für ihre Enkelkinder sein! Oftmals können sie so liebevoll ausgleichen. Heute noch möchte ich meine Großmutter so vieles fragen.
Schon am Vorabend des großen Waschtages begann früher für Berta die Arbeit mit der großen Wäsche. Unsere Geschichte spielt nämlich in den 1930er Jahren in einem großen Mietshaus aus der Gründerzeit, welches natürlich ohne Fahrstuhl gebaut war. Ähnlich könnte es sich aber auch noch um 1960 abgespielt haben.
Also, nach einem gewöhnlichen Arbeitstag in Familie und Haushalt sucht Berta alle schmutzige Wäsche zusammen, die sie in einer alten Wäschetruhe gesammelt hat. Sie stopft mit ihren Fäusten und viel Kraft auch noch die letzten getragenen Hemden und Unterhosen‚ auch die benutzten Handtücher aus Küche und Toilette in den riesigen, voll gestopften Weidenkorb. Den schweren Korb trägt sie vom vierten Stock die vielen ausgetretenen ächzenden Holztreppenstufen bis in den dritten Stock hinunter. Da macht sie eine Verschnaufpause und stellt den schweren Waschkorb ab; denn nach dem letzten Waschtag hatte sie einen ziemlichen Muskelkater. Vom dritten Stockwerk bis in den zweiten trägt sie den Korb dann weiter treppab. Da hört sie plötzlich ein Baby schreien. Sie bleibt stehen, lauscht noch einmal, aber das kann ja nur ihre kleine Gertrud sein. Sonst hat niemand in diesem Hause ein so kleines Kind. Berta lässt ihren Waschkorb stehen und läuft eilig, zwei Stufen auf einmal nehmend, bis zum vierten Stock hinauf. Aus der Kitteltasche holt sie den Wohnungsschlüssel, schließt auf, läuft voller Besorgnis in das Wohnzimmer an das Stubenwägelchen. Ihre Hände wischt sie an ihrem Kittel ab, bevor sie ihr Töchterchen auf den Arm nimmt und sich ein Spucktuch über ihre rechte Schulter legt. Sie klopft der Kleinen zart auf den Rücken. Da kommt auch schon das „Bäuerchen“. Außerdem „duftet“ es aber auch noch nach vollen Höschen und Windeln. Sie wickelt die Kleine aus und macht sie sauber. Sie hat sogar noch warmes Wasser auf dem Herd im Kessel. Sie trocknet die Kleine mit einem Handtuch gut ab. Danach cremt und pudert sie den kleinen Po und wickelt ihn neu in frische Tücher. Jetzt legt sie ihre niedliche Gertrud – offenbar zufrieden – wieder in das Stubenwägelchen. Die schmutzigen Windeln spült sie grob in der Toilette aus (sie haben in ihrem Mietshaus sogar schon Spülkloset auf halber Höhe der Treppe). Mit den schmutzigen Tüchern in der Hand geht es dann wieder treppab bis in den zweiten Stock. Den Waschkorb schwingt sie nun eilig unter ihren rechten Arm und läuft bis in den Keller hinunter. Vor der Waschküche stellt sie den Korb ab und schließt die Tür auf. Ihr großes Henko-Paket zum Einweichen hat sie schlauerweise im Kohlenkeller stationiert. Berta schließt den Kohlenkeller auf, sammelt Holzscheite und Tannenzapfen in die alte, aus Weidenzweigen geflochtene Kiepe und legt obendrauf das große Henko-Paket. Das trägt sie alles in die Waschküche, dreht den Wasserhahn auf, lässt Wasser in die große Zinkwannen laufen, reißt das Henko-Paket auf, lässt mit der linken Hand das Einweichpulver in das Wasser rieseln, während sie mit der rechten Hand mit einer großen Holzkelle rührt, damit es keine Klumpen gibt. Jedes Wäschestück nimmt sie auseinander und steckt es dann in die Einweichlauge. Den Waschkessel bestückt sie schon mit Holz, damit es morgen früh gleich losgehen kann. Erleichtert springt sie dann ohne Last alle Treppen bis zum vierten Stock wieder hoch. Berta schließt die Wohnungstüre auf, schaut gleich nach ihrer kleinen Tochter, die ganz zufrieden schläft. „Wie schön“, denkt sie, „da kann ich ja noch in Ruhe ein paar Wickeltücher umstechen“ und legt dazu ihre müden Beine hoch. Doch schon bald fallen ihr vor Müdigkeit die Augen fast zu. Leise geht sie ins Schlafzimmer, zieht sich aus und geht dann wieder auf Zehenspitzen in die Küche, um sich mit kaltem Wasser und Kernseife gründlich zu waschen. Danach rubbelt sie sich sorgfältig mit ihrem Gerstenkornhandtuch trocken. Leise schleicht sie in ihr Bett und stellt den laut tickenden Wecker mit den zwei Glocken oben drauf auf fünf Uhr! Da fällt ihr ein, dass sie ja noch ihre alten Kleidungstücke, die sie immer am großen Waschtag anzieht, auf den Stuhl legen wollte. Sie zieht noch mal an der Lampenschalterschnur am Kopfende ihres Bettes und springt schnell aus dem Bett. Ja, da hat sie schon die verwaschene Bluse, den alten Baumwollrock, das Tuch für den Kopf und die Gummischürze gefunden. Berta schlüpft erneut in ihr Federbett und schläft gleich ein.
Brrrr, klingelt ihr Wecker auf dem kleinen Nachttischchen. Berta reckt sich – sie streckt die Arme und Beine erst einmal richtig von sich, bevor sie aufsteht. Sie geht ans Fenster, reibt sich den Schlaf aus ihren Augen, öffnet das Fenster und schaut in den frühen Morgen. Sie ist optimistisch und hofft auf trockenes Wetter mit möglichst auch etwas Sonnenschein und Wind, damit ihre Wäsche nachher im Hof schnell trocknet und die weißen Stücke auch etwas gebleicht werden können. Nun zieht sie ihre selbstgestrickten Socken an und geht leise auf Zehenspitzen in die Küche, damit sie ihre kleine Gertrud nicht weckt. Ihre Mutter kommt heute nämlich, um die Kleine zu versorgen, denn sie wird voll mit der Wäsche beschäftigt sein. Berta wäscht sich schnell und rubbelt sich mit ihrem Handtuch ab. Flink zieht sie Hemd, Schlüpfer, Bluse und Rock an und bindet sich das Tuch um den Kopf, damit ihr ihre zum Knoten gebundenen Haare beim Arbeiten nicht in das Gesicht fallen können. Mit der Gummischürze über dem Arm und den Überziehschuhen aus Gummi in der Hand geht sie noch schnell an der Speisekammer vorbei, um sich einen Apfel zu holen. Leise schließt sie hinter sich die Korridortüre. Dann erst zieht sie die Gummischuhe an und bindet die Gummischürze um, beißt in den Apfel und läuft flink vom vierten Stock bis in den Keller. Sie schließt die Waschküchentür auf und geht unverzüglich ans Werk. Zuerst wringt sie alle Wäschestücke einzeln aus der Einweichlauge heraus. Dann lässt sie Wasser in den Waschkessel einlaufen und schüttet ein großes Paket Persil hinein. Mit einem Streichholz zündet sie das vorbereitete Holz unter dem Kessel an. Jedes Teil nimmt sie auseinander und steckt es in die Waschlauge. Die trockenen Tannenzapfen und die Holzscheite haben richtig Feuer gefangen und knistern und knallen unter dem sich nur langsam erwärmenden Kessel. Berta legt noch ein paar besonders dicke Holzstücke ins Feuer, damit sie dann erst mal Pause machen kann. Sie freut sich auf das Frühstück mit ihrer Mutter. Freudig steigt sie die Treppen wieder hinauf. Beim Aufschließen der Wohnungstür kommt ihr schon der Duft des Bohnenkaffees entgegen, den es heute am Waschtag statt des üblichen Muckefucks ausnahmsweise gibt. Die Großmutter hat frische Brötchen mitgebracht und hält nun schon die Enkeltochter auf dem Arm und singt ihr ein Lied vor: „Wer will fleißige Waschfrauen sehn ...“ Berta schließt bei diesem entzückenden Anblick gleich beide in die Arme. Sie frühstücken gemütlich und plaudern dabei. Aber leider muss Berta wieder hinunter fünf Treppen abwärts in den Keller laufen. Doch sie nimmt gleich die Wäscheleine und die Klammern in einem Beutel mit, die sie in dem Kämmerchen an der Wand zu hängen hat. Beim Aufschließen der Waschküchentür kommt ihr der Dampf der kochenden Wäsche entgegen. Mit der großen Holzkelle fischt sie die heiße Wäsche aus der kochenden Lauge und wirft sie schnell zum Nachwaschen in eine Zinkwanne mit etwas kaltem Wasser. Sorgfältig prüft sie jedes Teil, ob noch Flecken drin sind. Wenn nötig, rubbelt sie zwischen ihren beiden Händen die noch nicht ganz sauberen Stellen heraus.
Gleich danach spült sie in viel kaltem Wasser, wringt zwischendurch wieder jedes Teil aus, spült erneut und wringt wieder gut aus, bis das Spülwasser klar bleibt. Sie legt alle Wäschestücke in einen aus Weidenzweigen geflochtenen Korb, trägt ihn die kleine Kellertreppe zur Hofseite hinauf, stellt den Korb ab, spannt sogleich die Leine straff von Pfahl zu Pfahl. Berta bückt sich zum vollen Waschkorb hinunter, sie greift zuerst nach den dickeren Handtüchern, schlägt sie tüchtig aus und klammert sie gut an der Leine fest. Danach sind die großen Betttücher und die Taschentücher an der Reihe. Dann folgt die Unterwäsche. Zuletzt hängt sie die vielen Windeln und Wickeltücher, die Babyhemdchen und Jäckchen und Spucktücher auf. Es ist heiß und ein wenig schwül geworden. Gewiss kann sie schon bald die ersten trockenen Tücher abnehmen. Den leeren Korb lässt sie auf dem Hof stehen. Berta ist hungrig. Sie steigt nicht mehr ganz so schwungvoll die vielen Treppenstufen zum vierten Stock hinauf. Sie schließt die Wohnungstür auf, schnuppert gleich den herrlichen, ihr bekannten Duft des Apfelkuchens, den ihre Mutter so vorzüglich zu backen versteht. Schnell holt sie noch ein frisches Tischtuch aus dem Schrank und legt es über den rohen Holztisch. Köstlich schmeckt der frische Kuchen, und sie unterhalten sich angeregt. Dabei merken die beiden Frauen gar nicht, dass es draußen sehr schnell immer dunkler wird. Der erste Donner rollt, da erst werden die beiden jäh aus ihrer Gemütlichkeit herausgerissen. Beide laufen, so schnell sie können, die Treppen hinunter bis in den Hof, reißen die schon trockenen Wäschestücke zuerst von der Leine und werfen sie in den Korb. Das in einem Tempo, dass sie beide außer Atem kommen. Als der plötzliche Wind den Staub des Hofes aufwirbelt und die ersten dicken Regentropfen herunterklatschen, laufen sie beide mit dem vollen Waschkorb in das Haus. Die wieder nass gewordene restliche Wäsche holt Berta dann in einer Wanne herein.
Heute wird das Wetter wohl nicht mehr besser. So muss sie die nasse Wäsche bis auf den Trockenboden schleppen, um sie dort zum Nachtrocknen aufzuhängen. Dann geht‘s wieder eine Treppe abwärts bis in die Wohnung. Ihre Mutter legt schon die Handtücher schön glatt. Zusammen recken sie dann die großen Bett- und Tischtücher und legen sie in den Korb. Erforderlichenfalls sprengen sie noch etwas Wasser auf die zu trocken gewordenen Teile; denn für morgen hat Berta sich schon zur Rolle eingetragen, in der die großen Teile geglättet werden. Die beiden Frauen verbringen noch einen sehr gemütlichen und erholsamen Abend bei Radiomusik. Berta umstickt mit rosa Garn die Wickeltücher für ihr Töchterlein, während die Großmutter emsig an einem Überhandtuch in blauer Kreuzchenstickerei arbeitet.
Am nächsten Tag tragen sie gemeinsam den vollen Korb zur Rolle. Sie rollen jedes Teil einzeln durch. Gegen Mittag tragen sie den Korb mit der glatten Wäsche nach Hause. Gleich räumen sie die frisch gerollte Wäsche in die Schränke, jedes Teil an seinen Platz. Die Bügelwäsche hebt Berta sich für den nächsten Tag auf. Am Nachmittag bringt sie dann noch ihre Mutter zum Bahnhof. Auf dem Wege dorthin sagt ihre Mutter: „Berta, du bist doch eine sehr tüchtige Frau, wie glänzend du mal wieder alles geschafft hast.“ – „Ja, Mutter, ich muss doch meinem Namen Ehre machen; denn Du weißt ja, dass Berta aus dem Althochdeutschen stammt und ‚glänzend’ bedeutet. Sie bedankt sich ganz herzlich bei ihrer Mutter und winkt noch lange mit ihrem ausgebreiteten Taschentuch hinterher, als der Zug sich, in Dampfwolken und Qualm gehüllt, in Fahrt setzt.
Ich erinnere mich noch so genau daran, als wenn ich diese Ereignisse erst vor ein paar Tagen erlebt hätte: 1944 war es im Dezember bitterkalt, und es lag auch Schnee in meiner Heimatstadt Köslin in Hinterpommern. Von dem schrecklichen Zweiten Weltkrieg war ich als kleines sechseinhalb Jahre altes fröhliches Mädchen, das noch nicht wusste, was ein Krieg in seinem vernichtenden Ausmaß bedeutet, bisher vor allem dadurch beeinträchtigt, dass mein Vater nicht mehr bei uns war. Mit der Hilfe meines großen Bruders schrieb ich ihm kleine „Liebeszettel“, die meine schreibfreudige Mutter mit in ihre vielen Briefe legte. Ich hüpfte fröhlich durch die Wohnung, obwohl es immer öfter auch Fliegeralarm gab. Im Herbst 1944 war ich eingeschult worden.
Immer wieder wurde unser Schulunterricht durch den Fliegeralarm gestört und musste für diesen Tag beendet werden. Weil mein Zuhause nicht weit von der Schule entfernt war, lief ich angsterfüllt schnellstens zum Luftschutzkeller, der unter unserem Mietshaus lag. Auch unser Nachtschlaf wurde manchmal durch solchen bedrohlichen Fliegeralarm zerschnitten. Das unverkennbare Geheul der Sirenen werde ich niemals vergessen. Im Luftschutzkeller war es schrecklich kalt. Da saß die gesamte Hausgemeinschaft auf harten Holzstühlen in ihre Wintermäntel gehüllt dicht beieinander, bis endlich die Sirene die ersehnte „Melodie“ der Entwarnung spielte. Erst dann durften wir den eiskalten Keller verlassen. Trunken vor Müdigkeit taumelten wir in unsere inzwischen ausgekühlten Federbetten.
Meine emsige Mutter backte wie jedes Jahr braune Pfefferkuchen für das schönste Fest im Jahr. Und ich durfte mit dem Pinsel Zuckerguss auf die runden Kuchen streichen. Dieser verführerische Duft von süßem Backwerk erfüllte unsere schöne Wohnung. Oftmals saß die Mutter auch an der Nähmaschine, und sie verriet mir nicht, was sie aus den dunkelblauen Stoffresten einer aufgetragenen Trainingshose nähte. So entstanden die Überraschungen für uns Kinder. Sie wollte uns trotz des tobenden Krieges ein möglichst schönes Weihnachtsfest bereiten.
Am Heiligabend stand wie jedes Jahr ein frischer Tannenbaum im Wohnzimmer auf einem kleinen Tisch. Dieser grüne Baum verströmte einen wunderbaren Duft in unserem schönsten und größten Zimmer. Wie eine silberne Krone thronte die glitzernde Spitze auf der höchsten Erhebung des Christbaumes. Bunte Kugeln und Lametta schmückten den Baum aus dem nahen Wald. Ich weiß aber auch, dass ein kleiner silberner Schneemann und ein Glöckchen die schöne Tanne zierten. Das niedliche Glöckchen, das vorne in der Nähe der Türe hing, hatte mich immer wieder dazu verführt, ihm einen lieblichen Klang zu entlocken.
In unserer Familie wurden an solchen hohen Feiertagen offenbar einige Rituale eingehalten. Der Gabentisch wurde stets mit einer großen weißen Tischdecke verhüllt. So waren die Geschenke bis zur Bescherung für unsere Augen unsichtbar. Weil meine Mutter eine Ausbildung in Gesang genossen hatte, war es für uns alle normal, dass wir sehr viele Weihnachtslieder im Laufe der Jahre auswendig singen konnten. Und die wurden auch schön laut gesungen. Wir sangen: „Alle Jahre wieder“, „Der Christbaum ist der schönste Baum“, „Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen“ ‚ „Oh, du fröhliche, o, du selige“, aber auch das Lied von Hans Baumann „Hohe Nacht der klaren Sterne“, welches von der nationalsozialistischen Weltanschauung eingefärbt war. Die Nazis wollten das „jüdische“ Jesuskind totschweigen. Die Mütter jedoch brauchten sie noch, und die wurden sehr in diesem Lied geehrt: „Mütter, euch sind alle Feuer, alle Sterne aufgestellt, Mütter tief in euren Herzen schlägt das Herz der weiten Welt.“ So lautet eine Strophe des Liedes. Frauen, die vier Kinder hatten, wurden mit dem Mutterkreuz ausgezeichnet. Natürlich sollten diese möglichst Söhne gebären, die kaum zum Manne reifen durften, um schon als nicht ausgebildete Soldaten an den Fronten verheizt zu werden. Aber davon verstand das kleine Mädchen noch nichts. Wenn ich mir heute jedoch als Mutter von drei erwachsenen Kindern und zwei Enkelkindern Dokumentarfilme aus Kriegszeiten anschaue, bricht es mir fast das Herz, wenn ich die Knaben sehe, denen man damals noch zum Schluss des schrecklichen Zweiten Weltkriegs einen Stahlhelm über dem weichen Kindergesicht auf den Kopf setzte, die man in Uniformen steckte und ihnen eine Waffe in die zarten Hände drückte.
Wie wunderbar ist es, dass Kinder in ganz jungen Jahren wie unter einer barmherzigen liebevollen Glocke geschützt sind und in Unbeschwertheit und Fröhlichkeit leben und spielen dürfen. Ich denke, nur so können Menschen das spätere Leben bewältigen.
Aber je mehr Lieder wir fröhlich sangen, umso mehr baute sich eine spürbare Spannung in mir auf, die immer stärker und fast unerträglich wurde: Was werde ich wohl vom Christkind bekommen? Endlich hatte unsere Mutter ein Erbarmen mit uns Kindern. Ich war damals das Nesthäkchen unter vier Geschwistern. Unsere Mutter nahm das weiße Tuch vorsichtig von dem Gabentisch und faltete es fein zusammen. Jedem zeigte sie den Platz, an dem seine Geschenke lagen. Mein schönstes Geschenk passte Weihnachten 1944 nicht auf den Gabentisch. In einer anderen Ecke des Weihnachtszimmers lüftete meine Mutter eine Wolldecke, und ein heller wunderschöner Puppenwagen, in dem eine noch schönere Puppe mit dunklen echten Zöpfen lag, kam zum Vorschein. Ich war sehr glücklich darüber. Trotzdem erkannte ich die zarte Wagendecke und den niedlichen dunkelblauen Anzug mit schicker Baskenmütze. Diese begehrenswerten Sachen hatte meine Mutter nämlich vor einigen Wochen selber auf der Nähmaschine angefertigt. Das hatte ich ja beobachtet. Das Puppenmädchen taufte ich noch am Heiligabend auf den Namen Ingrid. Die langen dunklen Zöpfe meines neuen Puppenkindes waren eine gute Beschäftigung für mich. Ich löste die Zöpfe und lernte so das Flechten. Weil wir eine kinderreiche Familie waren, hatten wir auch ein so genanntes Pflichtjahrmädchen zum Arbeiten im Haushalt und für die Kinderbetreuung. Und diesem jungen sehr netten Mädchen gehörte bis kurz vor Weihnachten der Puppenwagen mit der wertvollen Puppe. Meine Mutter hatte per Tausch diese Glückseligkeit für mich erstanden. Abends sang ich meinem neuen Puppenmädchen ein Wiegenlied vor.
Am zweiten Weihnachtstag kam unsere Oma Berta zu uns. Meine Mutter fuhr hochschwanger nach Neustettin, der deutsche Name der seit 1945 polnischen Stadt Szczecinek, um unseren Vater zu besuchen. Neustettin lag von unserer Heimatstadt nur 68 km südöstlich entfernt. Die Rote Armee hatte die Deutschen, die ihr an Menschen und Material zehnfach unterlegen waren, zu dem Zeitpunkt noch nicht weiter gen Westen treiben können. Unsere tapfere Mutter hatte wohl Bedenken, unseren Vater vielleicht nicht mehr wiedersehen zu können. Doch wir Kinder spielten hingebungsvoll mit unseren neuen Geschenken. Mitten im tobenden Krieg waren unsere jungen Kinderseelen zum Glück vor dem Ausmaß der kommenden unausweichlichen Katastrophe durch das Noch-nicht-verstehen-können liebevoll geschützt.
Im Herbst 1944 wurde Anita als Sechsjährige noch in der hinterpommerschen Heimat eingeschult. Vor 1945 war in den größeren Orten die Trennung in Jungen- oder Mädchenschulen noch üblich. Drei Schülerinnen mussten sich ein Lesebuch teilen. Immer öfter gab es jetzt auch in Hinterpommern Fliegeralarm. Da die Schule nicht weit von der Wohnung entfernt war, durfte Anita dann schnell nach Hause laufen und dort in den Luftschutzkeller gehen. Auch nachts gab es Fliegeralarm, und im Keller war es immer sehr kalt.
Anfang März 1945 stieß die sowjetische Rote Armee von Süden her in Richtung Ostseeküste vor und stand mit ihren Panzern vor den Toren der Heimatstadt Anitas. Die Sirenen heulten Panzeralarm, und einer der Brüder sagte in Panik zur Mutter: „Mama, die Russen kommen!“ Vater Franz befand sich schon längere Zeit als Soldat an der Front. Mitte Februar – gut drei Wochen vorher – hatte Mutter Emma ihr fünftes Kind geboren, lag also noch im Wochenbett – damals standen Mütter nicht gleich nach der Entbindung auf. Als sie Anfang März ihren Arzt aufsuchte, hörte sie von ihm: „Sehen Sie zu, dass Sie unverzüglich mit ihren Kindern die Stadt verlassen, es geht noch ein Zug raus“. Die dramatische Flucht war ein kindliches Trauma für das sechsjährige Mädchen. Aus Anitas Feder lesen wir darüber: