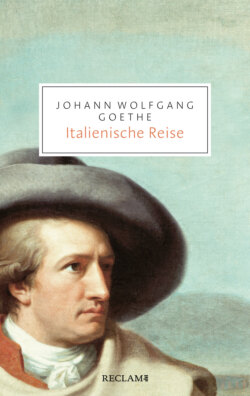Читать книгу Italienische Reise - Johann Wolfgang Goethe - Страница 10
Ferrara bis Rom
ОглавлениеDen 16. Oktober, früh, auf dem Schiffe.
Meine Reisegesellschaft, Männer und Frauen, ganz leidliche und natürliche Menschen, liegen noch alle schlafend in der Kajüte. Ich aber, in meinen Mantel gehüllt, blieb auf dem Verdeck die beiden Nächte. Nur gegen Morgen ward es kühl. Ich bin nun in den fünfundvierzigsten Grad wirklich eingetreten und wiederhole mein altes Lied: dem Landesbewohner wollt ich alles lassen, wenn ich nur wie Dido so viel Klima mit Riemen umspannen könnte, um unsere Wohnungen damit einzufassen. Es ist denn doch ein ander Sein. Die Fahrt bei herrlichem Wetter war sehr angenehm, die Aus- und Ansichten einfach, aber anmutig. Der Po, ein freundlicher Fluss, zieht hier durch große Plainen, man sieht nur seine bebuschten und bewaldeten Ufer, keine Fernen. Hier wie an der Etsch sah ich alberne Wasserbaue, die kindisch und schädlich sind wie die an der Saale.
Ferrara, den 16. nachts.
Heute früh sieben Uhr deutschen Zeigers hier angelangt, bereite ich mich, morgen wieder wegzugehen. Zum erstenmal überfällt mich eine Art von Unlust in dieser großen und schönen, flachgelegenen, entvölkerten Stadt. Dieselben Straßen belebte sonst ein glänzender Hof, hier wohnte Ariost unzufrieden, Tasso unglücklich, und wir glauben uns zu erbauen, wenn wir diese Stätte besuchen. Ariosts Grabmal enthält viel Marmor, schlecht ausgeteilt. Statt Tassos Gefängnis zeigen sie einen Holzstall oder Kohlengewölbe, wo er gewiss nicht aufbewahrt worden ist. Auch weiß im Hause kaum jemand mehr, was man will. Endlich besinnen sie sich um des Trinkgeldes willen. Es kommt mir vor, wie Doktor Luthers Tintenklecks, den der Kastellan von Zeit zu Zeit wieder auffrischt. Die meisten Reisenden haben doch etwas Handwerkspurschenartiges und sehen sich gern nach solchen Wahrzeichen um. Ich war ganz mürrisch geworden, so dass ich an einem schönen akademischen Institut, welches ein aus Ferrara gebürtiger Kardinal gestiftet und bereichert, wenig teilnahm, doch erquickten mich einige alte Denkmale im Hofe.
Sodann erheiterte mich der gute Einfall eines Malers. Johannes der Täufer vor Herodes und Herodias. Der Prophet in seinem gewöhnlichen Wüstenkostüme deutet heftig auf die Dame. Sie sieht ganz gelassen den neben ihr sitzenden Fürsten, und der Fürst still und klug den Enthusiasten an. Vor dem Könige steht ein Hund, weiß, mittelgroß, unter dem Rock der Herodias hingegen kommt ein kleiner Bologneser hervor, welche beide den Propheten anbellen. Mich dünkt, das ist recht glücklich gedacht.
Cento, den 17. abends.
In einer bessern Stimmung als gestern schreibe ich aus Guercins Vaterstadt. Es ist aber auch ein ganz anderer Zustand. Ein freundliches, wohlgebautes Städtchen von ungefähr fünftausend Einwohnern, nahrhaft, lebendig, reinlich, in einer unübersehlich bebauten Plaine. Ich bestieg nach meiner Gewohnheit sogleich den Turm. Ein Meer von Pappelspitzen, zwischen denen man in der Nähe kleine Bauerhöfchen erblickt, jedes mit seinem eignen Feld umgeben. Köstlicher Boden, ein mildes Klima. Es war ein Herbstabend, wie wir unserm Sommer selten einen verdanken. Der Himmel, den ganzen Tag bedeckt, heiterte sich auf, die Wolken warfen sich nord- und südwärts an die Gebirge, und ich hoffe einen schönen morgenden Tag.
Hier sah ich die Apenninen, denen ich mich nähere, zum erstenmal. Der Winter dauert hier nur Dezember und Januar, ein regniger April, übrigens nach Beschaffenheit der Jahreszeit gut Wetter. Nie anhaltender Regen; doch war dieser September besser und wärmer als ihr August. Die Apenninen begrüßte ich freundlich im Süden, denn ich habe der Flächen bald genug. Morgen schreibe ich dort an ihrem Fuße.
Guercino liebte seine Vaterstadt, wie überhaupt die Italiener diesen Lokalpatriotismus im höchsten Sinne hegen und pflegen, aus welchem schönen Gefühl so viel köstliche Anstalten, ja die Menge Ortsheilige entsprungen sind. Unter jenes Meisters Leitung entstand nun hier eine Malerakademie. Er hinterließ mehrere Bilder, an denen sich noch der Bürger freut, die es aber auch wert sind.
Guercin ist ein heiliger Name, und im Munde der Kinder wie der Alten.
Sehr lieb war mir das Bild, den auferstandenen Christus vorstellend, der seiner Mutter erscheint. Vor ihm knieend, blickt sie auf ihn mit unbeschreiblicher Innigkeit. Ihre Linke berührt seinen Leib gleich unter der unseligen Wunde, die das ganze Bild verdirbt. Er hat seine linke Hand um ihren Hals gelegt und biegt sich, um sie bequemer anzusehen, ein wenig mit dem Körper zurück. Dieses gibt der Figur etwas, ich will nicht sagen Gezwungenes, aber doch Fremdes. Dessenungeachtet bleibt sie unendlich angenehm. Der stilltraurige Blick, mit dem er sie ansieht, ist einzig, als wenn ihm die Erinnerung seiner und ihrer Leiden, durch die Auferstehung nicht gleich geheilt, vor der edlen Seele schwebte.
Strange hat das Bild gestochen; ich wünschte, dass meine Freunde wenigstens diese Kopie sähen.
Darauf gewann eine Madonna meine Neigung. Das Kind verlangt nach der Brust, sie zaudert schamhaft, den Busen zu entblößen. Natürlich, edel, köstlich und schön.
Ferner eine Maria, die dem vor ihr stehenden und nach den Zuschauern gerichteten Kinde den Arm führt, dass es mit aufgehobenen Fingern den Segen austeile. Ein im Sinn der katholischen Mythologie sehr glücklicher und oft wiederholter Gedanke.
Guercin ist ein innerlich braver, männlich gesunder Maler, ohne Rohheit. Vielmehr haben seine Sachen eine zarte moralische Grazie, eine ruhige Freiheit und Großheit, dabei etwas Eignes, dass man seine Werke, wenn man einmal das Auge darauf gebildet hat, nicht verkennen wird. Die Leichtigkeit, Reinlichkeit und Vollendung seines Pinsels setzt in Erstaunen. Er bedient sich besonders schöner, ins Braunrote gebrochener Farben zu seinen Gewändern. Diese harmonieren gar gut mit dem Blauen, das er auch gerne anbringt.
Die Gegenstände der übrigen Bilder sind mehr oder weniger unglücklich. Der gute Künstler hat sich gemartert und doch Erfindung und Pinsel, Geist und Hand verschwendet und verloren. Mir ist aber sehr lieb und wert, dass ich auch diesen schönen Kunstkreis gesehen habe, obgleich ein solches Vorüberrennen wenig Genuss und Belehrung gewährt.
Bologna, den 18. Oktober, nachts.
Heute früh, vor Tage, fuhr ich von Cento weg und gelangte bald genug hieher. Ein flinker und wohlunterrichteter Lohnbediente, sobald er vernahm, dass ich nicht lange zu verweilen gedächte, jagte mich durch alle Straßen, durch so viel Paläste und Kirchen, dass ich kaum in meinem Volkmann anzeichnen konnte, wo ich gewesen war, und wer weiß, ob ich mich künftig bei diesen Merkzeichen aller der Sachen erinnere. Nun gedenke ich aber ein paar lichter Punkte, an denen ich wahrhafte Beruhigung gefühlt.
Zuerst also die Cäcilia von Raffael! Es ist, was ich zum Voraus wusste, nun aber mit Augen sah: er hat eben immer gemacht, was andere zu machen wünschten, und ich möchte jetzt nichts darüber sagen, als dass es von ihm ist. Fünf Heilige nebeneinander, die uns alle nichts angehen, deren Existenz aber so vollkommen dasteht, dass man dem Bilde eine Dauer für die Ewigkeit wünscht, wenn man gleich zufrieden ist, selbst aufgelöst zu werden. Um ihn aber recht zu erkennen, ihn recht zu schätzen und ihn wieder auch nicht ganz als einen Gott zu preisen, der wie Melchisedek ohne Vater und ohne Mutter erschienen wäre, muss man seine Vorgänger, seine Meister ansehen. Diese haben auf dem festen Boden der Wahrheit Grund gefasst, sie haben die breiten Fundamente emsig, ja ängstlich gelegt und miteinander wetteifernd die Pyramide stufenweis in die Höhe gebaut, bis er zuletzt, von allen diesen Vorteilen unterstützt, von dem himmlischen Genius erleuchtet, den letzten Stein des Gipfels aufsetzte, über und neben dem kein anderer stehen kann.
Das historische Interesse wird besonders rege, wenn man die Werke der ältern Meister betrachtet. Francesco Francia ist ein gar respektabler Künstler, Peter von Perugia ein so braver Mann, dass man sagen möchte, eine ehrliche deutsche Haut. Hätte doch das Glück Albrecht Dürern tiefer nach Italien geführt! In München habe ich ein paar Stücke von ihm gesehen von unglaublicher Großheit. Der arme Mann, wie er sich in Venedig verrechnet und mit den Pfaffen einen Akkord macht, bei dem er Wochen und Monate verliert! Wie er auf seiner niederländischen Reise gegen seine herrlichen Kunstwerke, womit er sein Glück zu machen hoffte, Papageien eintauscht und, um das Trinkgeld zu sparen, die Domestiken porträtiert, die ihm einen Teller Früchte bringen! Mir ist so ein armer Narr von Künstler unendlich rührend, weil es im Grunde auch mein Schicksal ist, nur dass ich mir ein klein wenig besser zu helfen weiß.
Gegen Abend rettete ich mich endlich aus dieser alten, ehrwürdigen, gelehrten Stadt, aus der Volksmenge, die in den gewölbten Lauben, welche man fast durch alle Straßen verbreitet sieht, geschützt vor Sonne und Witterung, hin und her wandeln, gaffen, kaufen und ihre Geschäfte treiben kann. Ich bestieg den Turm und ergötzte mich an der freien Luft. Die Aussicht ist herrlich! Im Norden sieht man die paduanischen Berge, sodann die Schweizer, Tiroler, Friauler Alpen, genug, die ganze nördliche Kette, diesmal im Nebel. Gegen Westen ein unbegrenzter Horizont, aus dem nur die Türme von Modena herausragen. Gegen Osten eine gleiche Ebene, bis ans adriatische Meer, welches man bei Sonnenaufgang gewahr wird. Gegen Süden die Vorhügel der Apenninen, bis an ihre Gipfel bepflanzt, bewachsen, mit Kirchen, Palästen, Gartenhäusern besetzt, wie die vicentinischen Hügel. Es war ein ganz reiner Himmel, kein Wölkchen, nur am Horizont eine Art Höherauch. Der Türmer versicherte, dass nunmehro seit sechs Jahren dieser Nebel nicht aus der Ferne komme. Sonst habe er durch das Sehrohr die Berge von Vicenza mit ihren Häusern und Kapellen gar wohl entdecken können, jetzt bei den hellsten Tagen nur selten. Und dieser Nebel lege sich denn vorzüglich an die nördliche Kette und mache unser liebes Vaterland zum wahren Cimmerien. Der Mann ließ mich auch die gesunde Lage und Luft der Stadt daran bemerken, dass ihre Dächer wie neu aussähen und kein Ziegel durch Feuchtigkeit und Moos angegriffen sei. Man muss gestehen, die Dächer sind alle rein und schön, aber die Güte der Ziegeln mag auch etwas dazu beitragen, wenigstens in alten Zeiten hat man solche in diesen Gegenden kostbar gebrannt.
Der hängende Turm ist ein abscheulicher Anblick, und doch höchst wahrscheinlich, dass er mit Fleiß so gebaut worden. Ich erkläre mir diese Torheit folgendermaßen. In den Zeiten der städtischen Unruhen ward jedes große Gebäude zur Festung, aus der jede mächtige Familie einen Turm erhob. Nach und nach wurde dies zu einer Lust- und Ehrensache, jeder wollte auch mit einem Turm prangen, und als zuletzt die graden Türme gar zu alltäglich waren, so baute man einen schiefen. Auch haben Architekt und Besitzer ihren Zweck erreicht, man sieht an den vielen graden schlanken Türmen hin und sucht den krummen. Ich war nachher oben auf demselben. Die Backsteinschichten liegen horizontal. Mit gutem, bindendem Kitt und eisernen Ankern kann man schon tolles Zeug machen.
Bologna, den 19. Oktober, abends.
Meinen Tag habe ich bestmöglichst angewendet, um zu sehen und wiederzusehen, aber es geht mit der Kunst wie mit dem Leben: je weiter man hineinkommt, je breiter wird sie. An diesem Himmel treten wieder neue Gestirne hervor, die ich nicht berechnen kann und die mich irremachen: die Carracci, Guido, Dominichin, in einer spätern glücklichern Kunstzeit entsprungen; sie aber wahrhaft zu genießen, gehört Wissen und Urteil, welches mir abgeht und nur nach und nach erworben werden kann. Ein großes Hindernis der reinen Betrachtung und der unmittelbaren Einsicht sind die meist unsinnigen Gegenstände der Bilder, über die man toll wird, indem man sie verehren und lieben möchte.
Es ist, als da sich die Kinder Gottes mit den Töchtern der Menschen vermählten, daraus entstanden mancherlei Ungeheuer. Indem der himmlische Sinn des Guido, sein Pinsel, der nur das Vollkommenste, was geschaut werden kann, hätte malen sollen, dich anzieht, so möchtest du gleich die Augen von den abscheulich dummen, mit keinen Scheltworten der Welt genug zu erniedrigenden Gegenständen wegkehren, und so geht es durchaus; man ist immer auf der Anatomie, dem Rabensteine, dem Schindanger, immer Leiden des Helden, niemals Handlung, nie ein gegenwärtig Interesse, immer etwas phantastisch von außen Erwartetes. Entweder Missetäter oder Verzuckte, Verbrecher oder Narren, wo denn der Maler, um sich zu retten, einen nackten Kerl, eine hübsche Zuschauerin herbeischleppt, allenfalls seine geistlichen Helden als Gliedermänner traktiert und ihnen recht schöne Faltenmäntel überwirft. Da ist nichts, was einen menschlichen Begriff gäbe! Unter zehn Sujets nicht eins, das man hätte malen sollen, und das eine hat der Künstler nicht von der rechten Seite nehmen dürfen.
Das große Bild von Guido in der Kirche der Mendicanti ist alles, was man malen, aber auch alles, was man Unsinniges bestellen und dem Künstler zumuten kann. Es ist ein Votivbild. Ich glaube, der ganze Senat hat es gelobt und auch erfunden. Die beiden Engel, die wert wären, eine Psyche in ihrem Unglück zu trösten, müssen hier –
Der heilige Proclus, eine schöne Figur; aber dann die andern, Bischöfe und Pfaffen! Unten sind himmlische Kinder, die mit Attributen spielen. Der Maler, dem das Messer an der Kehle saß, suchte sich zu helfen, wie er konnte, er mühte sich ab, nur um zu zeigen, dass nicht er der Barbar sei. Zwei nackte Figuren von Guido: ein Johannes in der Wüste, ein Sebastian, wie köstlich gemalt, und was sagen sie? der eine sperrt das Maul auf, und der andere krümmt sich.
Betrachte ich in diesem Unmut die Geschichte, so möchte ich sagen: der Glaube hat die Künste wieder hervorgehoben, der Aberglaube hingegen ist Herr über sie geworden und hat sie abermals zugrunde gerichtet.
Nach Tische etwas milder und weniger anmaßlich gestimmt als heute früh, bemerkte ich Folgendes in meine Schreibtafel: Im Palast Tanari ist ein berühmtes Bild von Guido, die säugende Maria vorstellend, über Lebensgröße, der Kopf, als wenn ihn ein Gott gemalt hätte; unbeschreiblich ist der Ausdruck, mit welchem sie auf den säugenden Knaben heruntersieht. Mir scheint es eine stille, tiefe Duldung, nicht als wenn sie ein Kind der Liebe und Freude, sondern ein untergeschobenes himmlisches Wechselkind nur so an sich zehren ließe, weil es nun einmal nicht anders ist, und sie in tiefster Demut gar nicht begreift, wie sie dazu kommt. Der übrige Raum ist durch ein ungeheures Gewand ausgefüllt, welches die Kenner höchlich preisen; ich wusste nicht recht, was ich daraus machen sollte. Auch sind die Farben dunkler geworden; das Zimmer und der Tag waren nicht die hellsten.
Unerachtet der Verwirrung, in der ich mich befinde, fühle ich doch schon, dass Übung, Bekanntschaft und Neigung mir schon in diesen Irrgärten zu Hülfe kommen. So sprach mich eine Beschneidung von Guercin mächtig an, weil ich den Mann schon kenne und liebe. Ich verzieh den unleidlichen Gegenstand und freute mich an der Ausführung. – Gemalt, was man sich denken kann, alles daran respektabel und vollendet, als wenn’s Emaille wäre.
Und so geht mir’s denn wie Bileam, dem konfusen Propheten, welcher segnete, da er zu fluchen gedachte, und dies würde noch öfter der Fall sein, wenn ich länger verweilte.
Trifft man denn gar wieder einmal auf eine Arbeit von Raffael, oder die ihm wenigstens mit einiger Wahrscheinlichkeit zugeschrieben wird, so ist man gleich vollkommen geheilt und froh. So habe ich eine heilige Agathe gefunden, ein kostbares, obgleich nicht ganz wohl erhaltenes Bild. Der Künstler hat ihr eine gesunde, sichere Jungfräulichkeit gegeben, doch ohne Kälte und Rohheit. Ich habe mir die Gestalt wohl gemerkt und werde ihr im Geist meine »Iphigenie« vorlesen und meine Heldin nichts sagen lassen, was diese Heilige nicht aussprechen möchte.
Da ich nun wieder einmal dieser süßen Bürde gedenke, die ich auf meiner Wanderung mit mir führe, so kann ich nicht verschweigen, dass zu den großen Kunst- und Naturgegenständen, durch die ich mich durcharbeiten muss, noch eine wundersame Folge von poetischen Gestalten hindurchzieht, die mich beunruhigen. Von Cento herüber wollte ich meine Arbeit an »Iphigenia« fortsetzen, aber was geschah? Der Geist führte mir das Argument der »Iphigenia von Delphi« vor die Seele, und ich musste es ausbilden. So kurz als möglich sei es hier verzeichnet:
Elektra, in gewisser Hoffnung, dass Orest das Bild der Taurischen Diana nach Delphi bringen werde, erscheint in dem Tempel des Apoll und widmet die grausame Axt, die so viel Unheil in Pelops’ Hause angerichtet, als schließliches Sühnopfer dem Gotte. Zu ihr tritt, leider, einer der Griechen und erzählt, wie er Orest und Pylades nach Tauris begleitet, die beiden Freunde zum Tode führen sehen und sich glücklich gerettet. Die leidenschaftliche Elektra kennt sich selbst nicht und weiß nicht, ob sie gegen Götter oder Menschen ihre Wut richten soll.
Indessen sind Iphigenie, Orest und Pylades gleichfalls zu Delphi angekommen. Iphigeniens heilige Ruhe kontrastiert gar merkwürdig mit Elektrens irdischer Leidenschaft, als die beiden Gestalten wechselseitig unerkannt zusammentreffen. Der entflohene Grieche erblickt Iphigenien, erkennt die Priesterin, welche die Freunde geopfert, und entdeckt es Elektren. Diese ist im Begriff, mit demselbigen Beil, welches sie dem Altar wieder entreißt, Iphigenien zu ermorden, als eine glückliche Wendung dieses letzte schreckliche Übel von den Geschwistern abwendet. Wenn diese Szene gelingt, so ist nicht leicht etwas Größeres und Rührenderes auf dem Theater gesehen worden. Wo soll man aber Hände und Zeit hernehmen, wenn auch der Geist willig wäre!
Indem ich mich nun in dem Drang einer solchen Überfüllung des Guten und Wünschenswerten geängstigt fühle, so muss ich meine Freunde an einen Traum erinnern, der mir, es wird eben ein Jahr sein, bedeutend genug schien. Es träumte mir nämlich, ich landete mit einem ziemlich großen Kahn an einer fruchtbaren, reich bewachsenen Insel, von der mir bewusst war, dass daselbst die schönsten Fasanen zu haben seien. Auch handelte ich sogleich mit den Einwohnern um solches Gefieder, welches sie auch sogleich häufig, getötet, herbeibrachten. Es waren wohl Fasanen, wie aber der Traum alles umzubilden pflegt, so erblickte man lange, farbig beaugte Schweife, wie von Pfauen oder seltenen Paradiesvögeln. Diese brachte man mir schockweise ins Schiff, legte sie mit den Köpfen nach innen, so zierlich gehäuft, dass die langen, bunten Federschweife, nach außen hängend, im Sonnenglanz den herrlichsten Schober bildeten, den man sich denken kann, und zwar so reich, dass für den Steuernden und die Rudernden kaum hinten und vorn geringe Räume verblieben. So durchschnitten wir die ruhige Flut, und ich nannte mir indessen schon die Freunde, denen ich von diesen bunten Schätzen mitteilen wollte. Zuletzt in einem großen Hafen landend, verlor ich mich zwischen ungeheuer bemasteten Schiffen, wo ich von Verdeck auf Verdeck stieg, um meinem kleinen Kahn einen sichern Landungsplatz zu suchen.
An solchen Wahnbildern ergötzen wir uns, die, weil sie aus uns selbst entspringen, wohl Analogie mit unserm übrigen Leben und Schicksalen haben müssen.
Nun war ich auch in der berühmten wissenschaftlichen Anstalt, das Institut oder die Studien genannt. Das große Gebäude, besonders der innere Hof, sieht ernsthaft genug aus, obgleich nicht von der besten Baukunst. Auf den Treppen und Korridors fehlt es nicht an Stukko- und Freskozierden; alles ist anständig und würdig, und über die mannigfaltigen schönen und wissenswerten Dinge, die hier zusammengebracht worden, erstaunt man billig, doch will es einem Deutschen dabei nicht wohl zumute werden, der eine freiere Studienweise gewohnt ist.
Mir fiel eine frühere Bemerkung hier wieder in die Gedanken, dass sich der Mensch im Gange der alles verändernden Zeit so schwer losmacht von dem, was eine Sache zuerst gewesen, wenn ihre Bestimmung in der Folge sich auch verändert. Die christlichen Kirchen halten noch immer an der Basilikenform, wenngleich die Tempelgestalt vielleicht dem Kultus vorteilhafter wäre. Wissenschaftliche Anstalten haben noch das klösterliche Ansehn, weil in solchen frommen Bezirken die Studien zuerst Raum und Ruhe gewannen. Die Gerichtssäle der Italiener sind so weit und hoch, als das Vermögen einer Gemeinde zureicht, man glaubt, auf dem Marktplatze unter freiem Himmel zu sein, wo sonst Recht gesprochen wurde. Und bauen wir nicht noch immer die größten Theater mit allem Zubehör unter ein Dach, als wenn es die erste Messbude wäre, die man auf kurze Zeit von Brettern zusammenschlug? Durch den ungeheuern Zudrang der Wissbegierigen um die Zeit der Reformation wurden die Schüler in Bürgerhäuser getrieben, aber wie lange hat es nicht gedauert, bis wir unsere Waisenhäuser auftaten und den armen Kindern diese so notwendige Welterziehung verschafften!
Bologna, den 20. abends.
Diesen heitern schönen Tag habe ich ganz unter freiem Himmel zugebracht. Kaum nahe ich mich den Bergen, so werde ich schon wieder vom Gestein angezogen. Ich komme mir vor wie Antäus, der sich immer neu gestärkt fühlt, je kräftiger man ihn mit seiner Mutter Erde in Berührung bringt.
Ich ritt nach Paderno, wo der sogenannte Bologneser Schwerspat gefunden wird, woraus man die kleinen Kuchen bereitet, welche kalziniert im Dunkeln leuchten, wenn sie vorher dem Lichte ausgesetzt gewesen, und die man hier kurz und gut Fosfori nennt.
Auf dem Wege fand ich schon ganze Felsen Fraueneis zu Tage anstehend, nachdem ich ein sandiges Tongebirg hinter mir gelassen hatte. Bei einer Ziegelhütte geht ein Wasserriss hinunter, in welchen sich viele kleinere ergießen. Man glaubt zuerst, einen aufgeschwemmten Lehmhügel zu sehen, der vom Regen ausgewaschen wäre, doch konnte ich bei näherer Betrachtung von seiner Natur so viel entdecken: das feste Gestein, woraus dieser Teil des Gebirges besteht, ist ein sehr feinblättriger Schieferton, welcher mit Gips abwechselt. Das schiefrige Gestein ist so innig mit Schwefelkies gemischt, dass es, von Luft und Feuchtigkeit berührt, sich ganz und gar verändert. Es schwillt auf, die Lagen verlieren sich, es entsteht eine Art Letten, muschlig, zerbröckelt, auf den Flächen glänzend wie Steinkohlen. Nur an großen Stücken, deren ich mehrere zerschlug und beide Gestalten deutlich wahrnahm, konnte man sich von dem Übergange, von der Umbildung überzeugen. Zugleich sieht man die muschligen Flächen mit weißen Punkten beschlagen, manchmal sind gelbe Partieen drin; so zerfällt nach und nach die ganze Oberfläche, und der Hügel sieht wie ein verwitterter Schwefelkies im Großen aus. Es finden sich unter den Lagen auch härtere, grüne und rote. Schwefelkies hab ich in dem Gestein auch öfters angeflogen gefunden.
Nun stieg ich in den Schluchten des bröcklig aufgelösten Gebirgs hinauf, wie sie von den letzten Regengüssen durchwaschen waren, und fand zu meiner Freude den gesuchten Schwerspat häufig, meist in unvollkommener Eiform, an mehreren Stellen des eben zerfallenden Gebirgs hervorschauen, teils ziemlich rein, teils noch von dem Ton, in welchem er stak, genau umgeben. Dass es keine Geschiebe seien, davon kann man sich beim ersten Anblick überzeugen. Ob sie gleichzeitig mit der Schiefertonlage, oder ob sie erst bei Aufblähung oder Zersetzung derselben entstanden, verdient eine nähere Untersuchung. Die von mir aufgefundenen Stücke nähern sich, größer oder kleiner, einer unvollkommenen Eigestalt, die kleinsten gehen auch wohl in eine undeutliche Kristallform über. Das schwerste Stück, welches ich gefunden, wiegt siebzehn Lot. Auch fand ich in demselbigen Ton lose, vollkommene Gipskristalle. Nähere Bestimmung werden Kenner an den Stücken, die ich mitbringe, zu entwickeln wissen. Und ich wäre nun also schon wieder mit Steinen belastet! Ein Achtelszentner dieses Schwerspats habe ich aufgepackt.
Den 20. Oktober in der Nacht.
Wieviel hätte ich noch zu sagen, wenn ich alles gestehen wollte, was mir an diesem schönen Tage durch den Kopf ging. Aber mein Verlangen ist stärker als meine Gedanken. Ich fühle mich unwiderstehlich vorwärts gezogen, nur mit Mühe sammle ich mich an dem Gegenwärtigen. Und es scheint, der Himmel erhört mich. Es meldet sich ein Vetturin gerade nach Rom, und so werde ich übermorgen unaufhaltsam dorthin abgehen. Da muss ich denn wohl heute und morgen nach meinen Sachen sehn, manches besorgen und wegarbeiten.
Logano auf den Apenninen, den 21. Oktober, abends.
Ob ich mich heute selbst aus Bologna getrieben, oder ob ich daraus gejagt worden, wüsste ich nicht zu sagen. Genug, ich ergriff mit Leidenschaft einen schnellern Anlass, abzureisen. Nun bin ich hier in einem elenden Wirtshause in Gesellschaft eines päpstlichen Offiziers, der nach Perugia, seiner Vaterstadt, geht. Als ich mich zu ihm in den zweirädrigen Wagen setzte, machte ich ihm, um etwas zu reden, das Kompliment, dass ich als ein Deutscher, der gewohnt sei, mit Soldaten umzugehen, sehr angenehm finde, nun mit einem päpstlichen Offizier in Gesellschaft zu reisen. – »Nehmt mir nicht übel«, versetzte er darauf, »Ihr könnt wohl eine Neigung zum Soldatenstande haben, denn ich höre, in Deutschland ist alles Militär; aber was mich betrifft, obgleich unser Dienst sehr lässlich ist, und ich in Bologna, wo ich in Garnison stehe, meiner Bequemlichkeit vollkommen pflegen kann, so wollte ich doch, dass ich diese Jacke los wäre und das Gütchen meines Vaters verwaltete. Ich bin aber der jüngere Sohn, und so muss ich mir’s gefallen lassen.«
Den 22. abends.
Giredo, auch ein kleines Nest auf den Apenninen, wo ich mich recht glücklich fühle, meinen Wünschen entgegenreisend. Heute gesellten sich reitend ein Herr und eine Dame zu uns, ein Engländer mit einer sogenannten Schwester. Ihre Pferde sind schön, sie reisen aber ohne Bedienung, und der Herr macht, wie es scheint, zugleich den Reitknecht und den Kammerdiener. Sie finden überall zu klagen, man glaubt, einige Blätter im Archenholtz zu lesen.
Die Apenninen sind mir ein merkwürdiges Stück Welt. Auf die große Fläche der Regionen des Pos folgt ein Gebirg, das sich aus der Tiefe erhebt, um zwischen zwei Meeren südwärts das feste Land zu endigen. Wäre die Gebirgsart nicht zu steil, zu hoch über der Meeresfläche, nicht so sonderbar verschlungen, dass Ebbe und Flut vor alten Zeiten mehr und länger hätten hereinwirken, größere Flächen bilden und überspülen können, so wäre es eins der schönsten Länder in dem herrlichsten Klima, etwas höher als das andere Land. So aber ist’s ein seltsam Gewebe von Bergrücken gegeneinander; oft sieht man gar nicht ab, wohin das Wasser seinen Ablauf nehmen will. Wären die Täler besser ausgefüllt, die Flächen mehr glatt und überspült, so könnte man das Land mit Böhmen vergleichen, nur dass die Berge auf alle Weise einen andern Charakter haben. Doch muss man sich keine Bergwüste, sondern ein meist bebautes, obgleich gebirgiges Land vorstellen. Kastanien kommen hier sehr schön, der Weizen ist trefflich und die Saat schon hübsch grün. Immergrüne Eichen mit kleinen Blättern stehen am Wege, um die Kirchen und Kapellen aber schlanke Zypressen.
Gestern Abend war das Wetter trübe, heute ist’s wieder hell und schön.
Den 25. abends. Perugia.
Zwei Abende habe ich nicht geschrieben. Die Herbergen waren so schlecht, dass an kein Auslegen eines Blattes zu denken war. Auch fängt es mir an, ein bisschen verworren zu werden; denn seit der Abreise von Venedig spinnt sich der Reiserocken nicht so schön und glatt mehr ab.
Den Dreiundzwanzigsten früh, unserer Uhr um zehne, kamen wir aus den Apenninen hervor und sahen Florenz liegen in einem weiten Tal, das unglaublich bebaut und ins Unendliche mit Villen und Häusern besät ist.
Die Stadt hatte ich eiligst durchlaufen, den Dom, das Baptisterium. Hier tut sich wieder eine ganz neue, mir unbekannte Welt auf, an der ich nicht verweilen will. Der Garten Boboli liegt köstlich. Ich eilte so schnell heraus als hinein.
Der Stadt sieht man den Volksreichtum an, der sie erbaut hat; man erkennt, dass sie sich einer Folge von glücklichen Regierungen erfreute. Überhaupt fällt es auf, was in Toskana gleich die öffentlichen Werke, Wege, Brücken für ein schönes grandioses Ansehen haben. Es ist hier alles zugleich tüchtig und reinlich, Gebrauch und Nutzen mit Anmut sind beabsichtigt, überall lässt sich eine belebende Sorgfalt bemerken. Der Staat des Papstes hingegen scheint sich nur zu erhalten, weil ihn die Erde nicht verschlingen will.
Wenn ich neulich von den Apenninen sagte, was sie sein könnten, das ist nun Toskana: weil es so viel tiefer lag, so hat das alte Meer recht seine Schuldigkeit getan und tiefen Lehmboden aufgehäuft. Er ist hellgelb und leicht zu verarbeiten. Sie pflügen tief, aber noch recht auf die ursprüngliche Art: ihr Pflug hat keine Räder, und die Pflugschar ist nicht beweglich. So schleppt sie der Bauer, hinter seinen Ochsen gebückt, einher und wühlt die Erde auf. Es wird bis fünfmal gepflügt, wenigen und nur sehr leichten Dünger streuen sie mit den Händen. Endlich säen sie den Weizen, dann häufen sie schmale Sotteln auf, dazwischen entstehen tiefe Furchen, alles so gerichtet, dass das Regenwasser ablaufen muss. Die Frucht wächst nun auf den Sotteln in die Höhe, in den Furchen gehen sie hin und her, wenn sie jäten. Diese Verfahrungsart ist begreiflich, wo Nässe zu fürchten ist; warum sie es aber auf den schönsten Gebreiten tun, kann ich nicht einsehen. Diese Betrachtung machte ich bei Arezzo, wo sich eine herrliche Plaine auftut. Reiner kann man kein Feld sehen, nirgends auch nur eine Erdscholle, alles klar wie gesiebt. Der Weizen gedeiht hier recht schön, und er scheint hier alle seiner Natur gemäßen Bedingungen zu finden. Das zweite Jahr bauen sie Bohnen für die Pferde, die hier keinen Hafer bekommen. Es werden auch Lupinen gesäet, die jetzt schon vortrefflich grün stehen und im März Früchte bringen. Auch der Lein hat schon gekeimt, er bleibt den Winter über und wird durch den Frost nur dauerhafter.
Die Ölbäume sind wunderliche Pflanzen; sie sehen fast wie Weiden, verlieren auch den Kern, und die Rinde klafft auseinander. Aber sie haben dessenungeachtet ein festeres Ansehn. Man sieht auch dem Holze an, dass es langsam wächst und sich unsäglich fein organisiert. Das Blatt ist weidenartig, nur weniger Blätter am Zweige. Um Florenz an den Bergen ist alles mit Ölbäumen und Weinstöcken bepflanzt, dazwischen wird das Erdreich zu Körnern benutzt. Bei Arezzo und so weiter lässt man die Felder freier. Ich finde, dass man dem Efeu nicht genug abwehrt, der den Ölbäumen und andern schädlich ist, da es so ein Leichtes wäre, ihn zu zerstören. Wiesen sieht man gar nicht. Man sagt, das türkische Korn zehre den Boden aus; seitdem es eingeführt worden, habe der Ackerbau in anderm Betracht verloren. Ich glaube es wohl bei dem geringen Dünger.
Heute Abend habe ich von meinem Hauptmann Abschied genommen, mit der Versicherung, mit dem Versprechen, ihn auf meiner Rückreise in Bologna zu besuchen. Er ist ein wahrer Repräsentant vieler seiner Landsleute. Hier einiges, das ihn besonders bezeichnet. Da ich oft still und nachdenklich war, sagte er einmal: »Che pensa! non deve mai pensar l’uomo, pensando s’invecchia.« Das ist verdolmetscht: »Was denkt Ihr viel! der Mensch muss niemals denken, denkend altert man nur.« Und nach einigem Gespräch: »Non deve fermarsi l’uomo in una sola cosa, perchè allora divien matto; bisogna aver mille cose, una confusione nella testa.« Auf Deutsch: »Der Mensch muss sich nicht auf eine einzige Sache heften, denn da wird er toll, man muss tausend Sachen, eine Konfusion im Kopfe haben.«
Der gute Mann konnte freilich nicht wissen, dass ich eben darum still und nachdenkend war, weil eine Konfusion von alten und neuen Gegenständen mir den Kopf verwirrte. Die Bildung eines solchen Italieners wird man noch klarer aus Folgendem erkennen. Da er wohl merkte, dass ich Protestant sei, sagte er nach einigem Umschweif, ich möchte ihm doch gewisse Fragen erlauben, denn er habe so viel Wunderliches von uns Protestanten gehört, worüber er endlich einmal Gewissheit zu haben wünsche. »Dürft ihr denn«, so fragte er, »mit einem hübschen Mädchen auf einem guten Fuß leben, ohne mit ihr gerade verheiratet zu sein? – erlauben euch das eure Priester?« Ich erwiderte darauf: »Unsere Priester sind kluge Leute, welche von solchen Kleinigkeiten keine Notiz nehmen. Freilich, wenn wir sie darum fragen wollten, so würden sie es uns nicht erlauben.« – »Ihr braucht sie also nicht zu fragen?«, rief er aus. »O ihr Glücklichen! und da ihr ihnen nicht beichtet, so erfahren sie’s nicht.« Hierauf erging er sich in Schelten und Missbilligen seiner Pfaffen und in dem Preise unserer seligen Freiheit. – »Was jedoch die Beichte betrifft«, fuhr er fort, »wie verhält es sich damit? Man erzählt uns, dass alle Menschen, auch die keine Christen sind, dennoch beichten müssen; weil sie aber in ihrer Verstockung nicht das Rechte treffen können, so beichten sie einem alten Baume, welches denn freilich lächerlich und gottlos genug ist, aber doch beweist, dass sie die Notwendigkeit der Beichte anerkennen.« Hierauf erklärte ich ihm unsere Begriffe von der Beichte und wie es dabei zugehe. Das kam ihm sehr bequem vor, er meinte aber, es sei ungefähr ebensogut, als wenn man einem Baum beichtete. Nach einigem Zaudern ersucht’ er mich sehr ernsthaft, über einen andern Punkt ihm redlich Auskunft zu geben, er habe nämlich aus dem Munde eines seiner Priester, der ein wahrhafter Mann sei, gehört, dass wir unsere Schwestern heiraten dürften, welches denn doch eine starke Sache sei. Als ich diesen Punkt verneinte und ihm einige menschliche Begriffe von unserer Lehre beibringen wollte, mochte er nicht sonderlich darauf merken, denn es kam ihm zu alltäglich vor, und er wandte sich zu einer neuen Frage: – »Man versichert uns«, sagte er, »dass Friedrich der Große, welcher so viele Siege selbst über die Gläubigen davongetragen und die Welt mit seinem Ruhm erfüllt, dass er, den jedermann für einen Ketzer hält, wirklich katholisch sei und vom Papste die Erlaubnis habe, es zu verheimlichen; denn er kommt, wie man weiß, in keine eurer Kirchen, verrichtet aber seinen Gottesdienst in einer unterirdischen Kapelle mit zerknirschtem Herzen, dass er die heilige Religion nicht öffentlich bekennen darf; denn freilich, wenn er das täte, würden ihn seine Preußen, die ein bestialisches Volk und wütende Ketzer sind, auf der Stelle totschlagen, wodurch denn der Sache nicht geholfen wäre. Deswegen hat ihm der heilige Vater jene Erlaubnis gegeben, dafür er denn aber auch die alleinseligmachende Religion im Stillen so viel ausbreitet und begünstigt als möglich.« Ich ließ das alles gelten und erwiderte nur: da es ein großes Geheimnis sei, könnte freilich niemand davon Zeugnis geben. Unsere fernere Unterhaltung war ungefähr immer von derselben Art, so dass ich mich über die kluge Geistlichkeit wundern musste, welche alles abzulehnen und zu entstellen sucht, was den dunkeln Kreis ihrer herkömmlichen Lehre durchbrechen und verwirren könnte.
Ich verließ Perugia an einem herrlichen Morgen und fühlte die Seligkeit, wieder allein zu sein. Die Lage der Stadt ist schön, der Anblick des Sees höchst erfreulich. Ich habe mir die Bilder wohl eingedrückt. Der Weg ging erst hinab, dann in einem frohen, an beiden Seiten in der Ferne von Hügeln eingefassten Tale hin, endlich sah ich Assisi liegen.
Aus Palladio und Volkmann wusste ich, dass ein köstlicher Tempel der Minerva, zu Zeiten Augusts gebaut, noch vollkommen erhalten dastehe. Ich verließ bei Madonna del Angelo meinen Vetturin, der seinen Weg nach Foligno verfolgte, und stieg unter einem starken Wind nach Assisi hinauf, denn ich sehnte mich, durch die für mich so einsame Welt eine Fußwanderung anzustellen. Die ungeheueren Substruktionen der babylonisch übereinander getürmten Kirchen, wo der heilige Franziskus ruht, ließ ich links mit Abneigung, denn ich dachte mir, dass darin die Köpfe so wie mein Hauptmannskopf gestempelt würden. Dann fragte ich einen hübschen Jungen nach der Maria della Minerva; er begleitete mich die Stadt hinauf, die an einen Berg gebaut ist. Endlich gelangten wir in die eigentliche alte Stadt, und siehe, das löblichste Werk stand vor meinen Augen, das erste vollständige Denkmal der alten Zeit, das ich erblickte. Ein bescheidener Tempel, wie er sich für eine so kleine Stadt schickte, und doch so vollkommen, so schön gedacht, dass er überall glänzen würde. Nun vorerst von seiner Stellung! Seitdem ich in Vitruv und Palladio gelesen, wie man Städte bauen, Tempel und öffentliche Gebäude stellen müsse, habe ich einen großen Respekt vor solchen Dingen. Auch hierin waren die Alten so groß im Natürlichen. Der Tempel steht auf der schönen mittlern Höhe des Berges, wo eben zwei Hügel zusammentreffen, auf dem Platz, der noch jetzt »der Platz« heißt. Dieser steigt selbst ein wenig an, und es kommen auf demselben vier Straßen zusammen, die ein sehr gedrücktes Andreaskreuz machen, zwei von unten herauf, zwei von oben herunter. Wahrscheinlich standen zur alten Zeit die Häuser noch nicht, die jetzt, dem Tempel gegenüber gebaut, die Aussicht versperren. Denkt man sie weg, so blickte man gegen Mittag in die reichste Gegend, und zugleich würde Minervens Heiligtum von allen Seiten her gesehen. Die Anlage der Straßen mag alt sein; denn sie folgen aus der Gestalt und dem Abhange des Berges. Der Tempel steht nicht in der Mitte des Platzes, aber so gerichtet, dass er dem von Rom Heraufkommenden verkürzt gar schön sichtbar wird. Nicht allein das Gebäude sollte man zeichnen, sondern auch die glückliche Stellung.
An der Fassade konnte ich mich nicht satt sehen, wie genialisch konsequent auch hier der Künstler gehandelt. Die Ordnung ist korinthisch, die Säulenweiten etwas über zwei Model. Die Säulenfüße und die Platten darunter scheinen auf Piedestalen zu stehen, aber es scheint auch nur; denn der Sockel ist fünfmal durchschnitten, und jedesmal gehen fünf Stufen zwischen den Säulen hinauf, da man denn auf die Fläche gelangt, worauf eigentlich die Säulen stehen, und von welcher man auch in den Tempel hineingeht. Das Wagstück, den Sockel zu durchschneiden, war hier am rechten Platze, denn da der Tempel am Berge liegt, so hätte die Treppe, die zu ihm hinaufführte, viel zu weit vorgelegt werden müssen und würde den Platz verengt haben. Wieviel Stufen noch unterhalb gelegen, lässt sich nicht bestimmen; sie sind außer wenigen verschüttet und zugepflastert. Ungern riss ich mich von dem Anblick los und nahm mir vor, alle Architekten auf dieses Gebäude aufmerksam zu machen, damit uns ein genauer Riss davon zukäme. Denn was Überlieferung für ein schlechtes Ding sei, musste ich dieses Mal wieder bemerken. Palladio, auf den ich alles vertraute, gibt zwar dieses Tempels Bild, er kann ihn aber nicht selbst gesehen haben, denn er setzt wirklich Piedestale auf die Fläche, wodurch die Säulen unmäßig in die Höhe kommen und ein garstiges palmyrisches Ungeheuer entsteht, anstatt dass in der Wirklichkeit ein ruhiger, lieblicher, das Auge und den Verstand befriedigender Anblick erfreut. Was sich durch die Beschauung dieses Werks in mir entwickelt, ist nicht auszusprechen und wird ewige Früchte bringen. Ich ging am schönsten Abend die römische Straße bergab, im Gemüt zum schönsten beruhiget, als ich hinter mir raue, heftige Stimmen vernahm, die untereinander stritten. Ich vermutete, dass es die Sbirren sein möchten, die ich schon in der Stadt bemerkt hatte. Ich ging gelassen vor mich hin und horchte hinterwärts. Da konnte ich nun gar bald bemerken, dass es auf mich gemünzt sei. Vier solcher Menschen, zwei davon mit Flinten bewaffnet, in unerfreulicher Gestalt, gingen vor mir vorbei, brummten, kehrten nach einigen Schritten zurück und umgaben mich. Sie fragten, wer ich wäre und was ich hier täte. Ich erwiderte, ich sei ein Fremder, der seinen Weg über Assisi zu Fuße mache, indessen der Vetturin nach Foligno fahre. Dies kam ihnen nicht wahrscheinlich vor, dass jemand einen Wagen bezahle und zu Fuße gehe. Sie fragten, ob ich im Gran Convento gewesen sei. Ich verneinte dies und versicherte ihnen, ich kenne das Gebäude von alten Zeiten her. Da ich aber ein Baumeister sei, habe ich diesmal nur die Maria della Minerva in Augenschein genommen, welches, wie sie wüssten, ein musterhaftes Gebäude sei. Das leugneten sie nicht, nahmen aber sehr übel, dass ich dem Heiligen meine Aufwartung nicht gemacht, und gaben ihren Verdacht zu erkennen, dass wohl mein Handwerk sein möchte, Kontrebande einzuschwärzen. Ich zeigte ihnen das Lächerliche, dass ein Mensch, der allein auf der Straße gehe, ohne Ranzen, mit leeren Taschen, für einen Kontrebandisten gehalten werden solle. Darauf erbot ich mich, mit ihnen nach der Stadt zurück und zum Podestà zu gehen, ihm meine Papiere vorzulegen, da er mich denn als einen ehrenvollen Fremden anerkennen werde. Sie brummten hierauf und meinten, es sei nicht nötig, und als ich mich immerfort mit entschiedenem Ernst betrug, entfernten sie sich endlich wieder nach der Stadt zu. Ich sah ihnen nach. Da gingen nun diese rohen Kerle im Vordergrunde, und hinter ihnen her blickte mich die liebliche Minerva noch einmal sehr freundlich und tröstend an, dann schaute ich links auf den tristen Dom des heiligen Franziskus und wollte meinen Weg verfolgen, als einer der Unbewaffneten sich von der Truppe sonderte und ganz freundlich auf mich los kam. Grüßend sagte er sogleich: »Ihr solltet, mein Herr Fremder, wenigstens mir ein Trinkgeld geben, denn ich versichere, dass ich Euch alsobald für einen braven Mann gehalten und dies laut gegen meine Gesellen erklärt habe. Das sind aber Hitzköpfe und gleich oben hinaus und haben keine Weltkenntnis. Auch werdet Ihr bemerkt haben, dass ich Euren Worten zuerst Beifall und Gewicht gab.« Ich lobte ihn deshalb und ersuchte ihn, ehrenhafte Fremde, die nach Assisi sowohl wegen der Religion als wegen der Kunst kämen, zu beschützen; besonders die Baumeister, die zum Ruhme der Stadt den Minerventempel, den man noch niemals recht gezeichnet und in Kupfer gestochen, nunmehro messen und abzeichnen wollten. Er möchte ihnen zur Hand gehen, da sie sich denn gewiss dankbar erweisen würden, und somit drückte ich ihm einige Silberstücke in die Hand, die ihn über seine Erwartung erfreuten. Er bat mich, ja wiederzukommen, besonders müsse ich das Fest des Heiligen nicht versäumen, wo ich mich mit größter Sicherheit erbauen und vergnügen sollte. Ja, wenn es mir, als einem hübschen Manne, wie billig, um ein hübsches Frauenzimmer zu tun sei, so könne er mir versichern, dass die schönste und ehrbarste Frau von ganz Assisi auf seine Empfehlung mich mit Freuden aufnehmen werde. Er schied nun beteurend, dass er noch heute Abend bei dem Grabe des Heiligen meiner in Andacht gedenken und für meine fernere Reise beten wolle. So trennten wir uns, und mir war sehr wohl, mit der Natur und mit mir selbst wieder allein zu sein. Der Weg nach Foligno war einer der schönsten und anmutigsten Spaziergänge, die ich jemals zurückgelegt. Vier volle Stunden an einem Berge hin, rechts ein reichbebautes Tal.
Mit den Vetturinen ist es eine leidige Fahrt; das Beste, dass man ihnen bequem zu Fuße folgen kann. Von Ferrara lass ich mich nun immer bis hieher so fortschleppen. Dieses Italien, von Natur höchlich begünstiget, blieb in allem Mechanischen und Technischen, worauf doch eine bequemere und frischere Lebensweise gegründet ist, gegen alle Länder unendlich zurück. Das Fuhrwerk der Vetturine, welches noch Sedia, ein Sessel, heißt, ist gewiss aus den alten Tragsesseln entstanden, in welchen sich Frauen, ältere und vornehmere Personen von Maultieren tragen ließen. Statt des hintern Maultiers, das man hervor neben die Gabel spannte, setzte man zwei Räder unter, und an keine weitere Verbesserung ward gedacht. Man wird wie vor Jahrhunderten noch immer fortgeschaukelt, und so sind sie in ihren Wohnungen und allem.
Wenn man die erste poetische Idee, dass die Menschen meist unter freiem Himmel lebten und sich gelegentlich manchmal aus Not in Höhlen zurückzogen, noch realisiert sehen will, so muss man die Gebäude hier herum, besonders auf dem Lande, betreten, ganz im Sinn und Geschmack der Höhlen. Eine so unglaubliche Sorglosigkeit haben sie, um über dem Nachdenken nicht zu veralten. Mit unerhörtem Leichtsinn versäumen sie, sich auf den Winter, auf längere Nächte vorzubereiten, und leiden deshalb einen guten Teil des Jahres wie die Hunde. Hier in Foligno, in einer völlig homerischen Haushaltung, wo alles um ein auf der Erde brennendes Feuer in einer großen Halle versammelt ist, schreit und lärmt, am langen Tische speist, wie die Hochzeit von Kana gemalt wird, ergreife ich die Gelegenheit, dieses zu schreiben, da einer ein Tintenfass holen lässt, woran ich unter solchen Umständen nicht gedacht hätte. Aber man sieht auch diesem Blatt die Kälte und die Unbequemlichkeit meines Schreibtisches an.
Jetzt fühl ich wohl die Verwegenheit, unvorbereitet und unbegleitet in dieses Land zu gehen. Mit dem verschiedenen Gelde, den Vetturinen, den Preisen, den schlechten Wirtshäusern ist es eine tagtägliche Not, dass einer, der zum ersten Male wie ich allein geht und ununterbrochnen Genuss hoffte und suchte, sich unglücklich genug fühlen müsste. Ich habe nichts gewollt, als das Land sehen, auf welche Kosten es sei, und wenn sie mich auf Ixions Rad nach Rom schleppen, so will ich mich nicht beklagen.
Terni, den 27. Oktober, abends.
Wieder in einer Höhle sitzend, die vor einem Jahr vom Erdbeben gelitten; das Städtchen liegt in einer köstlichen Gegend, die ich auf einem Rundgange um dasselbe her mit Freuden beschaute, am Anfang einer schönen Plaine zwischen Bergen, die alle noch Kalk sind. Wie Bologna drüben, so ist Terni hüben an den Fuß des Gebirgs gesetzt.
Nun da der päpstliche Soldat mich verlassen, ist ein Priester mein Gefährte. Dieser scheint schon mehr mit seinem Zustande zufrieden und belehrt mich, den er freilich schon als Ketzer erkennt, auf meine Fragen sehr gern von dem Ritus und andern dahin gehörigen Dingen. Dadurch, dass ich immer wieder unter neue Menschen komme, erreiche ich durchaus meine Absicht; man muss das Volk nur untereinander reden hören, was das für ein lebendiges Bild des ganzen Landes gibt. Sie sind auf die wunderbarste Weise sämtlich Widersacher, haben den sonderbarsten Provinzial- und Stadteifer, können sich alle nicht leiden, die Stände sind in ewigem Streit, und das alles mit immer lebhafter gegenwärtiger Leidenschaft, dass sie einem den ganzen Tag Komödie geben und sich bloßstellen, und doch fassen sie zugleich wieder auf und merken gleich, wo der Fremde sich in ihr Tun und Lassen nicht finden kann.
Spoleto hab ich bestiegen und war auf der Wasserleitung, die zugleich Brücke von einem Berg zu einem andern ist. Die zehen Bogen, welche über das Tal reichen, stehen von Backsteinen ihre Jahrhunderte so ruhig da, und das Wasser quillt immer noch in Spoleto an allen Orten und Enden. Das ist nun das dritte Werk der Alten, das ich sehe, und immer derselbe große Sinn. Eine zweite Natur, die zu bürgerlichen Zwecken handelt, das ist ihre Baukunst, so steht das Amphitheater, der Tempel und der Aquadukt. Nun fühle ich erst, wie mir mit Recht alle Willkürlichkeiten verhasst waren, wie z. B. der Winterkasten auf dem Weißenstein, ein Nichts um Nichts, ein ungeheurer Konfektaufsatz, und so mit tausend andern Dingen. Das steht nun alles totgeboren da, denn was nicht eine wahre innere Existenz hat, hat kein Leben und kann nicht groß sein und nicht groß werden.
Was bin ich nicht den letzten acht Wochen schuldig geworden an Freuden und Einsicht; aber auch Mühe hat mich’s genug gekostet. Ich halte die Augen nur immer offen und drücke mir die Gegenstände recht ein. Urteilen möchte ich gar nicht, wenn es nur möglich wäre.
San Crocefisso, eine wunderliche Kapelle am Wege, halte ich nicht für den Rest eines Tempels, der am Orte stand, sondern man hat Säulen, Pfeiler, Gebälke gefunden und zusammengeflickt, nicht dumm, aber toll. Beschreiben lässt sich’s gar nicht, es ist wohl irgendwo in Kupfer gestochen.
Und so wird es einem denn doch wunderbar zumute, dass uns, indem wir bemüht sind, einen Begriff des Altertums zu erwerben, nur Ruinen entgegenstehen, aus denen man sich nun wieder das kümmerlich aufzuerbauen hätte, wovon man noch keinen Begriff hat.
Mit dem, was man klassischen Boden nennt, hat es eine andere Bewandtnis. Wenn man hier nicht phantastisch verfährt, sondern die Gegend real nimmt, wie sie daliegt, so ist sie doch immer der entscheidende Schauplatz, der die größten Taten bedingt, und so habe ich immer bisher den geologischen und landschaftlichen Blick benutzt, um Einbildungskraft und Empfindung zu unterdrücken und mir ein freies, klares Anschauen der Lokalität zu erhalten. Da schließt sich denn auf eine wundersame Weise die Geschichte lebendig an, und man begreift nicht, wie einem geschieht, und ich fühle die größte Sehnsucht, den Tacitus in Rom zu lesen.
Das Wetter darf ich auch nicht ganz hintansetzen. Da ich von Bologna die Apenninen heraufkam, zogen die Wolken noch immer nach Norden, späterhin veränderten sie ihre Richtung und zogen nach dem trasimenischen See. Hier blieben sie hangen, zogen auch wohl gegen Mittag. Statt also dass die große Plaine des Po den Sommer über alle Wolken nach dem Tiroler Gebirg schickt, sendet sie jetzt einen Teil nach den Apenninen, daher mag die Regenzeit kommen.
Man fängt nun an, die Oliven abzulesen. Sie tun es hier mit den Händen, an andern Orten schlagen sie mit Stöcken drein. Kommt ein frühzeitiger Winter, so bleiben die übrigen bis gegen das Frühjahr hängen. Heute habe ich auf sehr steinigem Boden die größten, ältesten Bäume gesehen.
Die Gunst der Musen wie die der Dämonen besucht uns nicht immer zur rechten Zeit. Heute ward ich aufgeregt, etwas auszubilden, was gar nicht an der Zeit ist. Dem Mittelpunkte des Katholizismus mich nähernd, von Katholiken umgeben, mit einem Priester in eine Sedie eingesperrt, indem ich mit reinstem Sinn die wahrhafte Natur und die edle Kunst zu beobachten und aufzufassen trachte, trat mir so lebhaft vor die Seele, dass vom ursprünglichen Christentum alle Spur verloschen ist; ja, wenn ich mir es in seiner Reinheit vergegenwärtigte, so wie wir es in der Apostelgeschichte sehen, so musste mir schaudern, was nun auf jenen gemütlichen Anfängen ein unförmliches, ja barockes Heidentum lastet. Da fiel mir der ewige Jude wieder ein, der Zeuge aller dieser wundersamen Ent- und Aufwicklungen gewesen und so einen wunderlichen Zustand erlebte, dass Christus selbst, als er zurückkommt, um sich nach den Früchten seiner Lehre umzusehen, in Gefahr gerät, zum zweitenmal gekreuzigt zu werden. Jene Legende: »Venio iterum crucifigi« sollte mir bei dieser Katastrophe zum Stoff dienen.
Dergleichen Träume schweben mir vor. Denn aus Ungeduld, weiter zu kommen, schlafe ich angekleidet und weiß nichts Hübscheres, als vor Tag aufgeweckt zu werden, mich schnell in den Wagen zu setzen und zwischen Schlaf und Wachen dem Tag entgegen zu fahren und dabei die ersten besten Phantasiebilder nach Belieben walten zu lassen.
Città Castellana, den 28. Oktober.
Den letzten Abend will ich nicht fehlen. Es ist noch nicht acht Uhr und alles schon zu Bette; so kann ich noch zu guter Letzt des Vergangenen gedenken und mich aufs nächst Künftige freuen. Heute war ein ganz heiterer, herrlicher Tag, der Morgen sehr kalt, der Tag klar und warm, der Abend etwas windig, aber sehr schön.
Von Terni fuhren wir sehr früh aus; Narni kamen wir hinauf, ehe es Tag war, und so habe ich die Brücke nicht gesehen. Täler und Tiefen, Nähen und Fernen, köstliche Gegenden, alles Kalkgebirg, auch nicht eine Spur eines andern Gesteins.
Otricoli liegt auf einem der von den ehemaligen Strömungen zusammengeschwemmten Kieshügel und ist von Lava gebaut, jenseits des Flusses hergeholt.
Sobald man über die Brücke hinüber ist, findet man sich im vulkanischen Terrain, es sei nun unter wirklichen Laven oder unter früherm Gestein, durch Röstung und Schmelzung verändert. Man steigt einen Berg herauf, den man für graue Lava ansprechen möchte. Sie enthält viele weiße, granatförmig gebildete Kristalle. Die Chaussee, die von der Höhe nach Città Castellana geht, von eben diesem Stein, sehr schön glatt gefahren, die Stadt auf vulkanischen Tuff gebaut, in welchem ich Asche, Bimsstein und Lavastücke zu entdecken glaubte. Vom Schlosse ist die Aussicht sehr schön; der Berg Soracte steht einzeln gar malerisch da, wahrscheinlich ein zu den Apenninen gehöriger Kalkberg. Die vulkanisierenden Strecken sind viel niedriger als die Apenninen, und nur das durchreißende Wasser hat aus ihnen Berge und Felsen gebildet, da denn herrlich malerische Gegenstände, überhangende Klippen und sonstige landschaftliche Zufälligkeiten gebildet werden.
Morgen Abend also in Rom. Ich glaube es noch jetzt kaum, und wenn dieser Wunsch erfüllt ist, was soll ich mir nachher wünschen? ich wüsste nichts, als dass ich mit meinem Fasanenkahn glücklich zu Hause landen und meine Freunde gesund, froh und wohlwollend antreffen möge.