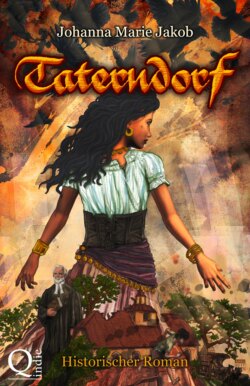Читать книгу Taterndorf - Johanna Marie Jakob - Страница 3
1. Ankunft
ОглавлениеÜber die Autorin:
Johanna Marie Jakob wurde 1962 geboren und lebt im Südharz. Sie hat Mathematik und Physik studiert und arbeitet an einem Gymnasium in Nordhausen. Dies ist ihr vierter historischer Roman.
Johanna Marie Jakob
Taterndorf
Historischer Roman
www.johanna-marie-jakob.deBibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Alle Texte sowie alle sonstigen schöpferischen Teile dieses Werks sind unter anderem urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren, die Digitalisierung, das Herunterladen z.B. in den Arbeitsspeicher, das Smoothing, die Komprimierung in ein anderes Format und Ähnliches stellen unter anderem eine urheberrechtlich relevante Vervielfältigung dar. Verstöße gegen den urheberrechtlichen Schutz sowie jegliche Bearbeitung der hier erwähnten schöpferischen Elemente sind nur mit ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Autors und des Verlags zulässig. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.
2. Auflage
© Juni 2015 Johanna Marie Jakob
Illustration und Covergestaltung: Arne Beitmann
www.arnebeitmann.de
Lektorat: Autorenteam Ellen Heil und Karin Kuretschka
CreateSpace Independent Publishing Platform
ISBN-13: 978-1499779851
ISBN-10: 1499779852
Alle Rechte vorbehalten
Nikolaus Lenau
Die drei Zigeuner
Drei Zigeuner fand ich einmal
liegen an einer Weide,
als mein Fuhrwerk mit müder Qual
schlich durch sandige Heide.
Hielt der eine für sich allein
in den Händen die Fiedel,
spielte, umglüht vom Abendschein,
sich ein feuriges Liedel.
Hielt der zweite die Pfeif im Mund,
blickte nach seinem Rauche,
froh, als ob er vom Erdenrund
nichts zum Glücke mehr brauche.
Und der dritte behaglich schlief,
und sein Zimbal am Baum hing,
über die Saiten der Windhauch lief,
über sein Herz ein Traum ging.
An den Kleidern trugen die drei
Löcher und bunte Flicken,
aber sie boten trotzig frei
Spott den Erdengeschicken.
Dreifach haben sie mir gezeigt,
wenn das Leben uns nachtet,
wie man‘s verraucht, verschläft, vergeigt
und es dreimal verachtet.
Nach den Zigeunern lang noch schaun
mußt ich im Weiterfahren,
nach den Gesichtern dunkelbraun,
den schwarzlockigen Haaren.
An die Gesellschaft zur Beförderung der evangelischen Missionen unter den Heiden
Berlin NO 43
Georgenkirchstraße 70
Berlin, den 12ten Dezember 1827
Sehr geehrter Herr Direktor Wolfenhagen,
nach meiner Inspektionsreise durch die Provinzen des südlichen Preußens muß ich Sie heute auf einen Heidenstamm aufmerksam machen, der bisher offensichtlich übersehen und unbeachtet geblieben ist. Es handelt sich um eine große Gruppe von Sinti in Friedrichslohra und den Wäldern der Umgebung. Nach ihren eigenen Angaben zählen sie an die 300 Köpfe. Die Armut bei diesen armen Heiden ist groß, und Arbeit, womit sie sich etwas verdienen können, ist ihnen völlig unbekannt. Ich fordere Ihre Gesellschaft höflichst auf, sich derselben an Leib und Seele anzunehmen und ihnen baldmöglichst evangelische Hilfe und Trost zu senden. Wie Sie mir gewißlich zustimmen werden, bietet sich hier eine passende Gelegenheit zur Heidenbekehrung in unserem deutschen Vaterlande.
Hochachtungsvoll
Baron Theobald von Wurmb
Oh, das stört nicht meine Ruh,
wär ich Herr, doch wozu?
Wenn ich kein Zigeuner blieb,
hätt mich dann mein Liebchen lieb?
(Zigeunerreim)
Ohne Unterlass trommelte der Regen auf das Dach der Kutsche. Magdalena blickte seit Stunden immer wieder besorgt nach oben, als erwarte sie, dass die ersten Tropfen durch den mit dunklem Stoff bespannten Himmel sickerten. Wilhelm hatte es längst aufgegeben, sie zu beruhigen. Er wandte den Blick vom tropfenverhangenen Fenster ab. Der Ausblick stimmte ohnehin schwermütig, da das graue Licht des Tages wie Blei auf abgeernteten Feldern und gelbbraunen Wiesen lag. Er musterte seine junge Frau unauffällig. Sie war bleich, die beschwerliche Fahrt bekam ihr nicht. Schützend lag ihre Hand auf ihrem Bauch. Hatte er ihr zu viel zugemutet? Die lange Reise auf schlechten Wegen, fremde Menschen dicht neben ihr in einer unbequemen Kutsche und als Ziel dieses unbekannte Dorf weitab von ihrer Heimat.
„Es kann nicht mehr weit sein“, sagte er halblaut, bemüht, das Rauschen des Regens und das Knarren der gequälten Achsen zu übertönen, ohne dabei die beiden Mitreisenden zu wecken.
Sie lächelte dankbar und deutete mit dem Kinn auf die Männer. „Ich muss mir immerzu vorstellen, wie es wäre, wenn ihnen die Köpfe abfielen!“, flüsterte sie.
Die zwei Handelsleute aus Sondershausen waren trotz des starken Schaukelns auf den miserablen Straßen der preußischen Provinz eingeschlafen. Ihre Schädel wackelten im Takt der Schlaglöcher.
Wilhelm grinste. Wenn Lenchen ihren Humor nicht verloren hatte, konnte es so schlimm nicht sein. Er fasste nach ihrer Hand, die auf den zerschlissenen Polstern lag.
Das Unglück kam, nicht wie erwartet, in Form von Wasser durch das Dach, sondern als gewöhnlicher Karossenschaden. Ein harter Schlag fuhr in das Gefährt, es neigte sich bedrohlich zur rechten Seite. Die beiden Handelsreisenden rutschten von der Bank, wobei der eine mit dem Kopf in Magdalenas Schoß landete, während der andere sich reflexartig auf Wilhelms Knie abstützte. Ein erstickter Schrei ging unter im lauten Fluchen des Kutschers und im erschrockenen Wiehern der Pferde.
Ein weiterer Ruck und der Wagen stand, wenn auch mit Schlagseite. Wilhelms Gegenüber rappelte sich auf, entschuldigte sich schlaftrunken und öffnete die Tür. Der andere Händler suchte mit hochrotem Kopf nach seinem Hut. Wilhelm sprang hinaus in den Regen. Die Gäule tänzelten nervös und verdrehten schnaubend die Hälse. Der Kutscher redete ihnen beruhigend zu, während er die Zügel am Kutschbock festband. Gewandt kletterte er herunter und beugte sich unter die schiefhängende Karosse.
„Was ist passiert?“, fragte Wilhelm.
„Ein Splint an der Aufhängung!“ Der Mann fluchte halblaut und schob seinen Regenhut in den Nacken. „Zum Glück ist es nicht die Achse. Wenn wir im nächsten Dorf einen Stellmacher finden, ist der Schaden schnell behoben!“
„Im nächsten Dorf?“
„Ja, wir sind kurz vor der Station Elende. Ich spanne ein Pferd aus und reite hin. In einer halben Stunde kann ich wieder hier sein.“
„Wie weit ist es noch bis Friedrichslohra?“
„Ein bis zwei Meilen, schätze ich. Es liegt am Berghang oberhalb von Elende. Aber bei dem Wetter und mit Ihrem Gepäck rate ich von einem Fußmarsch ab. Schon gar nicht in dieses Dorf.“ Der Mann begann, das vordere Kutschpferd abzuschirren.
Bereits beim Einsteigen in Sangerhausen hatte der Kutscher ihn neugierig gemustert, als Wilhelm sein Reiseziel nannte.
„Was ist mit diesem Dorf?“
Der Mann antwortete nicht, das rechte Pferd drängte sich unruhig gegen ihn, als er versuchte, es auszuschirren. „Ruhig, Mose, ruhig. Alles in Ordnung.“
Magdalena steckte den Kopf aus der Tür. „Wie lange wird es dauern?“ Ihre müden Augen flehten, er überlegte, wie er ihr sagen konnte, dass sie in dieser Schieflage ausharren mussten, bis sich ein Handwerker gefunden hatte.
Einer der Händler antwortete ihr: „Geduld, gnädige Frau. Der Kutscher reitet los, jemanden aus dem Dorf zu holen.“ An Wilhelm gewandt, fuhr er fort: „Wir sollten uns ins Trockene setzen, mein Herr. Eine Erkältung ist sicher das Letzte, was wir von dieser Reise mitbringen wollen.“
Schwere Hufschläge verklangen im nahen Wald. Das zurückgebliebene Pferd wieherte verstört und versuchte zu folgen. Ein kräftiger Ruck ging durch das Gefährt.
„Brrr!“, rief Wilhelm. „Steigen Sie ruhig ein, ich gehe mal nach den Zügeln sehen.“
Während er die Bremsen und Leinen überprüfte und dem braunen Hengst den Hals klopfte, vernahm er erneut Hufgetrappel, doch kamen die Geräusche aus der anderen Richtung. Eine leichte Anhöhe, die sie kurz vor ihrem Unglück überwunden hatten, versperrte die Sicht. Er kletterte auf den Kutschbock, was die instabile Karosse gehörig ins Schwanken brachte.
„Wilhelm, was tust du?“, hörte er Magdalena ängstlich rufen.
Von seinem Standpunkt aus konnte er den Weg besser einsehen. Was er erblickte, ließ ihn die Stirn runzeln. Über dem nahen Horizont schwankten bunte Stoffe im Regen, deren Farben sich gegen den tristen Herbsttag behaupteten. Sie wuchsen aus dem Nebelgrau des Tages heraus, wurden größer und farbenprächtiger. Gleichzeitig schwoll das Geräusch klopfender Hufe und knarrender Deichseln zu einer solchen Stärke an, dass selbst in der Kutsche das Regenprasseln übertönt wurde, denn er hörte Magdalena erneut rufen: „Wilhelm, was ist das?“
Er hielt die Hand über die Augen, um das Wasser abzuhalten. Im selben Moment hob sich der erste bunte Stofffetzen vollends über den Wegkamm und wurde zur Plane eines von stämmigen Pferdchen gezogenen Wagens. Wilhelm musste lachen.
„Zigeuner! Es sind Zigeunerwagen“, rief er in die Kutsche hinunter.
Während er hinabkletterte, schwang die Tür auf und Magdalena sprang heraus, die Augen erwartungsvoll aufgerissen. Aus dem Dunkel des Wagens hörte er den Händler: „Seien Sie vernünftig, gnädige Frau. Sie werden sich den Tod holen, da draußen!“
„Er hat recht. Du wirst nass und verdirbst dir die Schuhe“, ermahnte er sie.
„Aber Wilhelm, Zigeuner! Sind wir nicht ihretwegen hierhergekommen?“
„Nun ja, vielleicht nicht gerade wegen denen dort“, murmelte er und starrte dem bunten Gewirr von Stoffen, zottigen Pferdemähnen und dunklen Gesichtern entgegen. Er griff in die Kutsche und zog eine Decke heraus, die er seiner Frau um die Schultern legte.
Als der erste Wagen heran war, rief der bärtige Mann auf dem Kutschbock ein lautes Kommando nach hinten und sprang herunter. Aus dem Wageninneren griff eine schmale Hand nach den Zügeln. An ihrem Gelenk klimperte eine Unzahl von glänzenden Armreifen. Sie gehörten einer jungen Frau mit einem roten Kopftuch, die behände auf den frei gewordenen Platz kletterte. Ihre Haut war dunkel wie Schokolade. Kohlenschwarze Augen musterten ihn ohne Scheu. In ihren Ohren baumelten goldene Scheiben, die auch in großer Menge an einer Schnur um ihren Hals hingen. Das Verwunderlichste an ihr aber war die kurze krumme Pfeife, die ihr im Mundwinkel hing und auf der sie unablässig kaute. Als sie sich nach vorn beugte, um die Zügel zu lockern, öffnete sich ihre nur liederlich um die Schultern gezurrte Bluse noch weiter und Wilhelm fühlte, wie ihm die Schamesröte ins Gesicht stieg. Er wandte sich abrupt ab. Vor ihm stand der Mann, der eben vom Kutschbock gesprungen war. Er war groß und schlank, seine Haut glänzte dunkel. Volles Haar lugte unter einem kecken Filzhut hervor, an dem eine Pfauenfeder steckte. Ein schwarzer Bart ließ ihn wahrscheinlich älter aussehen, aber er mochte etwa in Wilhelms Alter sein.
„Brauchst du Hilfe, Herr? Was ist mit deinem Wagen?“ Ohne eine Antwort abzuwarten, beugte sich der Zigeuner unter die Kutsche.
„Das ist nicht mein Wagen!“, sagte Wilhelm in Richtung der schiefen Achse, unter der der Mann verschwunden war. „Der Kutscher ist losgeritten, um einen Stellmacher zu holen.“
Magdalena zog an seinem Ärmel. „Frag sie, ob sie aus Friedrichslohra sind.“
„Warum?“
„Sie könnten uns mitnehmen.“
„Was?“ Sein Blick glitt über die abenteuerlich aussehenden Wagen und die ausgemergelten kleinen Pferde, die langsam an ihnen vorüberzogen. Dunkle Gestalten lugten neugierig hinter bunten Planen hervor, ein paar Kinder sprangen nackt durch den Regen, verfolgt von einer Meute graubrauner Hunde.
„Warum nicht? Wozu hier im Regen stehen und warten?“ Magdalena zerrte bereits ihren Proviantkorb aus der Kutsche.
Im Nu war sie von einem Dutzend Kindern umringt, die angesichts des Korbes sofort ihre schmutzigen kleinen Hände ausstreckten. „Bitte, Frau! Hast du Brot für uns? Bitte, Frau!“
„Da hast du es“, wollte Wilhelm sagen, doch beim Anblick der mageren Körper, die trotz des nasskalten Wetters gar nicht oder nur sehr dürftig bekleidet waren, verschlug es ihm die Sprache. Die Jungen trugen entweder ein Hemd oder eine zerlumpte Hose, so als ob sich mehrere von ihnen die Kleidung eines Kindes teilen mussten. Die Mädchen hatten meist gar nichts an, nur die größeren steckten in schmutzigen und fadenscheinigen Kittelchen. Dafür trug jedes mindestens ein Schmuckstück, sei es ein Reif um das Fuß- oder Handgelenk, große runde Ohrringe oder klimpernde Halsketten. Fast alle waren dünn und schoben aufgetriebene Bäuche vor sich her, die Krätze oder Flöhe hatten ihre Haut in den Kniekehlen und an den Armen beinahe aufgefressen. Eine scharfe Stimme rief etwas, dass Wilhelm nicht verstand und die Kinder stoben auseinander.
Der Zigeuner trat neben Magdalena und sagte zu Wilhelm: „Du hattest recht, Herr. Hier kann man nichts tun. Ein Splint muss her.“ Er verbeugte sich leicht vor Magdalena, wobei er eine Hand galant auf den Rücken legte und mit der anderen den Hut lüpfte. „Gnädige Frau, gestatten: Christoph Weiß, Musiker. Ich hörte, Sie reisen nach Friedrichslohra. Das ist auch unser Ziel. Wenn Sie mit meinem bescheidenen Wagen vorliebnehmen wollen?“
Magdalenas Gesichtsausdruck hatte in den letzten Momenten so oft gewechselt wie das Wetter im April. Nach dem Entsetzen über den armseligen Anblick der Kinder glitten Neugier und Abenteuerlust über ihre Züge, zuletzt sogar etwas Koketterie. Bevor Wilhelm Einwände erheben konnte, schenkte sie dem Mann, dessen Gesicht inzwischen fast ihre Füße berührte, ein strahlendes Lächeln und nickte, ohne zu bedenken, dass der das nicht sehen konnte.
„Wir haben eine Menge Gepäck, und außerdem müsste der Kutscher bald zurück sein“, sagte Wilhelm halbherzig.
Der Zigeuner hob den Kopf und blickte direkt in Magdalenas Gesicht, auf dem die Freude gerade von Enttäuschung, oder war es Zorn? – abgelöst wurde.
„Aber Herr, wir haben Platz auf unseren Wagen, nimm das Angebot ruhig an. Schau, wie nass und frierend die gnädige Frau hier im Regen steht!“ Der Mann hob den Arm und setzte den Hut leicht schräg auf seine drahtigen Locken. Der weite Ärmel seines weißen Hemdes bauschte sich im Wind. Er griff dem gerade vorbeiziehenden Pferd rüde ins Geschirr und der Wagen kam neben ihnen zum Stehen. Mit dem Kutscher, einem ebenfalls bärtigen Mann in einer bunten Fellweste, wechselte er ein paar schnell gesprochene Sätze in ihrer Sprache. Sofort sprangen zwei Frauen unter der Stoffplane hervor und rafften ihre weiten Röcke über dem nassen Boden. Ihre nackten Füße versanken im Schlamm des aufgeweichten Weges.
„Wo ist euer Gepäck, Herr?“, fragte eine von ihnen.
Wilhelm seufzte ergeben und deutete zur Rückwand der Postkutsche, an der zwei Kisten und ein Koffer fest verschnürt waren. „Das ist alles unseres.“
Ohne lange zu überlegen, begannen die Frauen, die Seile zu lösen.
Magdalena stieß einen kleinen Freudenschrei aus und wandte sich den Herren in der Kutsche zu. „Wir reisen mit den Zigeunern. Ich wünsche Ihnen eine baldige Weiterfahrt und alles Gute.“
Wilhelm verstand nicht, was sie ihr zur Antwort gaben, doch der Ältere beugte sich aus dem Fenster und winkte ihn zu sich heran. „Ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun“, sagte er mit gefurchter Stirn. „Lassen Sie Ihre Koffer keinen Moment aus den Augen!“
Trotz aller Zweifel an der Richtigkeit seines Handelns war Wilhelm doch froh, als er endlich ins trockene Innere des Planwagens klettern konnte. Sein Mantel war inzwischen nass und schwer und das Regenwasser war ihm zum Kragen hineingelaufen. Fröstelnd sah er sich um. Das Wageninnere war geräumiger als es von außen schien. Dicke Felle polsterten die Sitzbänke aus, darunter standen Kisten und Truhen, allerlei Hausrat baumelte von den wie Rippenbögen aufragenden Hölzern, die der Plane über seinem Kopf Halt gaben. Direkt hinter dem Kutschbock waren mehrere kleine Fässer festgezurrt, an denen Becher und Schöpfkellen hingen. Magdalena rückte dicht an ihn heran und lächelte zufrieden.
„Möchtest du zu trinken, Herr?“, fragte eine rauchige Stimme aus dem Dämmerlicht des Wagens.
„Ja, bitte. Wenn es Ihnen nichts ausmacht.“
Mehrstimmiges Kichern kam als Antwort, doch seine Augen hatten sich noch nicht an die Dämmerung gewöhnt, und er konnte nicht erkennen, wer außer ihnen im Wagen saß. Er hörte Holz auf Holz schaben, ein Plätschern, dann wurde ihm ein Becher gereicht. Die Hand vor seinem Gesicht war runzlig und so dunkel wie die eines Kaminfegers. Ein Dutzend glänzender Ringe klimperte um das Gelenk. „Nimm!“
Während er zugriff, fasste die Hand nach seiner Linken und öffnete sie. Erschrocken wollte er sie zurückziehen, doch die rauchige Stimme beruhigte ihn: „Keine Angst Herr, ich will nur dein Schicksal sehen. Trink und gib auch deiner Frau davon.“
Ein Finger, so knorrig wie der Ast eines alten Fliederbaumes, strich über die Innenfläche seiner Hand. Es kitzelte leicht und war seltsam angenehm. Aus lauter Verlegenheit hob er den Becher an die Lippen und trank. Er hatte angenommen, sie würden ihm Wasser geben, und nahm deshalb einen herzhaften Schluck. Zu spät spürte er den scharfen Geruch, der wie eine Glocke über dem Gefäß hing und ihm beißend in die Nase stieg. Die Flüssigkeit fuhr wie eine Stichflamme die Kehle hinunter und trieb ihm augenblicklich die Tränen in die Augen. Er keuchte, würgte und hustete.
„Was ist?“, fragte Magdalena besorgt. Im Hintergrund erklang wieder dieses Kichern. Verflixt noch mal, jetzt stand ihm auch noch das Wasser in den Augen.
„Was haben Sie mir da gegeben?“
Magdalena fasste nach dem Becher und schnupperte. „Schnaps. Ziemlich hochprozentig, so wie der riecht.“
„Der vertreibt die Kälte aus den Knochen“, sagte die alte Frau. Dann griff sie nach Wilhelms rechter Hand. Wieder fuhr der dunkle Finger die Linien ab. Sie murmelte etwas, ihre Stimme klang plötzlich belegt. Aus dem Wageninneren kam eine schnelle Frage, sie antwortete leise.
„Was sagt sie?“, fragte Magdalena neugierig an Wilhelms Ohr.
„Ich verstehe sie nicht, sie spricht in ihrer Sprache.“
„Wir werden diese Sprache lernen müssen.“
Er nickte nachdenklich.
Magdalena beugte sich vor. „Was sehen Sie in seiner Hand?“
Die Zigeunerin blickte auf. Zum ersten Mal traf das Licht, das von hinten in den Wagen fiel, ihr Gesicht. Sie musste steinalt sein. Ihre Haut war dunkelbraun wie zu lange gebackenes Brot und von tiefen Runzeln durchzogen. Unter tief hängenden Lidern waren keine Augäpfel zu erkennen. Zwischen den eingefallenen Lippen klebte eine kurze, erloschene Pfeife, die sich auf und ab bewegte wie der Schwengel einer Pumpe. Schwere Silberringe baumelten auf ihren Schultern, sie hatten die Ohrläppchen zu langen Hautstreifen gedehnt. „Ich sehe seltsame Dinge. Ein gutes Herz, aber einen schwachen Mann. Ich sehe Freud und Leid für uns aus deinem Schicksal erwachsen.“
Er zog seine Hand weg und steckte sie in die feuchte Manteltasche. Im vorderen Teil des Wagens tuschelte jemand aufgeregt. Wilhelm erkannte jetzt zwei Frauen mit langen schwarzen Zöpfen und einige nackte Kinder, die ihn anstarrten.
Magdalena gab ihm den Becher mit dem Schnaps zurück und streckte der Frau ihre Hand entgegen. „Sagen Sie mir, was Sie in meiner Hand sehen.“
Die Alte mümmelte an der kalten Pfeife und beugte sich über Magdalenas Handfläche. Wilhelm wurde bange, er war in Versuchung, die dunklen Finger wegzuschlagen, weg von der kleinen weißen Hand seines Lenchens.
„Ich sehe ein gutes Herz und Kinder, viele Kinder.“
Magdalena lachte und klopfte sich sacht auf den Bauch. „Ja, das wird stimmen.“
Die Alte hob den Kopf. Unter den faltigen Lidern blitzten für einen Moment Augen wie feuchte Kohlenstücke hervor. „Fremde Kinder, unglückliche Kinder!“
„Jetzt ist es genug mit dem Firlefanz!“ Besorgt sah Wilhelm in Magdalenas erschrockenes Gesicht. Er schob die Hand der Alten weg und nahm noch einen Schluck aus dem Becher. Jetzt, wo er darauf vorbereitet war, schmeckte das Zeug gar nicht so schlecht. Und warm wurde ihm, warm und wohlig. „Komm trink auch etwas. Das wärmt schön.“
Magdalena nippte ein wenig und schüttelte sich. „Brrr!“
„Ist guter Schnaps“, sagte die Alte, „der alte Löschhorn macht den besten Schnaps weit und breit.“
„Löschhorn?“, fragte Magdalena und rang nach Atem.
„Mein Mann, der bulibasha“, verkündete die Alte stolz.
Sie verstand nicht, was die Frau meinte, aber sie nickte.
Der Wagen ruckelte eine lange Steigung hinauf. Die beiden jungen Frauen und die Kinder sprangen hinaus in den Regen, griffen in die Speichen und halfen dem keuchenden Pferd. Wilhelms Körper neben Magdalena wurde schwer, sein Kopf sank auf ihre Schulter. Er war eingeschlafen.
„Sehr guter Schnaps“, sagte Magdalena und die Alte lachte und zeigte ihren zahnlosen Kiefer.
Nach einer Weile drohten auch Magdalenas Augen zuzufallen, als die Alte sie an der Schulter fasste und vorn aus dem Wagen wies. Sie hielten an einer Wegscheide, links von ihnen streckte sich eine Häusergruppe an einem Bergrücken entlang wie ein sich rekelnder Kater. Erstaunt beugte sie sich nach vorn. Ein solch ordentlich angelegtes Dorf hatte sie noch nie gesehen. Die Gebäude reihten sich beidseitig des Weges, der weiter den Berg hinaufführte. Sie sahen alle gleich aus, wie die Holzquader aus einem Baukasten. Rote Ziegeldächer, darunter Fachwerk, zwei Fenster nach vorn zur Straße, zwischen den Häusern je ein Tor, durch das höchstens ein Ziegenfuhrwerk passte. Aus den parallel aufragenden Schornsteinen drängte heller Rauch dem Regen entgegen.
„Ist das Friedrichslohra?“
Die Alte nickte. „Die Leute hier nennen es das Neue Dorf. Sie benutzen den anderen Namen nicht.“
Magdalena rüttelte Wilhelm an der Schulter wach. „Schau, unser Dorf!“
Er blinzelte, sein Atem roch nach Schnaps.
Die Wagen vor ihnen bogen vom Weg ab. Christoph Weiß steckte den Kopf in den Wagen. „Ihr müsst jetzt aussteigen. Meine Brüder werden euer Gepäck tragen.“
Wilhelm taumelte, als er nach einem gewagten Sprung vom Wagen auf dem schlammigen Wegrand landete. Er half Magdalena herunter, die sich winkend von der alten Frau verabschiedete. Sie zog ihr Kopftuch fester, der Regen hatte nicht nachgelassen. Vier halbwüchsige Jungen standen barfuß am Weg und sahen ihnen abwartend entgegen. Aus ihren schwarzen Locken tropfte das Wasser. Wilhelm erinnerte sich plötzlich an die Warnung der Handelsreisenden und musterte hastig die Gepäckstücke. Zwei Kisten, ein Koffer, es schien nichts zu fehlen.
„Wohin wollt ihr?“, fragte der größere der Jungen in klarem Deutsch.
„Zum Pfarrhaus!“
Sie griffen nach dem Gepäck und setzten sich in Bewegung. Magdalena und Wilhelm hatten Mühe, ihnen zu folgen. Als Magdalena über die Schulter zurückblickte, schwankte gerade der letzte bunte Planwagen den Feldweg entlang und verschwand hinter einer Reihe von Weißdornbüschen.
Nach wenigen Minuten erreichten sie die schnurgerade Dorfstraße. Es ging bergauf, was die schwer schleppenden Zigeunerjungen nicht bremste. Sie trugen die Kisten zwischen sich und nahmen die gesamte Straßenbreite ein.
Die kleinen Häuser blickten mit hohläugigen Gesichtern auf die Neuankömmlinge. Die Fachwerke waren schlicht und solide, aber ohne besondere Kunst angelegt, das Mauerwerk dazwischen war grob verputzt und an einigen Hausfronten frisch gekalkt. Vor einem auffallend schäbigen Haus setzten die Jungen das Gepäck ab und klopften an ein Fenster. Die Fassade war grau, von den Fachwerkbalken blätterte die Farbe. Niemand hatte sich die Mühe gemacht, den Straßenschlamm vom Sockel abzuwaschen. Einer der Träger rief etwas und lachte. Dann zeigte er auf sie. Hinter der Fensterscheibe drängten sich mehrere dunkle Schöpfe, schwarze Augen starrten Wilhelm und seine Frau neugierig an.
„Hier wohnen Zigeuner“, flüsterte Magdalena, als fürchte sie, die Häuser hätten Ohren.
Wilhelm nickte. „Der Herr Gerichtsrat Göschel meinte, dass die Familien sich für den Winter bei den Dorfbewohnern einmieten.“
Sie waren auf einer Hochfläche angelangt, wo sich die Straße zu einem Dorfanger weitete, bevor sie an dessen Ende erneut leicht anstieg. Rechts von ihnen stand ein etwas größeres Haus mit einer breiten Eingangstür in der Mitte. Eine Mauer aus großen, glatt behauenen Kalksteinen stützte den Sockel. Wilhelm kletterte hinauf und schaute durch ein Fenster.
„Eine Schule!“, rief er begeistert.
„Was tust du da?“, fragte Magdalena und sah sich beschämt um. „Du kannst doch nicht einfach …“
„Hab ich doch gleich gesehen, dass das kein Wohnhaus ist“, beschwichtigte er und sprang von der Mauer.
„Aber der Lehrer wohnt doch sicher hier?“, fragte Magdalena.
Neben dem Schulhaus öffnete sich ein leicht ansteigender Platz mit einem kreisrund ummauerten Brunnen, dahinter duckte sich eine schäbige Kirche aus groben Feldsteinen an den Berg. Zwei Fensterscheiben fehlten, die Löcher waren provisorisch mit Werg oder Hanf zugestopft. Der runde Dachreiter hatte dem Gewicht der Glocke anscheinend nicht mehr standgehalten und war halb eingestürzt. Die Glocke lag seitlich auf dem First, verkeilt in zerbrochenen Ziegeln und gesplitterten Holzbalken. Eine mit grüner Patina überzogene Wetterfahne baumelte über dem Fiasko und zeigte anklagend nach unten.
Gegenüber fiel der Anger steil ab und endete an einem größeren Fachwerkhaus, über dessen Eingang ein Wirtshausschild im Wind schaukelte. Das Nebengebäude, wohl das Backhaus, wurde von einem turmhohen Schornstein überragt.
Die Zigeunerjungen bogen nach rechts ab und steuerten ein Haus an, das halb hinter der Kirche versteckt lag und aus den gleichen Kalksteinen errichtet war. Es befand sich in einem ähnlich schlechten Zustand wie die Kirche. Zwei Fenster schienen neu, allen anderen und der Haustür fehlte die Farbe, die Gartentür hing schief in den Angeln und quietschte erbärmlich. Aus der Dachtraufe lief das Regenwasser in mehreren dünnen Rinnsalen in den Vorgarten, an der Giebelseite waren einige Fachwerke bereits herausgefallen, und mit Lumpen zugestopft.
Das Pfarramt, dachte Wilhelm. Er hatte plötzlich ein komisches Gefühl, doch bevor er darüber nachdenken konnte, überschlugen sich die Ereignisse. Die wacklige Tür des Hauses sprang auf und ein kleiner dicker Mann in einem Anzug, der ihm schon längst zu eng geworden war, schoss heraus wie eine Kanonenkugel. Seine Jacke stand weit offen, die Hose wurde von derben Hosenträgern gehalten, es schien, dass der Hosenbund diese Aufgabe nicht mehr leisten konnte. Eben dieser wurde von einem überquellenden Bauch verdeckt, über dem sich die Falten eines schmutzigen Leinenhemdes bauschten.
„Was wollt ihr schon wieder, Diebespack? In meinen Vorgarten scheißen, was?“, schrie der Mann und lief mit erstaunlicher Schnelligkeit auf die Jungen zu. „Verschwindet!“
Die Jungen stellten seelenruhig Kisten und Koffer ab und wichen dem Hin und Her springenden Sonderling aus, als würden sie das alle Tage tun. „Was ist das für Zeug? Etwa Diebesbeute? Was wollt ihr damit bei mir?“ Er bückte sich und griff sich ein paar Steine. Nun erst drehten sich die Jungen um und stoben in verschiedene Richtungen davon. Das Gepäck stand verlassen im Regen.
Wilhelm und Magdalena waren mit wenigen Schritten heran. Magdalena stellte sich schnaufend vor den Koffer und sah sich ratlos um. Der Dicke ließ die Arme sinken.
„Und wer sind Sie?“, fragte er unfreundlich.
Wilhelm trat auf ihn zu und deutete einen hastigen Diener an. Als er sich wieder aufrichtete, musste der Mann zu ihm heraufsehen, was seinen Blick noch etwas boshafter werden ließ. „Blankenburg ist mein Name, Wilhelm Blankenburg. Das ist meine Frau Magdalena.“ Wilhelm machte aus lauter Gewohnheit eine weitere Verbeugung, obwohl ihm dabei jedes Mal das Wasser in den Mantelkragen lief und der Mann so viel Ehrerbietung sicher nicht verdient hatte.
„Ja und?“
„Darf ich fragen, wer Sie sind, mein Herr? Pastor Blume erwartet mich. Ich bin der Missionar aus Naumburg. Er schrieb mir, wir könnten im Pfarrhaus wohnen.“
„Blümchen?“ Der Mann musterte Wilhelm und lachte dann laut auf. „Na dann, viel Spaß beim Weitermarschieren. Das evangelische Pfarramt ist in Wenden.“
Nach einer vagen Armbewegung in Richtung der ansteigenden Dorfstraße drehte er sich auf dem Absatz um, eilte durch den vom Unkraut überwucherten Vorgarten und verschwand hinter der Haustür.
Wilhelms Blick schweifte über ihre Gepäckstücke und blieb mutlos an Magdalenas verdutztem Gesicht hängen.
„Was?“, stammelte sie und setzte sich auf den Koffer.
„Das hier ist eine katholische Kirche. Ich hatte gleich so ein komisches Gefühl. Der Glockenturm sieht gar nicht evangelisch aus“, erklärte er.
„Er sieht überhaupt nicht aus wie ein Glockenturm. Eher wie ein verlassenes Storchennest. Mir ist kalt. Was machen wir jetzt?“ Der hölzerne Koffer unter ihr knarrte.
Er blickte den Weg hinauf. Erneut reihten sich kleine Fachwerkhäuser aneinander, bis eine leichte Rechtskurve die Sicht nahm. Die Straße wirkte wie eine perfekte Kopie des hinter ihnen liegenden Stückes. Nichts deutete auf eine weitere Kirche oder ein Pfarrhaus hin. Unmöglich, das Gepäck auch nur zwei Häuser weiter zu tragen, ebenso wenig konnten sie es hier einfach stehen lassen. Sein Blick fiel auf das Wirtshaus am unteren Ende des Angers.
Er deutete hinab. „Ich besorge uns einen Wagen.“ Während er den Koffer zum Haus schleppte, wartete Magdalena bei den Kisten. Der Wirt öffnete ihm die Tür, er hatte ihn wohl durch das Fenster kommen sehen. „Zimmer habe ich nicht zu vermieten“, sagte er statt einer Begrüßung.
„Oh, nein. Ich brauche nur einen Wagen, damit wir zu Pastor Blume fahren können. Die Zigeunerjungen haben uns versetzt.“
Der Mann nickte, als wäre das selbstverständlich und schleifte den Koffer in die Gaststube. Hier saßen drei Männer an einem Tisch und rauchten. Vor ihnen standen halb volle Biergläser. Stumm schauten sie zu, wie Wilhelm das Gepäck in die Ecke schob.
Magdalena rümpfte die Nase, als sie kurz darauf die rauchige Wirtsstube betrat, doch der Ofen mit dem laut knisternden Feuer darin versöhnte sie sofort. Sie nickte den erwartungsvoll schweigenden Männern zaghaft zu und zog sich einen der derben Holzstühle neben die Wärmequelle.
„Häng deinen Mantel zum Trocknen über die Lehne“, riet ihr Wilhelm besorgt.
„Kümmere dich lieber um das Fuhrwerk, ich komme schon zurecht“, antwortete Magdalena.
„Wo bekomme ich wohl einen Wagen zum evangelischen Pfarrhaus?“, fragte Wilhelm die Männer.
Einer von ihnen, ein kräftiger Mann mit Stiernacken und grau gelocktem Haar, nahm einen tiefen Schluck aus seinem Bierglas und deutete dann auf das Gepäck in der Ecke: „Für das da?“
„Ja.“
„Ich habe zwei junge Ziegenböcke im Stall. Kostet aber eine Runde.“
„Gerne.“ Wilhelm war froh, nicht sofort wieder hinaus in den Regen zu müssen. Er bestellte vier Bier und drei Schnäpse und einen Tee für seine Frau. Der Wirt zapfte mürrisch das Bier und schenkte aus einer dunklen Flasche ein.
„Trinken Sie keinen?“, fragte der Mann, der ihm seine Böcke angeboten hatte.
„Nein, ich hatte eben schon starken Schnaps von den Zigeunern. Das reicht für heute. Ich muss dem Pastor Blume mit klarem Kopf gegenübertreten.“
Die Männer nickten. „Sie brennen ein gutes Zeug, diese Tatern. Das kann einen schon umhauen“, sagte einer von ihnen und griff nach einem Päckchen Tabak.
Magdalena bekam ihren Tee.
„Prost! Auf meine Ziegenböcke!“, rief der Stiernacken.
Als der Wirt mit den Bierkrügen kam, waren die Schnäpse alle. „Bring noch mal ‘ne Runde, mach für dich einen mit und auch für unseren jungen Gast hier.“
„Nein, wirklich, ich muss zum Pastor. Wie weit ist es bis Wenden?“
„Ach, das ist nur ein Steinwurf. Wärm dich erst mal auf, Junge, du bist nass wie eine gebadete Katze.“
Tatsächlich fröstelte Wilhelm, sein Hemd fühlte sich klamm an.
Der Mann mit dem Tabak stopfte sich sorgfältig eine Pfeife. „Was willst du beim Pastor?“, fragte er.
Wilhelm zögerte ein wenig bei dieser direkten Frage, doch wenn er in diesem Dorf leben und arbeiten wollte, war er auf das Wohlwollen seiner Bewohner angewiesen. „Ich werde dort wohnen, mit meiner Frau.“ Er deutete zum Ofen, wo sie sich an die Kacheln lehnte und mit beiden Händen ihre Teetasse umschloss. „Wir sollen uns hier um die Zigeuner kümmern, im Auftrag des Missionsvereins Naumburg.“
Der Mann hielt ein brennendes Streichholz an den Pfeifenkopf und nahm einen tiefen Zug. Seine Wangen wölbten sich nach innen, seine Augenbrauen schoben sich wie zwei dicke Raupen in Richtung Nasenwurzel. Zwei oder dreimal paffte er angestrengt, dann blies er den Rauch gegen die Balkendecke. „Schon wieder“, sagte er und schüttelte den Kopf. „Wann kapieren die Herren endlich, dass es verlorene Mühe ist?“
„Wieso schon wieder?“, fragte Wilhelm verdutzt.
„Wie lange ist es jetzt her, Andreas?“, rief der Pfeifenmann. „Zwei Jahre?“
„Trudchen war kurz vorher geboren“, rief der Wirt vom Tresen herüber. „Frühjahr ‘28.“
„Sag ich doch. Gut zwei Jahre. Da kamen zwei junge Missionare, Zwillingsbrüder waren das. Man wusste nie, welchem man gerade begegnet war. Sie blieben ein paar Wochen, dann waren sie wieder verschwunden.“
„Es hat sich nichts geändert“, sagte der Stiernacken. Er sprach gemächlich, als wäre seine Zunge geschwollen. Er winkte dem Wirt. „Bring noch einen!“
„Was haben sie in dieser Zeit getan?“, fragte Wilhelm.
„Geredet. Sie sind zu den Igelfressern gegangen und haben mit ihnen geredet.“ Der dritte Mann mischte sich zum ersten Mal in das Gespräch ein. Er war weißblond und sehr blass, hinter den Qualmwolken der Pfeife verschwand er beinahe.
„Worüber haben sie geredet?“, fragte Magdalena vom Ofen her.
Er warf ihr einen schnellen Blick aus wässrig blauen Augen zu, bevor er wieder in sein Bier starrte. „Was weiß denn ich? Was Kirchliches sicherlich, sie sollten ihre Kinder taufen lassen. Und arbeiten gehen.“
Der Pfeifenmann lachte. „Der alte Löschhorn hat sie schön an der Nase herumgeführt, nicht wahr, Linzer? Er hat seinen Weibern erklärt, wenn sie die Bälger taufen lassen und sich Paten aus dem Dorf suchen, gibt es reichlich Geschenke. Na, das musste er nicht zweimal sagen.“
„Also sind die Kinder getauft worden?“, fragte Wilhelm.
„Ja aber“, lallte der Stiernacken. „Beinahe jeder aus ‘m Dorf, der nich grade selbst am Hungertuch nagt, hat inzwischen ‘nen Igelfresser als Patenkind.“ Er lehnte sich über den Tisch und raunte halblaut: „Kannst ja schlecht nee sagen, wenn se dich fragen. Is schließlich Christenpflicht, so ‘n Patenamt.“ Er lachte und zeigte auf den blassen Mann gegenüber, den sie Linzer genannt hatten. „Selbst sein Vater, der stolze Österreicher, der sonst keinen Finger rührt, wenn nicht ein Heller dabei herausspringt.“
„Aber arbeiten tun die nie und nimmer, da kannste ihnen sonst was versprechen“, ergänzte sein Kumpan und klopfte die Asche aus der Pfeife.
„Ssstimmt“, sagte der Stiernacken, dann sackte sein Kopf auf den Tisch.
Magdalena sprang auf. „Wir müssen ins Pfarramt.“
Ihr besorgter Unterton alarmierte Wilhelm. Kläglich blickte er auf den grauen Lockenschopf, der zwischen zwei Bierkrügen ruhte. „Wo krieg ich jetzt ein Fuhrwerk her?“
Die beiden anderen Männer blickten sich an und grinsten. „Andreas, der Herr Missionar möchte zahlen!“, rief der Zigarrenmann.
Der Wirt kam und verlangte die stolze Summe von zwanzig Groschen, bei der Wilhelm erneut das Herz in die Hose rutschte. Davon hätten er und Lenchen Brot und Milch für eine ganze Woche kaufen können.
„Was ist?“ Der Wirt klopfte ihm auf die Schulter. „Kannst auch anschreiben lassen, Junge, ich weiß ja, wo du wohnst.“
„Nein, nein.“ Hastig kramte Wilhelm seinen Beutel aus der Jackentasche. Ein paar Pfennige Trinkgeld machten den Wirt hilfsbereit. „Lass das Gepäck ruhig hier stehen, das kannst du morgen früh abholen. Ich gebe euch eine Laterne mit.“
Draußen war es bereits dunkel, der flackernde Lichtkreis der Petroleumlampe tastete sich den Dorfanger hinauf. Magdalena hielt die Lichtquelle am vorgestreckten Arm, mit dem anderen hakte sie Wilhelm unter. Sie hatte geglaubt, bei ihm Halt zu finden auf dem vom Regen aufgeweichten Platz, doch bald merkte sie, dass er an der frischen Luft Probleme mit dem Gleichgewicht hatte.
„Liebe Güte, Wilhelm, du bist betrunken“, schimpfte sie leise. „Was soll denn der Herr Pastor von uns denken?“
Inzwischen hatten sie die Dorfstraße erreicht, die zwischen den dicht stehenden Häusern hindurch schnurgerade in Richtung Wenden führte. Das jedenfalls hatte der Wirt ihnen versichert. Das alte Wendendorf sei voller Bauernhöfe, die keineswegs mehr so geordnet lägen wie die Handtuchgrundstücke im Neuen Dorf, aber wenn sie nur immer dieser einen Straße folgen würden, kämen sie direkt zum Pfarrhaus, das sie an der davor stehenden Eiche erkennen würden.
Die Straße kam Magdalena enger vor als vor wenigen Stunden im Tageslicht, es war, als würden die Häuser im Dunkeln zusammenrücken, um sich nachts die Geheimnisse ihrer Bewohner zuzuraunen. Wie Totenschädel starrten sie auf die beiden einsamen Fußgänger herab, nur einzelne Fassaden sandten, mit warmem Lichtschein aus den Fenstern, ein freundliches Lächeln für die Ankömmlinge.
Sie hatte sich gefragt, wie sie im Stockfinsteren eine Eiche erkennen sollten, aber jetzt zeigte sich, dass ihre Probleme ganz anderer Art waren. Wie vermochte sie ihren wankenden Mann am rechten Arm und die blakende Funzel am linken unbeschadet bis in dieses Bauerndorf bringen? Sie versuchte, sich abzulenken, indem sie in die wenigen beleuchteten Stuben der Dörfler blickte, an deren Fenstern sie vorüber stolperten. Immerhin hatte es aufgehört zu regnen und sie konnte ihr Kopftuch in den Nacken schieben. Wilhelm hatte darauf bestanden, wenigstens den Koffer mitzunehmen. Der schlug jetzt wiederholt gegen sein Schienbein und brachte ihn zum Straucheln. Magdalena seufzte. Sie würde auf ihn aufpassen müssen. Schon am ersten Abend hatten sie ihn gnadenlos über den Tisch gezogen.
Er stellte den Koffer ab, was ein leises Schmatzen im Matsch erzeugte und streckte den Rücken. Im Haus neben ihnen weinte ein Kind. „Ich schätze, die haben mich ausgetrickst“, sagte er kleinlaut.
Durch das Fenster sahen sie eine Frau frische Scheite in den Ofen legen. Der Schein der Flammen leuchtete aus der Ofentür hinaus auf die Straße und geradewegs in Wilhelms zerknirschtes Gesicht. Er sah aus wie ein Schauspieler auf der Bühne, der nicht wusste, in welchem Stück er gerade spielte.
„Macht nichts“, tröstete Magdalena, „das zahlen wir ihnen irgendwann heim. Jetzt komm weiter. Ich fürchte, wir werden den Pastor aus dem Bett klopfen müssen.“
Als die Häuserzeile endete, führte die Straße ein Stück über freies Land und sie rochen frisch gepflügte, feuchte Erde. Dann tauchten die ersten Bauernhöfe im Lampenlicht auf. Breite Holztore zwischen Steinmauern wirkten wie Höhleneingänge und atmeten den Gestank der Misthaufen aus. Die Häuser der Bauern duckten sich hinter den Kalksteinmauern und ließen keinen Lichtschimmer hinaus in die Nacht. Nur die Petroleumlampe und das Gekläff der aufgescheuchten Hunde zeigten ihnen den Weg. Glücklicherweise hatte Wilhelm sich inzwischen einigermaßen vom Schnaps erholt, denn den Koffer über den zerfahrenen Weg zu schleppen, erwies sich zunehmend schwierig. Seine Armmuskeln brannten und sein Rücken schmerzte. Wenigstens ging es jetzt leicht bergab. Die Straße wand sich nach links um einen Hof herum. Noch immer hatten sie keine Eiche gesehen.
„Und wenn wir schon vorbei gelaufen sind?“, stellte Magdalena die Frage, die ihm bereits einige Zeit durch den Kopf ging, ohne dass er sie ausgesprochen hatte. Seit die Wirkung des Alkohols nachließ, quälten ihn Halsschmerzen, die prompte Reaktion seines Körpers auf die Kälte und die nasse Kleidung.
Während er überlegte, was er Magdalena antworten sollte, blieb diese abrupt stehen. Der Koffer schlug gegen sein Schienbein, als sie an seinem Arm zerrte.
„Sieh doch, dort vorn!“
Aus der feuchten Dunkelheit schälte sich die kahle Krone eines Baumes. Wilhelm bückte sich, hob ein Blatt auf und hielt es in den Lichtkegel der Lampe. Gottlob, es war ein Eichenblatt! Am Rande des Platzes leuchtete anheimelnd ein einzelnes Fenster in einem freistehenden Haus ohne Zaun und ohne Mauer.
„Das muss es sein“, sagte Magdalena voller Inbrunst, mit der sie ihrem Wunsch, endlich angekommen zu sein, Nachdruck verleihen wollte.
„Zum Glück brennt noch Licht.“ Er stellte den Koffer mit einem leisen Seufzer ab und klopfte an die Doppeltür aus derben Holzbohlen. Es geschah nichts. Die Stille im Haus und in der Straße war erdrückend, selbst die Hunde schwiegen jetzt, als gäbe es unter ihnen eine geheime Absprache. Wilhelm klopfte noch einmal. Wieder nichts. Von dem Baum hinter ihnen tropfte Regenwasser in die Pfützen.
Schließlich hämmerte Magdalena mit der Faust an das Holz, dass die gesamte Tür in ihren Angeln erbebte. Wilhelm schnappte nach Luft, doch der Erfolg gab ihr recht. Aus dem Haus kamen die Geräusche schlurfender Schritte und das Murmeln einer Männerstimme. Ein Schloss klackte und kurz darauf fiel das Licht einer flackernden Kerze auf die beiden Reisenden. Sie wurde von einem Mann gehalten, der sie verwirrt anblinzelte. Über seine rechte Wange zogen sich Druckstellen, sein schütteres Haar hing ihm unordentlich über das Ohr. „Sind Sie der Missionar?“, fragte er unfreundlich, bevor Wilhelm etwas sagen konnte. „Ich habe Sie früher erwartet.“
„Ja, Wilhelm Blankenburg ist mein Name. Das ist meine Frau Magdalena. Es gab Schwierigkeiten mit …“
„Kommen Sie erst mal rein.“ Der Mann öffnete die Tür weiter und trat beiseite. „Möchten Sie etwas essen? Wir hatten zu Abend mit Ihnen gerechnet, nun ist das Mahl natürlich kalt.“
„Oh, bitte keine Umstände! Das ist völlig in Ordnung. Wie gesagt, wir wären schon früher …“
„Meine Frau ist inzwischen zu Bett gegangen. Das würde ich auch gern tun. Da hinten ist die Küche. Das Essen steht auf dem Tisch. Diese Treppe rauf, erste Tür rechts, dort befindet sich Ihre Schlafkammer. Morgen, gleich in der Frühe, muss ich nach Nordhausen, die Kutsche geht um neun. Ich nehme an, Sie wollen mich begleiten?“
„Ja, gern. Der Landrat von Arnstedt erwartet mich.“
„Na dann, eine gute Nacht!“ Er drückte Wilhelm die blakende Kerze in die Hand und verschwand im Dunkel des Treppenhauses.
Wilhelm und Magdalena sahen sich eine Weile sprachlos an. Sie fasste sich als Erste. „Komm, ich habe Hunger.“ Sie zog ihn in die von ihrem Gastgeber beschriebene Richtung. Nach dem kargen Empfang erschien ihnen der gedeckte Tisch mehr als üppig. Eine gebratene Schwartenwurst kringelte sich neben dicken Brotscheiben. Wilhelm schnupperte an einer Schüssel, in der helle Gemüsestücke in einer gelben Soße schwammen. „Kohlrabi“, brummte er genießerisch.
Während er zwei Teller füllte, sah Magdalena sich in der Küche um. Neben dem stabilen Tisch in der Mitte des Raumes mit vier derben Holzhockern gab es einen Schrank, der mit kleinen gehäkelten Gardinen hinter grünen Glasscheiben Gemütlichkeit ausstrahlte. Gleich neben der Tür stand ein großer weißer Herd mit einer glänzend gewienerten Platte. Ein Wasserkessel in der Ecke weckte Appetit auf frischen Tee, doch das Feuer war heruntergebrannt.
Wilhelm hatte eine Schüssel mit Käse entdeckt und begann die Wurst zu zerschneiden. „Komm, setz dich.“
„Ich habe Durst.“
„Hier ist Wasser im Krug.“
„Werden wir lange hier wohnen?“, fragte Magdalena und musterte das Besteck mit den hölzernen Griffen.
„Nein. Wir sollen ein Haus in Friedrichslohra beziehen. Der Landrat wird mir morgen die Papiere ausstellen. Es hieß, wir bekämen Möbel und Hausrat.“
„Mmh.“
„Was ist?“
Sie schob ihren Kopf über den Tisch und flüsterte zwischen zwei Bissen: „Ich finde diesen Pastor unheimlich. Ich möchte hier nicht länger bleiben.“
„Sobald das Haus bezugsfertig ist, sind wir hier weg. Es dauert sicher nur ein paar Tage.“
Der erste Hahnenschrei weckte Wilhelm aus einem schweren Traum, den er sofort vergessen hatte, als er die Augen aufschlug. Nur das ungute Gefühl steckte noch in seiner Brust und schnürte ihm die Luft ab. Er keuchte. Eine eiserne Hand krallte sich um seinen Hals. Die Bettdecke war nass von seinem Schweiß, seine Stirn glühte.
„Lieber Gott, warum gerade jetzt?“, stöhnte er leise und schluckte krampfhaft. Es fühlte sich an, als hätte er heißen Sand im Kehlkopf. Im Untergeschoss rumorte es, er hörte eine Männerstimme. Er musste zur Postkutsche! Wie spät mochte es sein? Noch war es finster draußen, doch er hatte keine Vorstellung, wie lange sie bis zur Poststation brauchen würden. Er tastete nach dem Nachttisch, auf dem seine Taschenuhr lag. Da fiel ihm ein, dass sie zwar eine Kerze, aber keine Zündhölzer hatten, um sie anzuzünden. Vorsichtig kroch er unter dem schweren Federbett hervor und tastete mit den Füßen nach seinen Schuhen. Seine Knochen schmerzten, als wäre er unter Pferdehufe geraten. Unsicher erhob er sich und trat gleich beim ersten Schritt in das Nachtgeschirr, das sie vorm Schlafengehen beide benutzt hatten, da sie nicht wussten, wo sich der Abort befand. Kalter Urin schwappte über seine Füße.
„Was, oh Herr, willst du mir sagen?“, entfuhr es ihm und er hob das Gesicht zur Zimmerdecke.
„Wilhelm?“ Hinter ihm regte sich Magdalena schlaftrunken. „Fluchst du etwa?“
„Schlaf weiter“, krächzte er, „ich bin ins Nachtgeschirr getappt.“
„Oh nein.“ Das Bett quietschte, als sie sich aufsetzte. „Puh, jetzt kann ich es riechen.“
„Ich gehe hinunter und hole Eimer und Lappen. Und Zündhölzer.“
„Wilhelm? Was ist mit deiner Stimme?“
Doch er war schon zur Tür hinaus.
Magdalena griff vom Bett aus nach ihren Sachen und kleidete sich an, ohne die Füße auf den Boden zu setzen. Nur kurze Zeit später schob sich eine kleine Frau mit einem Eimer in der Hand zur Tür hinein. Alles an ihr war grau im Licht der Kerze, die sie vor sich hertrug: Die streng zurückgekämmten Haare, der Kittel um ihren schmalen Leib, selbst ihr Gesicht hatte die Farbe von staubigen Steinen. Ihre Augen lagen tief im Schatten, doch es schien Magdalena, als musterten sie böse den nassen Fleck vorm Bett.
„Guten Morgen, es tut mir leid, aber wir hatten kein Licht. Bitte stellen Sie den Eimer ab. Ich mache das, wirklich, ich mache das selbst.“ Die Worte purzelten aus ihr heraus, sie hoffte nur, dass die Frau einfach wieder gehen würde. Doch die schien sie gar nicht zu hören, der Eimer knallte auf die Dielen und sie brachte die Kerze zum Nachttisch. Da erst zuckte sie zusammen, als sie Magdalena in ihren Kleidern auf dem Bett sitzen sah. Ihr Mund verzog sich zu einem Lächeln, das wohl freundlich aussehen sollte, aber irgendwie schrecklich misslang. Was stimmte nicht mit diesem Gesicht? Das Licht der Kerze flackerte im Luftzug, der durch die offene Tür kam und brachte die Gesichtszüge zum Tanzen. Hastig wandte die Frau sich ab und wrang den Lappen aus, der im Wasser schwamm.
„Hören Sie doch!“ Magdalena schwang die Beine aus dem Bett. Jetzt konnte sie die Pfütze sehen und ihr ausweichen. Sie fasste nach dem Arm im grauen Kittel, um ihr den Lappen aus der Hand zu nehmen. Die Frau fuhr erschrocken herum und Magdalena sah plötzlich überdeutlich, was an dem Lächeln nicht gestimmt hatte. Eine Hasenscharte teilte die Oberlippe der Frau und verlief bis in ihre Nase. Sie zögerte nur einen Moment, hoffte, dass die andere es nicht als Entsetzen deutete und griff nach dem Tuch.
„Ich mache das, geben Sie mir den Lappen!“
Sie bemerkte, dass die kleine graue Frau ihr konzentriert auf den Mund sah, und begriff plötzlich. Sie las ihr die Worte von den Lippen ab. Jetzt nickte sie, drehte sich um und verschwand eilig zur Tür hinaus, wo sie fast mit Wilhelm zusammenstieß.
„Der Pastor sagt, seine Frau ist taubstumm.“
„Das hab ich gemerkt.“ Sie zog das Wischtuch über die Dielen und rümpfte die Nase. „Du klingst erkältet.“
„Ja, ich glaube, ich habe Fieber.“
„Dann leg dich wieder ins Bett! Den Termin beim Landrat kannst du doch gewiss verschieben.“
„Nein. Dann dauert es noch länger, bis wir hier rauskommen. Außerdem kann ich gleich Medizin besorgen.“ Er setzte sich auf den Bettrand und hob ihr die Füße entgegen. „Wisch mal über meine Schuhe.“
„Deinen Mantel muss ich ausbürsten. Der Saum ist voller Schmutz. Und die Hosenbeine auch. Kannst du im Koffer nach der Bürste sehen?“ Sie wrang den Lappen über dem Eimer aus. „Wie viel Zeit haben wir noch?“
„Eine Stunde. Hier ist keine Bürste.“
„Sie muss da sein. Warte, ich leuchte mit der Kerze.“
Sie wühlten den Koffer gründlich durch, vergeblich. „Sie ist sicher in einer der Kisten beim Wirt“, meinte Wilhelm schließlich.
„Ich weiß genau, dass ich sie hier drin hatte.“
„Egal, die Frau Pastor hat sicher eine Bürste für uns. Jetzt lass uns frühstücken gehen.“
Als es draußen hell wurde, rumpelte ein Leiterwagen vor das Pfarrhaus. „Blankenburg, kommen Sie“, sagte der Pastor, der außer einem Morgengebet während des Essens kein Wort von sich gegeben hatte, und stand vom Tisch auf. „Der Bauer nimmt uns bis zur Poststation mit.“
Magdalena hatte mit einer geborgten Bürste Mantel und Hose gründlich gesäubert. Nun war Wilhelm zwar adrett gekleidet, er sah jedoch trotzdem schlecht aus, seine Augen schimmerten glasig, sein Gesicht glühte. Besorgt beobachtete sie, wie er steifbeinig auf den Wagen kletterte. Der Bauer ließ die Peitsche knallen und bald verschwand das Fuhrwerk um die Ecke.
Gemeinsam mit der Frau des Pastors, die ihr Mann als Christine vorgestellt hatte, räumte sie den Tisch ab.
„Christine?“ Sie fasste sie am Arm, um ihre Aufmerksamkeit zu erlangen. „Können wir nach Friedrichslohra gehen und unser Gepäck holen? Es steht beim Kneipenwirt.“
Die Frau zögerte, dann nickte sie.
„Haben Sie einen Handwagen? Die Kisten sind schwer.“
Christine schüttelte erst den Kopf, überlegte kurz und nickte dann erneut. Sie zog Magdalena zum Fenster und zeigte auf den Bauernhof gegenüber. Dabei stieß sie ein paar gurgelnde Laute aus. Magdalena glaubte zu verstehen, dass sie vom Nachbarn einen Wagen bekommen würden.
Tatsächlich zogen sie bald darauf mit einem hölzernen Karren durch das Dorf, das sie nun bei Lichte in Augenschein nehmen konnte. Die schmale Straße wand sich in einer engen Kurve bergauf. Immer wieder mussten sie tiefen Pfützen ausweichen. Kein Wunder, dass ihre Kleider bis unter die Knie voller Schlamm gewesen waren. Mehrmals kamen ihnen Ochsenfuhrwerke entgegen. Die Bauern zogen die Kappe vom Kopf und grüßten, ihre Blicke voll Neugier. Ihr fiel auf, dass Christine den Kopf gesenkt hielt und schneller wurde, wenn ihnen jemand begegnete. Ein Holztor sperrte seinen Rachen auf wie ein gähnender Hund. Sie sah einen viereckigen Hof, begrenzt von einem lang gestreckten Fachwerkhaus, einer großen Scheune und einem weiteren Gebäude, in dem sie einen Stall vermutete. In der Mitte dampfte ein Misthaufen, auf dem dicke, weiße Hühner kratzten. In der hinteren Ecke bellte ein struppiger Köter und zerrte an seiner Kette.
Hinter dem letzten Hof begannen die Äcker. Ein Bauer folgte seinem Pferd, das mit kräftigen Schritten etwas übers Feld zog. Vielleicht war es ein Pflug, sie kannte sich mit diesen Dingen nicht aus und Christine konnte sie nicht fragen. Mehrere Frauen und Kinder liefen gebückt hinterher und sammelten zwischen Unmengen von hell leuchtenden Steinen runde Knollen in ihre Körbe, Kartoffeln, erkannte sie schließlich. Am Horizont erhoben sich die Harzberge, herbstgrau wie verschimmelte Brotlaibe. Links über dem Dorf streckte sich ein rotbraun gefärbter Wald auf einem Höhenzug, der die weitere Sicht in dieser Richtung versperrte. Die Luft war kühl, doch nicht kalt, sie roch würzig nach feuchter Erde und viel kräftiger als in Nürnberg. Es kam ihr vor, als müsse man hier weniger atmen, um genug Sauerstoff in die Lunge zu bekommen. Ein klein wenig Euphorie machte sich in ihrem Herzen breit.
Am Ende der Felder begann die eng bebaute Straße des Neuen Dorfes wie der Eingang zu einem Fuchsbau. Eines von diesen Häusern würde sie bewohnen.
„Christine? Wissen Sie, welches Haus wir beziehen sollen?“
Die kleine graue Frau schüttelte den Kopf.
„Können Sie mir zeigen, welche nicht bewohnt sind?“
Diesmal ein Nicken. Hinter den Häuserwänden hörten sie Kindergeschrei und klappernde Webstühle. In der Gosse tummelten sich ein paar Hunde. Bis zum Anger wies Christine auf drei Häuschen, denen man ansah, dass sie lange schon leer standen. Bröckelnder Putz, hohle Fenster ohne Scheiben, löchrige Dächer ließen Magdalenas Hochgefühl schnell abklingen. Es würde mehr Zeit brauchen, so eine Kate bewohnbar zu machen, als sie gedacht hatte.
Die Kneipe war verschlossen, selbst auf ihr Rufen und Klopfen öffnete niemand. Christine zog sie zum Nachbarhaus. Dessen hoher Schornstein stieß dicken weißen Rauch aus. Bereits vor der Tür schnupperte sie den Duft von aufgegangenem Brotteig. Das Backhaus war offen, der Kneipenwirt hockte vor dem Ofen, der den halben Raum einnahm, und schob dicke Holzscheite in die Feueröffnung. Auf einem langen Tisch an der Wand lagen Teigklumpen in Reih und Glied wie frisch gewickelte Säuglinge.
Als er sie sah, wischte er sich die rußigen Hände an seiner Schürze ab und neigte den Kopf. „Die Frau Pastor und die Missionarsfrau, einen guten Morgen zusammen.“ Sein Grinsen war unverkennbar ironisch.
Christine neben ihr schien noch weiter zusammenzuschrumpfen.
„Wir holen das Gepäck ab, bitte öffnen Sie uns den Schankraum.“
„Ich muss erst die Laibe in den Ofen schieben. Alles zu seiner Zeit.“ Er wies auf die bleichen Teigklumpen und machte eine wichtige Miene.
Magdalena erkannte, dass jetzt die Fronten geklärt werden mussten. „Ich bin sicher, die Brote haben mehr Zeit als wir. Das Gepäck zu holen dauert nicht lange, also bitte!“ Sie hatte so viel Schärfe in ihre Stimme gelegt, wie möglich und hoffte, dass er das leichte Zittern darin nicht gehört hatte. Der Wirt zuckte mit den Schultern, brummte und wies zur Tür. Das Backhaus schloss er sorgfältig hinter ihnen ab, an seinem Hosenbund baumelte ein großes Bündel Schlüssel.
Auf dem Anger lungerten mehrere halbwüchsige Zigeunerjungen herum.
„Verschwindet!“, rief der Wirt und fuchtelte mit der freien Hand, während er mit der anderen die Kneipentür aufschloss.
„Hast du ein Bier für uns?“, rief einer der Jungen.
„Wann sind die Brote fertig?“, fragte Magdalena.
„Gegen Mittag.“
„Lassen Sie zwei ins Pfarrhaus bringen.“
Er sah sie verdutzt an. „Ich lasse nicht bringen, Frau …“
„Blankenburg.“
„Hier holt sich jeder sein Brot selbst, Frau Blankenburg.“
Magdalena überlegte, wie sie den Kampf erneut gewinnen konnte. Sie winkte einem der Zigeunerjungen, den sie als einen der Gepäckträger vom Vortag erkannte. „Wie heißt du?“
„Christian Weiß, Herrin.“
„Gut, Christian, hör mir zu. Wenn die Brote hier fertig sind, holst du zwei ab und bringst sie nach Großwenden ins Pfarrhaus. Du bekommst als Lohn ein Viertel Brot.“
Der Junge nickte eifrig. „Gern, Herrin.“
„Ich bin Frau Blankenburg.“
„Ja, Herrin Blankenburg.“ Der Junge rannte davon.
„Sie werden schon sehen, wo Ihre Brote ankommen, Herrin Blankenburg.“ Der Wirt grinste höhnisch. Christine sah unzufrieden aus.
„Was bin ich Ihnen schuldig?“
„Einen Silbergroschen.“
Sie zahlte und schleppte mit Christine die Kisten zum Handwagen. Gemeinsam zogen sie den Wagen den Anger hinauf. Plötzlich war der Junge wieder da. „Herrin Blankenburg, soll ich dir den Wagen ziehen?“
Sie zögerte. Eigentlich schaffte sie das mit Christine bequem allein. Doch seine großen schwarzen Augen sahen sie treuherzig an. Und warum nicht, so lernte sie eines ihrer künftigen Schäfchen schon ein wenig kennen. Mit der stummen Pastorsfrau wurde der Weg doch recht lang. Also nickte sie. Christine schaute schon wieder missbilligend, doch Magdalena ignorierte das. Christian fasste nach dem Wagengriff und zog los.
„Nicht so schnell!“, rief sie. Aus den Augen verlieren wollte sie ihn auf keinen Fall. In der Nähe vom Anger war ihr schon auf dem Hinweg eine kleine Kolonialwarenhandlung aufgefallen. Hier hielten sie noch einmal an. Der Junge saß draußen auf dem Wagen, und Christine kaufte Lampenöl und Kernseife. Der Krämer, ein dicker Mann, der sie an den katholischen Pfarrer erinnerte, nahm ihr Geld entgegen, ohne sie anzusehen oder sich zu bedanken. Magdalena dagegen musterte er neugierig von der Seite. „Kann ich Ihnen mit etwas dienen, gnädige Frau? Vielleicht eine Tüte Tee aus Indien?“
Sie wehrte ihn höflich ab.
Nachdem sie mit dem Zigeunerjungen ihre Kisten bis in ihre Kammer getragen hatte, entließ sie ihn mit der Ermahnung, das Brot nicht zu vergessen.
Dann brachte sie den Wagen zum Nachbarn zurück. Die dicke Bäuerin nahm sie beiseite. „Junge Frau, bringen Sie die Tatern nicht mit nach Wenden. Sie klauen und betteln, das können wir hier nicht gebrauchen.“ Ihre feisten Wangen zitterten vor Entrüstung. Hinter ihr zerrte ein schwarzer Hofhund an der Kette und bellte.
„Aber der Junge hat mir nur den Wagen nach Hause gezogen.“
Die Frau drehte sich um und schnauzte den Hund an: „Sei still, Hasso!“ Dann fuhr sie fort: „Heute ist es dieses, morgen jenes. Sie werden sehen, die wird man nicht mehr los. Und wenn sie dann weg sind, fehlt immer was. Du kannst ihnen die Hand geben, aber zähl hinterher deine Finger, heißt es bei uns. Haben Sie schon nachgesehen, ob in Ihrem Gepäck alles beisammen war?“
„Ich muss jetzt gehen.“ Magdalena wollte nicht mit der Frau streiten.
„Warten Sie, nehmen Sie Ihren Schwiegereltern frische Kartoffeln mit, sind nur die kleinen, die rausgelesenen, aber die schmecken am besten. Schaben und einfach in Öl schwenken, schmeckt besser als jeder Sonntagsbraten.“
„Herr und Frau Pastor Blume sind nicht meine Schwiegereltern.“ Jetzt musste sie doch widersprechen.
Die Bäuerin, die auf dem Weg zur Scheune war, blieb stehen. „Nicht? Sind Sie nicht die Braut vom Ludwig?“ Der Hund begann, wieder zu bellen.
„Nein, ich bin die Frau vom neuen Missionar.“ Stolz rief sie den neuen Titel ihres Gatten über den Hof. Sie hatte bisher nicht oft Gelegenheit gehabt, ihn auszusprechen. Das klang viel besser als Schuhmacher oder Hauswart. Und verheiratet war sie auch, da brauchte die Alte gar nicht so vorwurfsvoll gucken. Sie faltete beide Hände vor sich, damit der Ehering deutlich zu sehen war. Sie bedauerte, dass ihr Bauch noch immer flach wie ein Brett war, obwohl sie bereits seit drei Wochen sicher wusste, dass sie schwanger war.
„Missionar?“ Das Scheunentor verschluckte die Frau, um sie gleich wieder auszuspucken. Sie trug einen kleinen Hanfsack, der einige Pfund Kartoffeln enthalten musste. Ihr Gesichtsausdruck war jetzt merklich kühler. „Viele Grüße an die Frau Pastor.“
Magdalena bedankte sich und warf den Sack wie ein Mann über die Schulter. Nachdem sie die Kartoffeln, die nicht größer waren als gelbe Pflaumen, in der Küche abgelegt hatte, lief sie hinauf in ihre Kammer. Die beiden Kisten standen verschlossen vorm Bett, es schien alles in Ordnung. Sie öffnete die Lederriemen und legte die Kleider aufs Bett. Bettwäsche hatte sie nur einmal mitnehmen können, aber ihre Mutter hatte versprochen, die Aussteuer nachzusenden, sobald das Haus bezugsfertig wäre.
„Ich muss Maman schreiben“, murmelte sie vor sich hin. Papier, Tinte und Federkasten lagen unten in der zweiten Kiste. Irgendwo musste die Kleiderbürste sein, doch auch in der anderen Reisekiste war keine Spur von ihr; wahrscheinlich würde sie beim Krämer eine neue kaufen müssen.
Als sie in die Küche kam, hatte Christine die Kartoffeln auf den Tisch geschüttet und lächelte glückselig. Es war kein hübscher Anblick, die Spalte in der Oberlippe klaffte weit auf und ließ rote Schleimhaut erkennen, wo andere Menschen weiße Zähne hatten. Doch das Strahlen der Augen, die sonst umher huschten wie kleine graue Mäuse, war schön anzusehen.
„Die hat mir die Bäuerin von gegenüber mitgegeben. Wir sollen sie schaben und in Öl schwenken.“
Christine nickte, schloss genießerisch die Augen und rieb sich den Bauch. Magdalena musste lachen.
Von der Straße hörten sie plötzlich Geschrei und Hundegekläff. Gleich darauf hämmerte es an die Haustür. Die beiden Frauen fuhren auf. Magdalena rannte zur Tür.
Als sie hastig öffnete, fiel Christian fast herein. „Herrin, das Brot.“ Er hielt in jeder Hand einen Laib hoch über dem Kopf. Hinter ihm sprang kläffend der schwarze Hund vom Nachbarhof. Aus dem Tor gegenüber keifte die Bäuerin.
Magdalena zog den Jungen in den Hausflur und schloss die Tür. Sie nahm ihm die Brote aus den schmutzigen Händen. „Hat sie den Hund auf dich gehetzt?“, fragte sie empört.
Christian lachte, weiße Zähne blitzten in seinem dunklen Gesicht. „Ja, aber der ist schon alt. Er bellt nur. Die Brote hätte er gern gehabt, schätze ich.“
„Gut, dass du sie gerettet hast. Komm mit in die Küche, ich schneide dir deinen Anteil ab. Möchtest du dir die Hände waschen?“
Der Junge sah erst Magdalena, danach seine Hände verständnislos an. Dann schüttelte er den Kopf.
„Ich dachte nur, weil sie so schmutzig sind.“ Sie schnitt eines der Brote in der Mitte durch. Sie waren warm und dufteten nach Getreide und Feuer. „Hier, nimm.“
Er griff zu und zögerte dann. „Ein Viertel war abgemacht, Herrin.“
„War nicht auch abgemacht, dass du nicht Herrin sagen sollst? Das zweite Viertel ist für den Fuhrdienst am Handwagen.“
Christian strahlte. „Danke, Frau Blankenberg, du bist sehr nett.“
„Blankenburg! Sag mal, ist Christoph Weiß dein Vater?“
Der Junge schüttelte seine schwarzen Locken. „Er ist mein Bruder. Kennst du ihn?“
„Wir sind gestern mit seinem Wagen hier angekommen. Hast du noch mehr Geschwister?“
Er lachte. „Mein Vater hat zwei Dutzend Kinder. Er ist der bulibasha.“
Dieses Wort hatte die alte Frau im Wagen ebenfalls gebraucht. Sie konnte doch unmöglich Christians Mutter sein.
„Was heißt dieses Bulli-Dingsda?“
„Er ist unser Stammesvater. Er spricht für uns.“
„Und deine Mutter?“
„Wir wohnen beim Schneider im Haus, meine Geschwister auch.“ Der Junge sah sie seltsam an.
„Alle vierundzwanzig?“
„Nein, nur die Jüngeren. Zwei sind tot, sie sind im Krieg gefallen. Außerdem hat der bulibasha, also mein Vater, zwei Frauen. Die erste lebt mit ihm im Wagen, die zweite, meine Mutter, im Neuen Dorf, wegen der kleineren Kinder.“
„Ach.“ Das musste sie erst einmal verdauen.
Christian steckte das warme Brot wie einen kostbaren Schatz unter sein fadenscheiniges Hemd. „Ich muss los, Frau Blankenburg. Auf Wiedersehen!“
„Hüte dich vor den Dorfhunden.“ Magdalena sah nach dem Tor gegenüber, doch es war geschlossen.
Christine blickte sie vorwurfsvoll an, als sie zurückkam.
„Was ist? Haben Sie etwas gegen die Zigeuner?“
Die kleine Frau zog den Kopf zwischen die Schultern. Das konnte alles bedeuten. „Warum nur? Stehlen sie wirklich?“
Christine hob beide Hände, was wohl bedeuten sollte: Wer weiß? Dann zeigte sie auf den Kehrichthaufen vor dem Herd und deutete auf ihr Gesicht.
„Sie meinen, sie sind schmutzig?“
Heftiges Nicken.
„Dagegen kann man etwas tun. Deshalb müssen sie nicht schlecht sein.“
Die Frau nickte vage und wies auf die Kartoffeln. Dann holte sie zwei Messer und zeigte ihr, wie man die dünne Haut von den Knollen schabt.
„Kann es sein, dass ihr Stammesvater zwei Frauen hat?“, fragte Magdalena.
Christine nickte und zeigte ihr die offene Handfläche. Siehst du, sollte das wohl heißen.
„Na gut, im Alten Testament ist auch von Vielweiberei die Rede. Die Zigeuner sind sicher ein sehr altes Volk mit uralten Sitten und Gebräuchen. Woher kommen sie, wissen Sie das?“
Christine schnaubte verächtlich und hob die Schultern. Dann schabte sie weiter an den winzigen Knollen. Magdalenas Magen knurrte, der Duft der Brote kitzelte in ihrer Nase. „Wir essen jetzt von dem frischen Brot. Haben Sie vielleicht ausgelassenes Fett oder Butter?“
Jetzt lächelte die Frau wieder und Magdalena fand es gar nicht mehr so schlimm.
Aus den Instruktionen für den Missionar des Naumburger Missionsvereins in Friedrichslohra:
§1: Sie sind deshalb von dem Naumburger Missionsverein nach Friedrichslohra gesandt und werden deshalb mit den Ihrigen von demselben unterhalten, damit Sie, unter Gottes Beistand, durch Arbeit und Lehre, durch Gebet und Beispiel die unglücklichen Zigeuner in und um Friedrichslohra zur christlichen Sittigung führen sollen …
§4: Dazu gehört, 1.) daß jede einzelne Familie, wo möglich, ihre besondere Mietswohnung habe, 2.) daß jede einzelne Familie ihr eigenes Brot esse und deshalb ein notdürftig nährendes Gewerbe in Mäßigkeit und Sittsamkeit betreibe, 3.) daß in jeder Familie Gottes Wort gehört, beachtet und von der Jugend auch gelesen werde …
So will der Verein den Zigeunern nur eine Hilfe bei ihrer Sittigung geben, und das vorzüglich bei der Erziehung ihrer Kinder. Das einzige Mittel zur Veredlung der Zigeunerkinder, die sich sonst an die Lebensart der Eltern gewöhnen, ist ein besserer und wenig unterbrochener Unterricht …
§8: Gleichzeitig sollen die alten Zigeuner zur Arbeit angeleitet werden, und zwar möglichst zu solchen Gewerbstätigkeiten, die in jeder Jahreszeit geübt werden können …
Naumburg, 17ter Juli 1830
gez. Oberlandesgerichtsrat Göschel
gez. Oberlandesgerichtsrat Pinder
Magdalena ließ das Schreiben sinken und betrachtete das schweißnasse Gesicht ihres Mannes im Kerzenlicht. Sie stand auf und sah nach den Wadenwickeln. Vorsichtig zog sie die warmen Tücher von Wilhelms Beinen und tauchte sie in einen Eimer mit kühlem Wasser. Nachdem sie die frischen Wickel angelegt hatte, wischte sie ihm die Stirn ab. Er stöhnte und warf den Kopf hin und her, murmelte Unverständliches.
„Schscht“, machte sie. „Alles wird gut, mein Lieber.“ Sie klang zaghaft und nicht überzeugend, aber er hörte sie ohnehin nicht. Ganze zehn Paragrafen hatte das Instruktionsschreiben vom Missionsverein. Zum ersten Mal begriff sie die volle Tragweite ihrer Aufgabe. Das war nicht einfach nur ein Abenteuer. Sie übernahmen Verantwortung für Menschen, deren Bräuche und Lebensart ihnen völlig fremd waren und die, das ahnte sie ebenfalls, nicht interessiert waren an ihrer, wie schrieb der Verein?, Sittigung. Sie hatte auch das Empfehlungsschreiben der Berliner Missionsschule gelesen, in dem Wilhelm dem Verein in Naumburg empfohlen wurde. Da stand, er habe „… für Leute der niedrigsten Klasse etwas Gewinnendes und seine äußere Erscheinung möchte für die Zigeuner etwas Ansprechendes haben …“
Sie lächelte. Der Schreiber in Berlin hatte Wilhelm sicher gut gekannt. Er konnte sich auf die verschiedensten Menschen gut einstellen und sie schnell von sich überzeugen. Und seine äußere Erscheinung, nun, die hatte auch sie beeindruckt. Damals in Basel, als sie die Mutter zur Kur begleitet hatte, im Park spazieren ging, der Wind ihr den Schirm aus der Hand gerissen und er ihn ihr zurückbrachte, ohne viele Worte. „Bitte, gnädiges Fräulein. Ihr Schirm.“ Eine kurze Verbeugung, dann war er gegangen. Und sie hatte ihm nachgestarrt wie einem Kalb mit zwei Köpfen. Zu ihrem Glück hatte er in der Postkutsche nach Nürnberg gesessen. Es wurde eine sehr vergnügliche Fahrt. Als sie in Nürnberg ausstieg, wussten sie beide, dass sie sich wiedersehen wollten.
Aus dem Untergeschoss des Pfarrhauses hörte sie den Pastor schimpfen. Sie schlich zur Tür. „Ein frisches Brot und neue Kartoffeln! Musste das sein? Nur weil wir Gäste haben, musst du das Geld nicht zum Fenster hinauswerfen.“
Oje, die arme Christine. Wenn er wüsste, dass sie ein halbes Brot bereits aufgegessen hatten, als die Männer gegen Abend heimkamen. Die Pastorsfrau hatte alle Krumen sorgfältig aufgesammelt und den Hühnern hinausgetragen. Wahrscheinlich hatte sie geahnt, was ihr Mann sagen würde. Er war bereits aufgebracht gewesen, weil er Wilhelm von der Poststation nach Hause hatte schleppen müssen. Die Reise nach Nordhausen hatte Wilhelms Gesundheit den Rest gegeben, denn er konnte sich auf dem Heimweg kaum noch auf den Beinen halten. Wie das Gespräch mit dem Landrat verlaufen war, konnte sie nicht mehr aus ihm herausbringen. Sie brachten ihn sofort ins Bett, wo er in einen unruhigen Schlaf fiel. Deshalb hatte sie begonnen, die Papiere zu lesen, die sie in seiner Tasche fand.
… so weisen wir an, daß bis zur Fertigstellung des Sittigungshauses vom Missionar und den Seinigen eine Wohnung in der Friedrichsstraße zu nehmen ist. Bei der Auswahl des Hauses wird ihm selbst freie Wahl gelassen, es stehen etliche Häuser leer und sind sofort zu beziehen. Möbel und Hausrat in einfacher Ausfertigung werden von Seiten des Landratsamtes gestellt. Quittungen sind umgehend beizubringen.
Nordhausen, 15. Oktober 1830
gez. von Arnstedt, Landrat
Wilhelm stöhnte und murmelte etwas. Diesmal glaubte sie, ihren Namen zu verstehen. „Ich bin da, Liebster, hörst du?“ Das Tuch auf seiner Stirn war schon wieder warm. Sein Körper heizte besser als der Herd unten in der Küche. Sollte sie die dicke Federdecke wegnehmen? Mit Krankenpflege kannte sie sich nicht besonders gut aus. Sie hätte jetzt seinen Rat gebraucht. In der Armen-Schullehrer-Anstalt in Basel war er neben Garten- und Hauswart auch Krankenpfleger gewesen. Sollte sie Christine um Hilfe bitten? Doch solange der Pastor dort unten herumpolterte, wollte sie sich lieber still verhalten.
Es klopfte leise.
„Ja, bitte?“
Als hätte sie ihre Gedanken gelesen, stand die kleine Frau in der Tür. Sie trug eine Tasse mit dampfendem Tee und frische Handtücher.
Erleichtert lächelte Magdalena ihr zu. „Er schwitzt so sehr. Was kann ich nur tun?“
Christine wies auf die Wadenwickel und auf das frische Wasser und nickte eifrig. Dann zeigte sie auf den Tee und wollte verschwinden. Magdalena hielt sie am Ärmel fest. „Ich habe vorhin gehört, dass Ihr Mann wegen des Brotes geschimpft hat. Das tut mir leid. Ich werde ihm morgen sagen, dass ich das Brot bezahlt habe.“
Zunächst verschloss Christine ihre Miene, wie aus alter Gewohnheit, dann blickte sie auf und winkte ab. Fast schien es, als lächle sie ein wenig.
„Die Fettbrote waren es wert, nicht wahr?“, flüsterte Magdalena verschwörerisch und diesmal lächelte Christine ganz deutlich.
Magdalena verbrachte die Nacht an Wilhelms Bett, wechselte die Umschläge um seine Waden und flößte ihm nach und nach den Tee ein. Auch am Tag darauf ging es ihm nicht besser. Christine saß ein paar Stunden bei ihm, damit Magdalena etwas schlafen konnte. Am Samstag sank das Fieber und er war öfter für kurze Zeit ansprechbar.
Am Sonntag besuchte Magdalena den Gottesdienst in der Wendener Kirche, wofür sie Wilhelm zum ersten Mal allein ließ. Sie waren lange vor dem Einläuten da, denn Christine musste die Kerzen entzünden, den Altar mit Blumen schmücken und ihrem Mann beim Überziehen des Talars helfen. Magdalena betrachtete die schlecht verputzten Wände und die einfachen Kirchenbänke, ihr Atem ließ die Kälte zwischen den alten Mauern sichtbar werden. Sie saß neben Christine, die sich in der zweiten Reihe an die kalte Wand drückte und sich kleinmachte, wie immer, wenn sie unter Menschen musste. Nach und nach betraten die Bauersfrauen den Raum, schnelle Blicke schossen herüber, Köpfe wurden zusammengesteckt. Das Zischeln der Fragen vermischte sich mit dem Scharren der Füße über ihnen auf der hölzernen Empore, wo die Bauern räuspernd und murmelnd ihre Hüte aufhängten, bevor sie Platz nahmen und wie Hühner auf der Stange nach unten schauten. Pastor Blume hielt eine trockene Predigt, in der er von einer reichen Ernte sprach, für die Gott gedankt werden müsse. Seine scharfe Stimme klang die ganze Zeit vorwurfsvoll, jedes seiner Schäfchen in der kleinen Stephanuskirche würde wohl mit einem schlechten Gewissen nach Hause gehen. Beim Verlassen der Kirche wurde Magdalena mit wissenden Blicken gemustert, erst da fiel ihr auf, dass der Pastor kein Wort über den neuen Missionar verloren hatte. War es nicht üblich, dass man für eine Mission in der Gemeinde um Gottes Segen bat? Nun gut, es handelte sich um eine Mission in der katholischen Nachbargemeinde, aber Wilhelm und sie waren evangelisch und wie sollten sie ihre Aufgabe ohne die Hilfe ihrer Kirchengemeinde bewältigen?
Beim Mittagessen im Haus des Pastors nahm sie allen Mut zusammen und sprach ihn darauf an. „Ich hätte mich gefreut, wenn Sie heute einen Segen für unsere Mission gesprochen hätten.“
Die Gabel des Pastors blieb in der Luft hängen. Christine sah aus, als wolle sie unter den Weißkohl kriechen, der vor ihr auf dem Teller lag. Ihr Mann beugte sich über den Tisch. Sein hageres Gesicht wurde noch länger, als er die Augenbrauen weit nach oben schob. „Vielleicht hätte ich Ihnen das gleich am ersten Tag sagen sollen, Frau Blankenburg. Ich halte nichts von dieser Mission, gar nichts. Und ich werde mich in meiner Gemeinde nicht in die Nesseln setzen, indem ich für eine Sache bete, die von vornherein zum Scheitern verurteilt ist.“
„Aber warum …“
„Lassen Sie mich ausreden! Ich weiß nicht, wie lange es her ist, da kamen schon einmal zwei Missionare, die die Welt verbessern wollten. Sie verschwanden nach einigen Wochen sang- und klanglos. Ich habe nie wieder etwas von ihnen gehört. Verzeihen Sie mir meine direkten Worte: Ich gebe Ihnen und Ihrem Mann, gebe Gott, dass er bald wieder auf den Beinen ist, nur wenige Wochen, dann werden Sie Ihre Sachen packen und nach Was-weiß-ich-wohin verschwinden.“ Er hackte mit der Gabel auf das Weißkraut ein, als trüge es Schuld an seiner Misere. Seine Stimme wurde bei jedem Satz lauter. „Die Tatern werden keine Christenmenschen, so wahr ich die heilige Taufe empfangen habe. Sie sind nicht zu sittigen, auch Sie werden das eines Tages merken. Wissen Sie, welches Wort sie in ihrer Sprache für Gott haben?“ Die Zinken seiner Gabel zeigten auf Magdalena, die stumm den Kopf schüttelte.
„Sie nennen ihn dewel.“
Magdalena schwieg betroffen. Dewel war das plattdeutsche Wort für Teufel.
Als täte ihm seine Heftigkeit leid, sprach der Pastor im sanfteren Ton weiter. „Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich werde Sie nicht daran hindern, sich auszuprobieren, das steht mir gar nicht zu. Von mir aus bauen Sie dieses Sittigungshaus, Sie haben den Auftrag der Mission, Sie leben davon und vielleicht dafür. Aber seien Sie nicht allzu enttäuscht, wenn sie irgendwann feststellen werden, dass alles nur ein Traum war. Ein Traum, der nicht wahr werden konnte.“ Er legte die Gabel beiseite und erhob sich. „Es ist besser, Sie tragen diesen Gedanken von Anfang an bei sich, dann wird es für Sie nicht ganz so bitter.“
An der Küchentür drehte er sich um. „Ihr Mann scheint mir sehr an dieser Illusion zu hängen. Bereiten Sie ihn vor, damit er nicht zu schmerzhaft auf die Nase fällt.“
Seine Frau räumte mit gesenktem Kopf den Tisch ab. Magdalena hatte den dringenden Wunsch, dieses Haus endlich verlassen zu können. Wenn nur Wilhelm gesund wäre. Doch sie würde allein anfangen, gleich morgen, das Haus aussuchen und Möbel anfertigen lassen. Als Christine nach ihrem Teller griff, hielt sie ihre Hand fest. „Kennen Sie einen guten Tischler?“
Am nächsten Morgen brachte die Pastorsfrau sie zu einem Mann, der sich als Gottfried Schwarzburger vorstellte und, wie sich herausstellte, ihr Bruder war. Seine Holzwerkstatt befand sich in einer steilen Gasse, die hinauf zum Wald führte. Sein freundliches, schmales Gesicht machte Magdalena schmerzlich klar, wie Christine aussehen könnte, wenn sie nicht so furchtbar entstellt wäre. Der Mann hörte sich ihre Wünsche an.
„Tisch und Stühle wären wichtig und ein Bett, auch ein Kinderbett, aber das hat Zeit bis zum Frühjahr, dann ein Vorratsschrank für die Küche und natürlich ein Kleiderschrank. Ein Schreibtisch für meinen Mann.“
Gottfried Schwarzburger schmunzelte und nahm die Pfeife aus dem Mund. „Langsam, langsam gute Frau. Sie brauchen einen ganzen Hausrat, wie mir scheint. Ich müsste wissen, welche Maße die Möbel haben sollen und welches Holz sie dafür wünschen.“
„Oh …“ Magdalena sah ihn ratlos an.
„An welche Kosten haben Sie gedacht?“
„Einfach, es muss alles einfach sein und darf nicht viel kosten.“
Der Mann furchte die Stirn und sog an seiner Pfeife. „Also Fichte.“
„Sie müssen keine Sorge haben wegen der Bezahlung, das Landratsamt übernimmt die Kosten, gegen Quittung, versteht sich. Es soll alles bescheidene Ware sein.“
„So, so. Möbel auf Staatskosten, verstehe.“ Wenn er neugierig war, verbarg er das gut.
Magdalena scheute sich inzwischen, von ihrer Mission zu erzählen. Sie fürchtete, der Mann würde den Auftrag ablehnen, wenn er von ihrer Aufgabe erfuhr. Mit Staunen sah sie, wie Christine mit ihrem Bruder kommunizierte. Ihre Hände führten einen wahren Tanz auf, sie wies die Straße entlang, verknotete die Finger, legte dann beide Hände aneinander wie zum Gebet, um sie dann in schnellem Wechsel ins Gesicht und zum Herzen zu führen.
Ihr Bruder nickte mehrmals.
„Sie wollen sich ein Haus aussuchen?“, fragte er.
„Das hat sie ihnen erzählt?“, fragte sie verblüfft.
Er schmunzelte. „Sie hat als Kind ihre eigene Sprache entwickelt. Sie spricht mit den Händen. Leider bin ich der Einzige, der sie versteht, seit unsere Eltern tot sind.“
„Und ihr Mann?“
Zum ersten Mal huschte ein dunkler Schatten über das freundliche Gesicht des Mannes. „Seine Heiligkeit macht sich nicht die Mühe, seine Frau verstehen zu wollen. Es genügt ihm, wenn sie ihn versteht.“
Christine legte beschwichtigend ihre Hand auf seinen Arm.
„Ja, schon gut.“ Er wandte sich an Magdalena: „Wenn Sie Hilfe benötigen, können wir gemeinsam ein brauchbares Haus aussuchen. So müssen Sie nicht warten, bis Ihr Mann wieder auf den Beinen ist.“
Magdalena strahlte und nickte Christine dankbar zu.
Nach weiteren drei Tagen war Wilhelm so weit genesen, dass er an Magdalenas Arm einen Spaziergang bis ins Neue Dorf wagen konnte. Tags zuvor war sie mit ihm schon bis zur Kirche gegangen und hatte ihm vom Gottesdienst erzählt. Pastor Blumes Meinung zu ihrer Mission hatte sie ihm allerdings verschwiegen.
Die Dorfstraße war leer, bis auf ein paar streunende Katzen. Hinter einigen Fenstern klapperten die Webstühle. Die unbewohnten Katen im oberen Teil der Straße hatte sie beim Rundgang mit Gottfried Schwarzburger als unzumutbar verworfen. „Viel zu viel Aufwand“, hatte er gesagt. Wilhelm nickte jetzt zustimmend.
Durch das Fenster des Kolonialwarenladens wurden sie von mehreren Augenpaaren gemustert. Magdalena nickte freundlich. Eine Reaktion konnte sie nicht erkennen. Die katholische Kirche hockte verlassen in der trüben Herbstsonne.
„Du hast das allerletzte Haus in der Straße gewählt“, stöhnte Wilhelm und blieb am Rande des Angers stehen. Auf seiner Stirn standen feine Schweißperlen, obwohl die Luft herbstlich kühl war. Mit Todesverachtung streifte sein Blick die Kneipe am unteren Ende des Platzes.
„Nein, wir sind gleich da.“ Magdalena tat vor Freude einen kleinen Hüpfer. Sie zog ihn ein paar Schritte weiter, an der Schule vorbei zu einem Haus, aus dem eifriges Hämmern und Klopfen drangen.
„Was sagst du?“, fragte sie.
Er musterte die Fassade, die mit den kärglichen Resten ihrer Kalkbemalung ein wenig an eine gescheckte Kuhhaut erinnerte. Die Fachwerkbalken waren ausgeblichen und hoben sich nicht mehr vom Lehmverputz des Mauerwerkes ab. Von den zwei Fenstern war eines blind, das andere war offensichtlich erneuert worden und spiegelte das fahle Sonnenlicht wider. Die Tonziegel auf dem Dach hatten die Farbe von nassem Herbstlaub, aber sie waren vollzählig und der Schornstein stand einigermaßen gerade.
„Wilhelm?“ Sie zerrte ungeduldig an seinem Arm.
„Sieht aus wie eine einäugige Kuh.“
Sie hatte jetzt keinen Sinn für seinen Humor, erst recht nicht für Sarkasmus. „Lass uns hineingehen.“
Er zögerte. Aus dem Fenster des Nachbarhauses hing eine Traube schwarzhaariger Kinderköpfe. Über dem Tor baumelte eine große hölzerne Schere im Wind.
Magdalena war seinem Blick gefolgt. „Dort wohnt der Schneider Rippling. Er vermietet seine Stube an Christians Mutter und ihre Familie. Du weißt, der Junge, der uns das Brot bringt.“
Wilhelm nickte und winkte den Kindern zu. Sofort verschwanden die Köpfe, das Fenster war plötzlich leer. Die Scheibe klapperte bedenklich, als es von unsichtbarer Hand abrupt geschlossen wurde.
„Dann nicht“, brummte er und folgte seiner Frau durch das geöffnete Tor über einen kleinen grasbewachsenen Hof ins Haus. Der Tischler, der mit einem Lehrburschen den Dielenfußboden ausbesserte, begrüßte ihn und fragte nach seinem Befinden. Dann zeigte er ihnen die Räume, die sie bewohnen sollten. Es gab eine Stube, deren Wände geweißt werden mussten und eine kleine Schlafkammer. Hier stand bereits ein helles Bett, das nach frischem Nadelholz roch. Wilhelm sog den Duft tief ein. Er liebte diesen Geruch, er verbreitete ein Gefühl von Sauberkeit und Gemütlichkeit. Anerkennend fuhr seine Hand über die glatt gehobelten Bretter. „Gute Arbeit!“
Schwarzburger schmunzelte zufrieden. „Wenn die Dielen fertig sind, kann der Junge die Wand in der Stube kalken. Tisch und Stühle stehen bei mir in der Werkstatt. Ich denke, übermorgen können Sie einziehen.“ Er zog seine Pfeife aus der Tasche.
„O Wilhelm, wir müssen Bettzeug besorgen. Und Geschirr für die Küche.“ Magdalena hob die Hände.
„Haben wir denn eine Küche?“
„Komm mit.“ Sie zog ihn weiter, während Schwarzburger seine Pfeife stopfte.
Im hinteren Teil des Hauses befand sich eine jämmerlich kleine Kammer mit festgestampftem Lehm als Fußboden, auf dem ein schmutziger alter Herd stand. Ein winziges Fenster voller Spinnweben zeigte hinaus in den Garten. „Hier kann ich kochen. Ich muss natürlich erst mal gründlich putzen.“ Sie wollte optimistisch klingen, aber es gelang ihr nicht.
Er zog sie an sich. „Meine tapfere Frau. Was würde ich nur ohne dich machen?“
Sie lächelte, doch ihre Augen glänzten verräterisch. „Es ist doch nur für ein paar Monate, bis das Sittigungshaus fertig ist.“
„Lass uns beten, dass die Spenden reichlich eingehen werden. Der Landrat meinte, ganz ohne Hilfe aus der Bevölkerung könne er das Haus nicht finanzieren.“
„Beten allein wird nicht ausreichen. Wir werden hausieren gehen müssen.“ Dabei dachte sie an die Einstellung der Bauern in Wenden und ihr Mut sank noch tiefer. Doch sie durfte sich nichts anmerken lassen. „Wir sollten uns auf die Städter konzentrieren. Sie sind offener für das Elend anderer Menschen und haben meist mehr Geld.“
„Ich habe von Arnstedt gebeten, in Nordhausen einen Spendenaufruf an die Kirchen zu geben. Morgen werde ich nach Bleicherode gehen. Er empfahl mir, mit dem dortigen Superintendenten zu reden, ein Mann namens Hahn.“
„Ich begleite dich. Vielleicht können wir ein Fuhrwerk mieten und gleich einkaufen?“, fragte sie.
„Ich werde mit Pfarrer Montag reden. Er darf seine eigenen Gemeindemitglieder nicht in diesem Elend sitzen lassen. Vielleicht kann er ein oder zwei Kollekten entbehren.“
Hinter ihnen betrat der Tischler den Hausflur. Offensichtlich hatte er Wilhelms letzte Worte gehört, denn er legte die Stirn in Falten und nahm die Pfeife aus dem Mund. „Von dem erwarten Sie lieber nichts. Der verabreicht eher dem Teufel das Abendmahl, bevor er nur einen Finger für die Tatern krumm macht. Und Kollekten entbehren kann er ganz bestimmt nicht.“ Schwarzburger deutete mit seiner Pfeife über den Hof, wo der Blick direkt auf die katholische Kirche fiel. „Haben Sie sich mal das Pfarrhaus angesehen? Das fällt ihm bald über dem Kopf zusammen. Die katholische Gemeinde ist ärmer als ihre eigenen Kirchenmäuse. Alles nur Leineweber und Wollspinner, die gerade so viel verdienen, dass sie sich den Kohl für ihre Suppe leisten können. Der Einzige, der ein bisschen Geld auf der hohen Kante hat, ist der Krämer Stange.“
Der Lehrbursche rief nach ihm.
„Nichts für ungut!“ Er drehte sich um und verschwand in der Stube.
Wilhelm schnaufte. „Na gut. Dann halten wir uns an die Städter. Und vielleicht an die Bauern, die sind doch so arm nicht.“
„Warum suchen wir den Krämer nicht auf?“, fragte Magdalena. „Wenn wir bei ihm unseren Hausrat einkaufen, ist er uns bestimmt wohlgesonnen.“
„Ich würde vorher gern nach Christian sehen, einfach nur, um seine Familie kennenzulernen. Irgendwo müssen wir anfangen.“
Sie klopften beim Schneider an die Tür. Ein kleiner Krauskopf mit Augen wie Kohlenstücke öffnete ihnen. „Der Meister ist nicht …“ Als er sah, wer vor der Tür stand, verstummte er und verschwand hinter einer Tür, wo er lauthals etwas rief, das sich wie „Gatschi“ anhörte. Magdalena und Wilhelm blickten in den Hausflur und sahen sich neugierig um. Das Haus war genau so gebaut wie ihres nebenan. Vom Hausflur führten zwei Türen ab. Hinten endete er in einer kleinen Küche. Die Wände waren länger nicht geweißt worden, in den Ecken sammelten sich Stoffreste und bunte Fäden, die typischen Abfälle einer Schneiderei. Eine Weile geschah nichts, dann rief Magdalena: „Christian?“
Es rumorte in einer der beiden Kammern, sie hörten Stimmen und schließlich trat eine Frau heraus. Sie war eine Zigeunerin mittleren Alters, ihr brauner Rock war mehrfach geflickt, ihre Bluse schmutzig und am Ärmel aufgerissen. Sie trug einen nackten Säugling auf dem Arm und in ihrem Mundwinkel hing eine qualmende Tabakpfeife. Sie nahm sie nicht aus dem Mund, als sie sagte: „Christian ist nicht da. Hat er das Brot nicht gebracht?“
„Das Brot soll er morgen erst bringen“, sagte Magdalena. „Sind Sie seine Mutter?“
„Ja. Was willst du von ihm?“
„Wie Sie vielleicht schon wissen, sind wir hier, um Ihnen und Ihrer Familie zu helfen, bessere Lebensumstände zu bekommen.“ Wilhelm wurde rot, als er merkte, wie gestelzt er sich ausdrückte. „Wir würden einfach gern sehen, wie Sie leben.“
Die Zigeunerin sog an ihrer Pfeife und starrte ihn an. Dann trat sie beiseite und öffnete die Tür. „Bitte!“
Es war still gewesen in der Stube, deshalb erschrak Magdalena umso mehr, als sie sah, wie viele Menschen in diesem Raum hausten. Sie zu zählen war unmöglich, kleine und größere Kinder krabbelten auf dem blanken Fußboden übereinander hinweg. Fast alle waren nackt. An der Wand hingen zwei Geigen und ein Hackbrett, darunter saßen drei Männer und spielten Karten, einer von ihnen trug einen großen schwarzen Hut. Neben ihnen döste eine alte Frau, zusammengerollt unter einer lumpigen Decke. In der gegenüberliegenden Ecke saßen ein paar halbwüchsige Mädchen wie Gänse in einer Reihe hintereinander, kämmten sich die Haare und flochten sich Bänder hinein. Eine jüngere Frau wiegte ein schlafendes Kleinkind im Arm. Der Kleine, der ihnen geöffnet hatte, drängte sich an ihre Seite. Es gab keinerlei Möbel in diesem Raum, nur einen schmalen gusseisernen Ofen in der Ecke neben dem Schornstein, der allerdings nicht befeuert wurde. Die Luft war voller Rauch und es stank nach menschlichen Ausdünstungen, Zwiebeln und schlechtem Tabak.
Als die beiden Fremden den Raum betraten, erstarrte die Szene zu einem Stillleben. Magdalena glaubte, Furcht in den schwarzen Augen zu erkennen, die auf sie gerichtet waren. Wovor hatten diese Menschen Angst?
Wilhelm ging in die Hocke, um mit den drei Männern auf Augenhöhe zu sein. „Wer spricht für euch?“, fragte er.
Der Mann mit dem Hut antwortete ihm: „Wenn du die Familie hier im Raum meinst, werde ich für sie sprechen.“
„Ich bin Wilhelm Blankenburg, Missionar der evangelischen Kirche. Das hier ist meine Frau Magdalena. Wir werden nebenan in das Haus einziehen.“
Die Männer nickten, doch ihre Mienen blieben verschlossen. Der mit dem Hut antwortete: „Ich bin Christian Steinbach. Spielmann von Beruf. Dies ist mein Bruder Gottlieb und dieser Zigeuner hier wird Heinrich Weiß gerufen. Solltest du einen Scherenschleifer brauchen, es gibt keinen besseren.“
„Ich wurde von der evangelischen Mission gesandt, um euch zu helfen. Ich möchte euch Wohnung, Arbeit und Brot verschaffen. Meine Frau unterstützt mich dabei.“
Magdalena, die hinter ihm stand, wurde das Gefühl nicht los, völlig falsch am Platze zu sein. Der Drang, sich umzudrehen und hinauszulaufen wurde übermächtig.
Wilhelm sprach weiter. Seine Stimme war ruhig. „Eure Kinder werden ordentlichen Unterricht bekommen, sobald wir eine Schule für sie gebaut haben. Das wird bereits nächstes Jahr geschehen. Bis dahin können sie zu uns ins Haus kommen.“
Plötzlich kam Unruhe auf. Die Männer brummten und sahen sich vielsagend an, die Halbwüchsigen steckten die Köpfe zusammen. Der Säugling begann zu greinen, und Christians Mutter reichte ihn der jungen Frau auf dem Fußboden, die ohne zu zögern, ihre Bluse öffnete und ihn an eine ihrer prallen Brüste legte.
Der Mann mit dem Hut beugte sich vor: „Davor hat man uns gewarnt. Du willst uns unsere Kinder wegnehmen.“
„Aber nein!“ Wilhelm stand auf. „Wie kommt ihr auf so etwas? Ich will ihnen Lesen und Schreiben beibringen.“
Auch die drei Sinti erhoben sich. Sie standen Wilhelm direkt gegenüber, dabei wirkten sie nicht bedrohlich, sondern einfach nur stolz und unnahbar. „Unsere Kinder und unsere Freiheit sind alles, was wir haben. Niemand wird sie uns wegnehmen!“
„Wer hat euch diesen Unfug erzählt?“, fragte Wilhelm.
„Da waren schon einmal zwei, die sagten, wenn wir nicht arbeiten gingen, würde man uns die Kinder nehmen und sie ins Armenhaus bringen. Wir haben sie davongejagt. Wir haben ihnen gesagt, wir würden sie mit unseren bloßen Zähnen zerreißen, wenn sie die Kinder auch nur anfassen würden.“ Der Zigeuner mit dem Hut zeigte zur besseren Demonstration seine Reihe weißer Zähne.
„Pfarrer Montag sagte uns, sie würden wieder kommen“, ergänzte der Scherenschleifer. „Und nun bist du da.“
Wilhelm sah sich ruhig um. „Wer spricht für euren Stamm?“
„Unser bulibasha, der alte Löschhorn. Er ist draußen vor dem Dorf im Wagenlager.“
„Würdet ihr ihn holen, damit ich ihm und euch allen mein Anliegen erklären kann? Ladet auch die anderen Familien ein, ich bitte euch.“
Die Zigeuner nickten, doch ihre Blicke blieben finster und skeptisch. „Sei heute zum Abendläuten wieder hier. Wir werden da sein, der bulibasha ebenso.“
Als sie den Raum verließen, fiel Magdalenas Blick auf die halbwüchsigen Mädchen in der hinteren Ecke. Sie starrten sie neugierig an, eine hatte die Haarbürste in ihrem Schoß abgelegt. Es war eine Holzbürste ohne Stiel, sie glich viel eher einer Kleiderbürste. Magdalena entdeckte dunkle Intarsien in dem hellen Holz und sie glaubte, ihren Augen nicht zu trauen. Als sie genauer hinsah, schob das Mädchen seinen schäbigen Kittel darüber.
Draußen auf der Straße bemerkte Wilhelm, dass seine Knie weich waren und sein Hemd feucht von Schweiß. Er schnaufte laut und rieb sich das Gesicht.
„Niemand hat gesagt, dass es einfach sein wird“, meinte Magdalena.
„Ich weiß. Und dabei haben wir noch gar nicht angefangen.“
„Das Mädchen hinten in der Ecke hat den anderen die Haare gebürstet, mit meiner Kleiderbürste.“
Wilhelm sah sie verständnislos an.
„Die Kleiderbürste, die wir nicht finden konnten.“ Magdalena hob die Stimme. „Ich habe sie sofort wiedererkannt, sie hat braune Intarsien, ein Geschenk meiner Großmutter. Sie benutzen sie als Haarbürste.“
„Hör mal, es gibt so viele Bürsten, vielleicht sah sie deiner etwas ähnlich.“ Er schüttelte den Kopf.
„Ich würde diese Kleiderbürste immer wiedererkennen, glaube mir, ich habe sie schon viele Jahre.“ Sie brach ab und schwieg verärgert. Sie hatte sich fest vorgenommen, die Vorurteile über die Zigeuner zu ignorieren, und jetzt war sie die Erste, die behauptete, dass sie bestohlen worden war.
„Wir kaufen eine neue“, sagte Wilhelm.
Sie nickte und versuchte, den Ärger und das Misstrauen zu verdrängen. „Lass uns zu Pfarrer Montag gehen. Wir fragen ihn, ob er wirklich diesen Unsinn verbreitet hat. Und vielleicht kann er uns doch irgendwie helfen.“ Sie zog ihn auf das Pfarrhaus zu, das mit seiner windschiefen Haustür verschämt hinter der Kirche hervorlugte.
„Nein, das nicht auch noch. Mein Bedarf an Absagen ist für heute gedeckt“, widersprach Wilhelm. „Wenn, dann besuchen wir den Kolonialwarenladen.“
Sie betraten den kleinen Laden. Der dicke Krämer stand hinter dem Tresen und fummelte an seiner Waage herum. Beim Anblick der Kundschaft wischte er seine Hände an seiner Schürze ab. „Womit kann ich dienen?“
„Wir benötigen Geschirr, Teller, Tassen, Krüge und Töpfe. Auch Besteck und Kochlöffel.“ Diesmal führte Magdalena das Wort.
Der Mann nickte eifrig. „Einen ganzen Hausrat. Wohl, wohl. Einiges müsste ich erst ranschaffen, habe nicht alles vorrätig. Aber hier, sehen Sie, Schüsseln aus bester Emaille.“ Geschäftig schob er die Ware über den Tresen. „Teller aus Steingut, ziemlich bruchsicher. Und hier, Brotbretter aus Buchenholz.“
Magdalena nickte und nickte und der Krämer stapelte alles vor ihr auf. Wilhelm räusperte sich. „Lenchen, denk an die Kleiderbürste. Mit dem Rest sollten wir warten, bis der Tischler die Stube fertig hat. Dann kann die Ware gleich ins Haus geliefert werden.“
Ein Brotbrett schwebte kurz in der Luft, dann legte der Mann es zurück auf den Stapel. „Sie ziehen in die Kate der alten Meta ein?“
„Das Haus neben dem Schneider?“
„Ja, dort lebte die alte Meta. Sie starb vor zwei Jahren, hatte keine Kinder. Seitdem stand das Haus leer und fiel wieder an den König. Verzeihen Sie meine Neugier, aber Sie sehen nicht aus wie Wollspinner.“
„Nein. Wir sind das Ehepaar Blankenburg“, sie sah sich nach Wilhelm um, „mein Mann kommt aus Basel und ich stamme aus Nürnberg.“
„Ja, das kann man hören“, sagte der Krämer lächelnd. „Hier wohnen ja Leute aus allen möglichen Gegenden, aber die Bayern hört man doch immer wieder heraus.“
„Sie meinen die Zigeuner?“, fragte Wilhelm, um dem Gespräch endlich die richtige Richtung zu geben.
„Wie?“
„Sie sagten, Leute aus allen möglichen Gegenden.“
„Ach so, nein. Die Wollspinner und die Weber wurden damals aus allen Ecken Deutschlands und darüber hinaus angeworben, die unterschiedlichsten Dialekte vermischen sich hier. Die Tatern allerdings, wenn die in ihrer Sprache loslegen, verstehen Sie gar nichts. Sind Sie vielleicht der neue Lehrer?“
„Nein, ich bin evangelischer Missionar. Meine Frau und ich, wir sind hier, um die Zigeuner zu sittsamen Bürgern zu machen.“
Wenn der Mann überrascht war, dann verbarg er es gut. Er deutete auf den Stapel Geschirr: „Soll ich das für Sie zurückstellen?“
„Ja bitte.“ Magdalena nickte zufrieden. „Übermorgen ziehen wir ein. Dann hole ich das alles ab.“
„Sie müssen nur Bescheid geben, dann lasse ich es Ihnen bringen. Ich weiß ja jetzt, wo sie wohnen. Sie sagten etwas von Kochtöpfen. An welche Größe dachten sie?“
Am späten Nachmittag hatten sich vor dem Haus des Schneiders eine Menge Zigeuner versammelt. Die Frauen saßen am Straßenrand und schwatzten. Die meisten von ihnen trugen einen Säugling oder ein Kleinkind auf dem Arm. Magdalena erkannte die alte Frau, die ihnen den Schnaps ausgeschenkt hatte, und nickte ihr erfreut zu. Die größeren Kinder spielten laut kreischend auf dem Anger. Der Klang eines Zimbals vermischte sich mit dem Geschrei der spielenden Kinder, die zerlumpten Röcke einiger halbwüchsiger Mädchen wirbelten um ihre braunen Beine. Der Zimbalspieler war sehr jung und setzte mehrmals von vorn an, weil er sich verspielt hatte, was die Mädchen mit spöttischem Lachen quittierten. Die Männer standen für sich und zogen an ihren Pfeifen.
Magdalena fiel auf, dass die Sintimänner besser gekleidet waren als die Frauen. Sie trugen Hosen in blank polierten Stiefeln und weiße Hemden unter den Westen oder Jacken, die zwar nicht neu, aber sauber gebürstet waren. Sie sah eine Vielfalt an Hüten und Mützen, die meist mit bunten Vogelfedern oder silbernen Knöpfen geschmückt waren.
Zwei Männer, die die Straße hinaufkamen, musterten die Menschenansammlung misstrauisch. Magdalena erkannte den Stiernacken und seinen blonden Saufkumpanen, der Linzer genannt wurde. Sie stieß Wilhelm an und nickte den Männern zu.
„Guten Abend, Frau Missionarin“, sagte der Stiernacken, als er sie erkannte. „Was wird ‘n das hier? ‘ne Igelfresserversammlung?“
Wilhelm trat einen Schritt vor. „Guten Abend. Wie geht es Ihren Ziegenböcken?“
Der Linzer grinste. Stiernacken sah ihn verständnislos an.
„Sie schulden mir noch eine Fahrt, schon vergessen? Ich habe dafür bezahlt. Drei Krüge Bier und sechs Schnäpse. Sie stehen doch zu Ihrem Wort?“
Der Mann murmelte irgendetwas Unverständliches und wollte weiter in Richtung Kneipe. Wilhelm vertrat ihm den Weg. „Ich brauche morgen ein Fuhrwerk nach Bleicherode. So gegen neun.“
„Ja, schon gut. Kommen Sie zu dem Haus dort unten, das mit dem hellen Tor.“ Er machte ein finsteres Gesicht und deutete vage die Straße hinab. Sein Kumpan feixte.
„Schönen Gruß an den Wirt!“, rief Wilhelm ihnen hinterher.
Aus der Menge der Zigeuner, die vorm Haus des Schneiders standen, löste sich Christian Steinbach, Magdalena erkannte Christoph Weiß und lächelte ihm zu.
Wilhelm ergriff das Wort: „Ich schlage vor, wir gehen in mein Haus, vielleicht von jeder Familie ein Vertreter?“ Er sprach so laut, dass alle ihn hören konnten. Wie immer wirkte er ruhig und gelassen. Magdalena erkannte am leichten Zucken seiner Mundwinkel, dass er alles andere als ruhig war.
Zwei alte Zigeuner traten auf ihn zu. Christoph Weiß machte sie bekannt: „Das ist mein Vater, unser bulibasha Ludwig Weiß, Löschhorn genannt. Und dies ist Carl Mettbach. Auch er trifft Entscheidungen für uns. Sie werden sich deine Worte anhören, Wilhelm Blankenburg.“
Wilhelm reichte beiden Sinti die Hand und wies auf Magdalena. „Meine Frau ist an unserer Mission beteiligt. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, dass sie an dem Gespräch teilnimmt?“
Mit klopfendem Herzen begrüßte Magdalena die beiden Männer. Der bulibasha trug einen grauen Wollmantel, der vorn mit lauter Silberköpfen besetzt war, ähnlich dem eines Soldaten. Darunter dunkle Stiefel, die zwar abgetreten, aber blank gewienert waren. Seinen grauen Haarschopf bedeckte eine pelzverbrämte hohe Mütze, ähnlich dem Tschako der Gendarmen. Seine Gesichtshaut erinnerte an altes Sattelleder, ein ordentlich gezwirbelter Schnauzbart verlieh ihm ein strenges Aussehen. Zwei schwarze Augen funkelten sie an, aus denen Weisheit und Schläue sprachen.
„Madame Blankenburg, es ist mir eine Ehre“, sagte er und es klang aufrichtig.
Sie lächelte und neigte den Kopf. „Ganz meinerseits, Herr Weiß.“
Der alte Mettbach war groß und hager, sein Rücken krümmte sich leicht, als fürchte er ständig, mit dem Kopf irgendwo anzustoßen. Sein weißes Haar hatte er zu einem Zopf gebunden. Darüber saß ein breiter Schlapphut mit einer hellen Feder. Eine Weste aus bunten Katzenfellen schützte ihn vor der kalten Herbstluft, darunter trug er ein weißes Hemd, dessen weite Ärmel sich über seinen Händen bauschten. Der unvermeidliche Schnauzbart war gelb vom Tabakrauch. Er musterte sie kurz und nickte ihr stumm zu.
Sie betraten die Stube und Wilhelm entschuldigte sich wegen der fehlenden Möbel.
„Wir sind es gewohnt, auf dem Boden zu sitzen“, sagte der bulibasha und ließ sich an der Wand nieder. Mettbach folgte seinem Beispiel. Beide griffen sofort nach ihren Pfeifen. Wilhelm setzte sich ungeschickt den beiden gegenüber und sah Magdalena auffordernd an. Sie fühlte sich unbehaglich, noch nie hatte sie mit Gästen in einem leeren Zimmer auf dem Fußboden gesessen. Aber hier in diesem Dorf war sowieso alles anders. Seufzend ging sie sich neben ihrem Mann in die Hocke und zog ihr Kleid sittsam um die Füße.
Wilhelm wartete, bis die beiden Männer ihre Pfeifen gestopft und entzündet hatten, dann begann er zu reden. Den ganzen Nachmittag hatte er sich Gedanken über die richtige Wortwahl gemacht. Da er seine Gesprächspartner nicht kannte, musste er auf seine Intuition vertrauen. Er erklärte zunächst, wer sie geschickt hatte und welche Aufgaben die Naumburger Mission im Allgemeinen wahrnahm. Er hielt ihnen ihre elende Situation vor Augen und dass es Zeit sei, diese zu verändern.
„… und deshalb sind wir hier. Wir wollen Ihnen helfen, mit geregelter Arbeit zu einem besseren Leben zu kommen. Wenn Sie täglich arbeiten gehen, werden Sie Lohn erhalten, von dem Sie Nahrung und Kleidung kaufen können. Jede Familie wird eine Wohnung haben. Nicht zwanzig Zigeuner werden in einem Raum leben, sondern eine Zigeunerfamilie wird ein ganzes Haus bewohnen. Vielleicht mit einem kleinen Garten dahinter, indem Sie Kohl züchten und Äpfel und was Sie möchten.“
Die beiden Männer hörten ihm still zu, sogen an ihren Pfeifen und nickten dann und wann andächtig. Wilhelm, der mit Widerspruch gerechnet hatte, schwieg einen Moment verwirrt und redete weiter. „Denken Sie an Ihre Kinder und Kindeskinder. Ich bin noch nicht lange hier, aber wie elend sie sind, das habe ich schon erkannt. Sie haben Läuse und Krätze und sie sind immer hungrig. Ich weiß, dass Sie Ihre Kinder lieben, sollten sie nicht satt sein und warm gekleidet?“
Wieder nickten die Männer, ohne etwas zu sagen.
„Und noch etwas: Ihre Kinder sollten lesen, schreiben und rechnen lernen. Ich muss Ihnen nicht sagen, wie wichtig das heutzutage ist, um sich im Leben zurechtzufinden. Sie wollen gewiss, dass die Kinder zu nützlichen Gliedern unserer Gesellschaft werden. Außerdem sollten Sie zu Gott beten. Wir werden Ihnen die Heilige Schrift näherbringen, damit Sie Hilfe und Trost darin finden.“
Wilhelm schwieg, alles, was er sich überlegt hatte, war gesagt. Er blickte die Männer fragend an.
Der bulibasha blies eine Rauchwolke gegen die Decke und richtete seinen Blick fest auf Wilhelm. „Das ist gut, was du da sagst. Doch wie willst du das alles schaffen? Bist du reich, dass du uns Wohnung geben kannst? Hast du Geld für Kleidung und einen Lehrer für unsere Kinder?“
„Der Lehrer will ich selbst sein. Auch meine Frau wird Ihre Kinder unterweisen. Häuser sind hier im Dorf genug frei, wir müssen sie nur instand setzen. Das Land wird sie uns zur Verfügung stellen, wenn der gute Wille erkennbar ist. Geld wird am Anfang aus Spenden kommen. Unser Ziel ist es, dass Sie einmal selbst in der Lage sind, Geld zu erwirtschaften. Alle erwachsenen Zigeuner im arbeitsfähigen Alter werden Arbeit haben. Ich helfe Ihnen dabei, welche zu finden. Und mit dem eigenhändig verdienten Geld können Sie Ihre Familie ernähren.“
Der alte Mettbach nahm die Pfeife aus dem Mund. „Selbst wenn wir nicht gearbeitet haben, hat Gott uns ernährt.“
Magdalena hatte bisher geschwiegen, jetzt schaltete sie sich ein: „Aber wie elend leben Sie dabei. Es ist nicht Gottes Wille, dass Sie ohne Arbeit sind. In der Bibel steht ausdrücklich, dass man im Schweiße seines Angesichtes sein Brot essen solle und Apostel Paulus sagt, wer nicht arbeite, der solle auch nicht essen.“
„Die Tiere des Waldes und die Vögel in der Luft, arbeiten sie etwa? Und Gott ernährt sie doch.“ Der alte Mettbach grinste schlitzohrig.
„Und frieren die Tiere nicht des Winters im Wald? Sie haben keine Wohnung, keine Öfen, an denen sie sich wärmen könnten.“ Magdalena sah ihn fragend an.
Der Alte nickte anerkennend. Er schien Spaß an dieser Debatte zu haben.
Wilhelm ergriff wieder das Wort. „Bis spätestens Ende nächsten Jahres wollen wir eine Schule errichten, in der Ihre Kinder tagsüber lernen. Abends kehren sie dann zu Ihnen zurück. Voraussetzung ist, dass jede Familie eine Wohnung hat und die Männer einer geregelten Beschäftigung nachgehen. Niemand soll mehr im Wald leben oder gar auf Reisen gehen. Ich werde damit anfangen, jedem Zigeuner, der jung und kräftig ist, eine Arbeitsstelle zu beschaffen. Meine Frau wird hier in dieser Stube beginnen, die Kinder zu unterrichten.“
„Die meisten von unseren jungen Männern arbeiten bereits. Georg spielt auf dem Jahrmarkt das Zimbal, die Söhne des alten Steinbach sind gute Scherenschleifer.“
Der alte Mettbach nahm die Pfeife aus dem Mund und begann mit dumpfer Stimme zu singen: „Bringt stumpfe Scheren und Messer raus, der Scherenschleifer steht vorm Haus!“ Er lachte mit zahnlosem Mund und verstummte unvermittelt wieder.
„Mein Sohn Christoph spielt Geige und seine Söhne“, der Bulibasha zeigte auf Mettbach, „sind geschickte Seiltänzer.“
„Wie oft können Ihre Söhne dieser Arbeit nachgehen? Ist etwa jeden Tag Jahrmarkt? Sie brauchen eine Tätigkeit, die sie jeden Tag ausüben, elf Stunden im Sommer und acht im Winter, Tag für Tag, außer sonntags. Nur dann werden sie genug und regelmäßig Geld verdienen und ihre Kinder ernähren und kleiden können.“
Der Bulibasha klopfte seine Pfeife auf den neuen Dielen aus. Magdalena versuchte, es zu ignorieren. Er sah den alten Mettbach an und sie nickten sich zu. „Wenn ihr für uns und unsere Kinder sorgen wollt, dann haben wir nichts dagegen. Doch wir wollen nicht verschweigen, dass uns gesagt wurde, dass ihr ein großes Zuchthaus bauen wollt, in das wir alle hineinkommen sollen, und ihr euch unserer Kinder bemächtigen würdet. Es heißt bei uns, der Wolf streichelt kein Schaf. Wir müssen euch das Versprechen abnehmen, dass ihr so etwas nicht tun werdet.“
Wilhelm richtete sich auf. „Meine Herren, ich schwöre Ihnen, wenn Sie es möchten, sogar auf die Bibel, dass niemand vorhat, ein Zuchthaus zu bauen. Wir werden Ihnen nicht die Kinder nehmen, im Gegenteil, wir wollen Ihre Kinder zu gescheiten, gottesfürchtigen und tüchtigen Menschen erziehen.“
Magdalena nickte und legte zur Bekräftigung ihre Hand aufs Herz. Sie hoffte, dass die beiden Männer diese Geste verstehen würden.
„Dann ist alles gesagt. Was wir besprochen haben, müssen jetzt alle wissen. Wir reden mit unseren Frauen und Söhnen, dass sie eurem Anliegen offen gegenüberstehen sollen.“ Der alte Mettbach nickte zu den Worten des Bulibasha, beide erhoben sich gewandt und verbeugten sich zum Abschied.
Als sie hinaus waren, standen Magdalena und Wilhelm sich einen Moment lang schweigend gegenüber, dann umarmten sie sich stumm. Die erste Schlacht war geschlagen. Ob sie auch gewonnen war, musste sich erst zeigen.