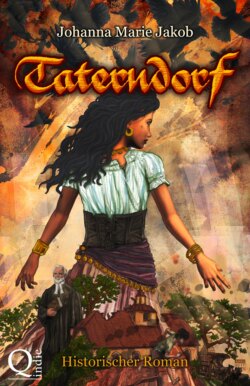Читать книгу Taterndorf - Johanna Marie Jakob - Страница 4
2. Vertrauen
ОглавлениеWo ich die Flamme bin,
sei du die Kohle.
Wo ich der Regen bin,
sei du das Wasser.
(Beschwörungsformel der Zigeuner)
Der Abschied vom Pfarrhaus fiel Magdalena nicht schwer, der von Christine dagegen schon. Sie hatte das Gefühl, die kleine Frau in ihrem elenden Alltag allein zurückzulassen. „Sie müssen mich besuchen, versprechen Sie mir das?“
Christines Augen huschten umher wie Mäuse auf der Flucht vor der Katze. Sie hatte Angst, das war unverkennbar. Gewiss hatte ihr Mann in weiser Voraussicht verboten, weiter Kontakt zu ihr zu halten. Magdalena sah Pastor Blume direkt an. „Sie haben doch nichts dagegen, wenn Christine uns besuchen kommt? Sie ist die einzige Frau, die ich hier im Dorf kenne.“
Der Pastor hielt ihrem Blick stand. Er antwortete nicht gleich, dann drehte er sich so, dass seine Frau seine Lippen nicht sehen konnte. „Sie sollten Christine da rauslassen, Frau Blankenburg. Sie hat es schwer genug in diesem Dorf. Wenn sie mit der Zigeunermission in Verbindung gebracht wird, dann wird es nicht leichter für sie.“
„Ich glaube, sie braucht den Kontakt zu den Menschen, Herr Pastor. Sie wird deswegen gemieden, weil sie so scheu ist. Die Leute halten sie für sonderbar, weil sie Christine nicht richtig kennen. Sie sollten Ihrer Frau mehr Freiheiten gönnen, sie könnte ein Juwel für Ihre Gemeinde sein.“ Magdalena hatte sich nicht abgewandt, ihr war es wichtig, dass Christine sie verstand.
Die Augen des Pastors wurden schmal. „Was wissen Sie denn von diesen Menschen hier? Sie sind gerade eine Woche da und wollen sie besser kennen als ich? Ich lebe seit dreißig Jahren hier, Christine ist hier aufgewachsen. Mir muss niemand erklären, wie ich die Leute zu nehmen habe. Aber ich bin sicher, Sie werden sie noch kennenlernen, die sturen Bauern und die Neudörfler, die alle irgendwelchen Dreck am Stecken haben.“ Er wandte sich ab.
Wilhelm räusperte sich. „Ich glaube, wir müssen los. Christian kann die Ziegenböcke kaum noch halten.“ Er schüttelte den Eheleuten die Hände. „Vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft. Wir sehen uns sicher zum Gottesdienst. Und wenn Sie Zeit haben, schauen Sie ruhig mal vorbei, vielleicht Sonntag zum Kaffee?“ Es klang halbherzig und der Pastor ging nicht darauf ein.
„Ich werde mir etwas einfallen lassen, um sie da wenigstens für ein paar Stunden rauszuholen“, sagte Magdalena, als sie mit dem Ziegengespann um die Ecke waren. „Er kann sie doch nicht einsperren. Sie könnte mir helfen und ich weiß, dass sie es gern tun würde.“
Wilhelm nickte. „Du hast recht, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, was genau sie tun sollte.“
„Während ich die Kinder unterrichte, könnte Christine für sie kochen, damit alle gleich nach der Schulstunde essen können.“
„Vielleicht kann ich kochen? In Basel bin ich der Köchin oft zur Hand gegangen.“
Magdalena sah ihn erstaunt an. „Du musst Arbeit für die Männer suchen. Du musst Gelder auftreiben, Behördengänge erledigen. Du wirst den Bau des Sittigungshauses leiten und keine Zeit haben, mir zu helfen.“
Ein scharfer Wind kam auf und blies das gelbe Laub von den Obstbäumen über die Dorfstraße. Wilhelm zog seinen Mantel enger zu. Magdalena hatte alles bereits durchdacht. Beschämt gestand er sich ein, dass er bisher ins Blaue hineingelebt hatte. Wenigstens in den letzten Tagen auf dem Krankenlager hätte ein Plan in seinem Kopf entstehen müssen. Stattdessen hatte er kostbare Zeit vergeudet.
„Wenn Christine nicht kommen darf, finden wir jemand anderen, der für die Kinder kocht“, sagte er. „Ich werde Berthold fragen, wenn ich ihm nachher die Ziegenböcke zurückbringe, ob er nicht jemanden kennt, der dafür geeignet ist.“
„Käthchen kann gut kochen.“ Christian, der die Böcke führte, mischte sich ein. „Sie wohnt in den 22 Häusern. Manchmal gibt sie uns zu essen. Sie jagt uns nie weg und was sie kocht, schmeckt wirklich gut.“
„Kannst du mich zu ihr bringen, vielleicht morgen?“
Christian nickte verdrossen.
„Was ist heute los mit dir? Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen?“, fragte Wilhelm, der sich schon geraume Zeit über die Einsilbigkeit des sonst so lebhaften Jungen wunderte.
„Ich habe keine Läuse. Mutter reißt mir den Kopf ab, wenn ich welche nach Hause bringe.“
„Das war nur im übertragenen Sinn gemeint. Du wirkst traurig.“
„Ich denke die ganze Zeit, dass ihr jetzt nicht weit vom Backhaus wohnt und euer Brot sicher selbst holen werdet.“
„Was ist so schlimm daran?“, fragte Wilhelm begriffsstutzig.
Magdalena griff nach seinem Arm. „Du machst dir Sorgen um deinen Botenlohn, stimmt‘s?“
Christian nickte. „Mutter war stolz auf mich, weil ich immer Brot für die Kleinen beschafft habe.“
„Sieh mal, deine Geschwister werden zu mir in die Schule kommen. Dort erhalten sie jeden Tag eine warme Mahlzeit, vielleicht kocht Käthchen für sie.“
Der Junge schien um keinen Deut erleichtert. „Kann ich auch in deine Schule kommen?“
„Nun, ja …“ Magdalena war versucht, ihm übers Haar zu streichen, wobei sie feststellte, dass er genau so groß war wie sie selbst.
Christian sah sie niedergeschlagen an. „Ich bin zu alt.“
Wilhelm nickte. „Du bist groß und kräftig. Genau genommen könntest du schon arbeiten gehen. Wir müssen uns überlegen, wo die Altersgrenze unserer Schüler sein soll.“
Magdalena seufzte. Daran hatte sie nicht gedacht.
„Wir werden von Fall zu Fall entscheiden“, sagte Wilhelm.
Sie hatten das Fuhrwerk leer geräumt und Christian damit zu Berthold, dem Stiernacken, geschickt. Zum ersten Mal waren sie allein in ihrem neuen Zuhause. Magdalena wedelte mit einem Federwisch über Tisch und Stühle und lächelte zufrieden.
„Was denkst du?“, fragte Wilhelm.
„Oh, ich denke so vieles gleichzeitig. Womit beginne ich den Unterricht, was koche ich für die Kinder, wann schreibe ich meinen Eltern? Ich muss ihnen unbedingt Nachricht senden, sie werden sich sorgen. Vater könnte für uns Spenden in Nürnberg sammeln, meinst du nicht?“ Eine vorwitzige Haarsträhne fiel ihr immer wieder ins Gesicht und sie pustete sie energisch nach hinten.
Wilhelm zog sie an sich. „Was würde ich nur ohne dich anstellen?“, murmelte er und küsste sie auf die Stirn. Sein Blick fiel auf die Schlafkammertür.
Sie lächelte spitzbübisch. „Na jedenfalls nicht …“
Ein Klopfen unterbrach sie. Einen Moment lang sahen sie sich verdutzt in die Augen. „Schon wieder Christian?“
Er öffnete die Tür. Im Halbdunkel des ausklingenden Tages stand eine breite Männergestalt mit einem Hut. Vor dem Bleigrau des Himmels wirkte die Silhouette beinahe bedrohlich. „Ja?“
„Herr Blankenburg?“
„Ja.“
Der Mann griff nach oben und zog seinen Hut vom Kopf. Hervor kamen helle Locken, die sich wie Sprungfedern in alle Richtungen ausbreiteten. Ein leichter Stallgeruch wehte ins Haus. „Ich bin der Dorfschulze, Wilhelm Henkel, Schäfermeister auf dem Amt.“
Während Wilhelm noch immer auf eine Erklärung für den unangemeldeten Besuch wartete, drängte sich Magdalena nach vorn. „Treten Sie ein, Meister Henkel. Bitte!“
Verdattert machte Wilhelm den Weg frei. Derbe Stiefel polterten in die Stube und hinterließen feuchte Abdrücke auf den Brettern. Magdalena unterdrückte den Impuls, zum Wischlappen zu greifen. „Nehmen Sie Platz!“
Der neue Stuhl knarrte, als er sich am Tisch niederließ. Sie zündete die Lampe an und der Mann bekam ein Gesicht. Helle Augen blitzten unter dichten Augenbrauen hervor, ein Rest Sommerbräune betonte eine rosa Narbe, die sich über die rechte Wange zog. In seinen Locken glänzten bereits silbrige Strähnen, doch er strahlte eine Jugendlichkeit aus, die Magdalena im Stillen auf seine Arbeit an der frischen Luft zurückführte.
„Was führt Sie zu uns?“, fragte Wilhelm und setzte sich.
Der Mann hob die Augenbrauen und sah ihn direkt an. „Es gibt Gerüchte im Dorf, denen ich als Schulze nachgehen muss.“
„Was für Gerüchte?“
„Es heißt, Sie wären hier, um die Tatern sesshaft zu machen.“
„Und wenn es so wäre?“
„Wir wollen diese Schmarotzer hier nicht. Sie bringen nur Ärger. Und davon haben wir schon genug mit den Zugezogenen vom Eichsfeld.“ Seine schwieligen Hände zupften an Magdalenas Tischtuch.
Sie horchte auf. „Ärger?“
Der Mann sah sie erstaunt an, als sollte sie die Antwort bereits kennen. „Die schwarzen Vögel stehlen wie die Raben.“ Er grinste vor Freude über sein Wortspiel. „Unsere Bauern müssen nachts die Felder bewachen, sonst finden sie am nächsten Morgen nur leere Furchen. Sie klauen Brennholz und holen die Hühner aus den Ställen, schneller als ein Fuchs es vermag.“
Wilhelm neigte den Kopf. „Wenn sie arbeiten gehen würden und ein Einkommen hätten, dann müssten sie nicht für ihr Überleben stehlen. Genau das wollen wir erreichen.“
„Arbeiten?“ Der Mann schnaufte und schüttelte seine Locken. Der Schafgeruch verstärkte sich. „Da müsste wohl ein Wunder geschehen.“
„Mit Gottes Hilfe auch das“, erwiderte Wilhelm salomonisch und Magdalena verkniff sich ein Lächeln.
„Sie sagten etwas von Ärger mit den Zugezogenen?“, fragte sie.
Der Schäfermeister hob die Stimme. „Was glauben Sie, wen sie uns damals geschickt haben, die Schwarzkittel? Als Weber angeworben wurden, kamen nicht die ordentlichen und fleißigen Leute, die hatten ihr Auskommen in ihrer Heimat längst gefunden. Es kamen die, die man dort loswerden wollte, die Schurken, Diebe und Halsabschneider. Ja, es war sogar ein verurteilter Mörder darunter, der seine Strafe abgesessen hatte und nun einen Neuanfang suchte, dort, wo ihn niemand kennen würde.“
Magdalena riss die Augen auf. „Aber das ist doch lange her?“
„Über fünfzig Jahre, gute Frau. Einige von den Erstbewohnern leben noch. Der alte Toni zum Beispiel kam aus Italien, sein Sohn ist ein ehrbarer Schuster, aber der Alte ist ein Schlitzohr. Oder der Linzer, sein Vater wurde aus Österreich verwiesen, er hat nie erzählt, warum. Bei dem kriegen Sie alles, was Sie brauchen, für den halben Preis. Was denken Sie denn, warum die Tatern ausgerechnet hier immer wieder Unterschlupf suchen? Weil sie hier Ihresgleichen finden und ihr Diebesgut verhökern können.“
Wilhelm erkannte seine Möglichkeit. „Gerade aus diesem Grund müssen die Zigeuner endlich eingebunden werden. Wenn sie nicht mehr gezwungen sind, zu stehlen …“
Der Mann lachte abfällig. „Die können doch nichts anderes.“
„Ich werde den Männern einen Beruf suchen und werde sie lehren, diesen auszuüben. Ich habe viele gesunde und kräftige Männer unter ihnen gesehen, die im Wald arbeiten können. Beginnen jetzt nicht die Holzfällerarbeiten? Mit der Axt umzugehen kann jeder lernen. Im Frühjahr bringe ich sie im Straßenbau unter. Der Landrat von Arnstedt sagte mir, dass die Straße nach Mühlhausen ausgebaut und gepflastert werden soll. Das wird eine passende Arbeit für meine Zigeuner sein.“
Magdalena registrierte, wie enthusiastisch Wilhelm auf den Schulzen einredete, sogar „meine Zigeuner“ hatte er gesagt. In der Miene des Schäfermeisters erkannte sie jedoch Unwillen und Zorn.
„Sie kennen diese Menschen nicht. Sie verhalten sich ganz anders als Leute unseres Schlages. Sie sind weltfremd und töricht, mein Herr. Sie werden genauso scheitern wie die Missionare vor ihnen.“ Beim letzten Satz hieb Henkel auf den Tisch, dass die Platte aus Kiefernholz erzitterte.
Doch Wilhelm ließ sich nicht erschüttern. „In jedem Menschen steckt ein guter Kern, Herr Henkel. Daran glaube ich fest, auch wenn Sie es für Torheit halten. Wenn die Zigeuner merken, dass ihnen die Arbeit gelingt, wenn sie die Früchte ihres Werkes vor sich sehen, dann werden sie sich anstrengen und bessern. Sie werden ordentliche Löhne in den Taschen haben und ihre Familien ernähren. Dann können sie sich die Miete für ein eigenes Häuschen leisten, Hühner kaufen und gegen die übliche Pacht Brennholz aus dem Wald holen.“
Henkel schnaubte verächtlich. Eine Weile war das Knistern der Flammen in dem eisernen Ofen das einzige Geräusch in der Stube.
„Möchten Sie etwas trinken, Meister Henkel?“, fragte Magdalena, als die Stille peinlich wurde.
„Nein. Ich muss gehen.“ Er erhob sich und drückte die Schultern nach hinten. „Leider kann ich Ihnen keinen Erfolg wünschen, denn ich sehne mir das Rabenvolk ganz weit von meinem Dorf weg. Wenn Sie jedoch anderweitig Hilfe benötigen, scheuen Sie sich nicht, mich aufzusuchen. Ich wohne in den 22 Häusern, Hausnummer drei, fast oben am Teich.“ Er reichte Magdalena die Hand und verbeugte sich leicht. „Allerdings bin ich erst abends zu Hause, nach Einbruch der Dunkelheit.“
„Kennen Sie Käthchen?“, fragte Magdalena.
Er hielt inne. „Welches Käthchen meinen Sie?“
„Die Zigeuner sagen, sie kocht sehr gut und gibt auch gern.“
„Das ist Henkels Käthchen, die Frau meines verstorbenen Bruders. Warum wollen Sie das wissen?“
Wilhelm beeilte sich, seiner Frau zuvorzukommen. „Wir suchen jemanden, der uns ein wenig im Haushalt hilft.“ Er fürchtete, dass der Schulze es nicht gut heißen würde, wenn seine eigene Schwägerin dabei half, die Zigeunerkinder zu verköstigen. „Meine Frau ist guter Hoffnung, wir werden tatkräftige Unterstützung benötigen, vor allem, wenn das Kind da ist.“ Er ging voran zur Tür.
„Es täte ihr sicher gut, wieder eine Aufgabe zu haben. Seit dem Tod meines Bruders lässt sie sich ein wenig gehen. Ich rede mit ihr.“
Während Wilhelm dem Mann mit einer Lampe half, den Weg auf die dunkle Dorfstraße zu finden, griff Magdalena nach einem Wischlappen.
„Von ihm werden wir keine Hilfe erwarten können“, kommentierte Wilhelm. Er öffnete die Ofentür und legte ein dickes Buchenscheit ins Feuer. Sofort züngelten kleine blaue Flammen danach.
„Wenigstens war er ehrlich und wir wissen, woran wir sind“, antwortete Magdalena unter dem Tisch hervor, wo sie die Fußspuren des Schulzen aufwischte. „Wir brauchen unbedingt einen Abtreter vor der Tür.“
Auszug aus einem Briefe, vom 14ten November 1830, den Blankenburgs Frau an ihre Geschwister in Nürnberg schrieb:
„… Die Gegend um Friedrichslohra ist sehr schön, und es werden Getreide, Kartoffeln und Gemüse aller Art angebaut. Kleine Häuschen, ganz im Grünen liegend, bilden das Dorf. Auf einem hohen Berge, der das Amt Lohra genannt und vom Amtmann Smalian bewohnt wird, ist eine kleine protestantische Kirche. Die Aussicht von der Höhe herab gewährt für Auge und Herz einen tiefen Eindruck von der Größe des allmächtigen Schöpfers. Man übersieht das ganze Harz- und Eichsfeldische Gebirge.
Die Neudörfer sind größtenteils Leute, die des Diebstahls oder anderer Verbrechen wegen des Landes verwiesen wurden, und die Friedrich der Große in dieses Dorf aufnehmen ließ, und da ist es wohl nicht befremdend, dass Freikauferei auf Märkten und Messen, Betrug und List unter ihnen herrscht. Unter diesen Leuten wohnen unsere armen Zigeuner, und werden oft recht übel von denselben behandelt, was uns recht betrübt. In kleinen Stuben wohnen meist zwei bis drei Zigeunerfamilien beisammen, und müssen doch viel Miete zahlen. Kommt man des Abends zu ihnen, so sitzen oder liegen sie auf der schwarzen, schmutzigen Erde umher, welche zugleich als Tisch, Stuhl und Bette dienen muss, und sind voller Schmutz und Läuse. Des Nachts liegen sie alle nackt auf dem Boden umher, und benutzen ihre wenigen Lappen als Decken. Ach, die Armut ist unbeschreiblich! Und wird durch ihr leidenschaftliches Branntweintrinken, durch Tabak rauchen und kauen, und durch große Nachlässigkeit und Faulheit noch vermehrt …“
Am nächsten Morgen brach Wilhelm im Dunkeln nach Nordhausen auf, um mit dem Landrat über Spendenaufrufe und Arbeitsbeschaffung für die Zigeuner zu reden. Magdalena räumte das Geschirr vom Tisch, stopfte die Kochwäsche zum Einweichen in eine hölzerne Wanne und machte sich schließlich auf, die Schwägerin des Dorfschulzen zu besuchen. Sie ging die Dorfstraße hinab, auf der sie vor drei Wochen in Friedrichslohra angekommen waren. Ein kalter Wind wehte ihr entgegen und trieb den letzten Frühnebel vor sich her. Sie wickelte ihr Kopftuch fester um den Hals. Die Hausnummern zählten rückwärts, rechts die geraden und links die ungeraden Zahlen. Das Haus mit der Nummer eins bildete den Abschluss an einem kleinen, nach Jauche stinkenden Bach. Der von Fuhrwerken zerfahrene Weg überquerte ihn mithilfe einer Kalksteinbrücke und führte aus dem Dorf hinaus, leicht bergab zu der Wegkreuzung, wo sie am Tag ihrer Ankunft den Zigeunerwagen verlassen hatten. Sie schritt über die Brücke und wandte sich nach links, wo eine weitere Straße in einem schmalen Tal aufwärts führte.
Auf deren rechten Seite standen kleine Fachwerkhäuser, die sich ähnelten, als seien sie alle von derselben Hand erschaffen worden. Doch die Grundstücke waren großzügiger angelegt, die Häuser klebten nicht aneinander wie reife Erbsen in der Schote, sondern sie hockten, jedes für sich, inmitten von Gemüsegärten, Beeten mit letzten Herbstblumen und Holunderbüschen voller fetter schwarzer Beeren, um die sich die Spatzen lautstark stritten. Hier war der preußische König wohl spendabler bei der Vergabe von Grund und Boden gewesen. Gegenüber der Häuser, auf der linken Straßenseite, zogen sich schmale Äcker wie Handtücher bis zum Bach hinunter.
„No. 17“ Eine mit schwarzer Farbe ins helle Fachwerk gepinselte Zahl ließ sie innehalten. Hier sollte Käthchen wohnen. Dem Haus war anzusehen, dass ein Mann fehlte. Ein Dachziegel hatte sich gelöst und drohte herabzurutschen. Die Kletterrose hangelte sich ungezügelt unter dem Dachkasten entlang und der Gemüsegarten war nicht umgegraben worden. Das kleine Gartentor hing nur in einer Angel; Magdalena musste es anheben, um es zu öffnen. Sie klopfte an der verwitterten Haustür. Es blieb still im Haus. Als sie versuchte, durch ein schmales Fenster nach drinnen zu blicken, drang eine energische Stimme über ein paar Stachelbeerbüsche, die wohl die Grenze zum Nachbargrundstück bildeten.
„Wollen Sie zu mir?“
Magdalena reckte den Hals, konnte jedoch niemanden sehen. „Ich suche die Witwe Henkel.“
„Ja, dann kommen Sie mal rüber, Kindchen!“
Vor dem Nachbarhaus stand eine kleine, dralle Frau, die eine schmuddelige Schürze über ihr dunkles Kleid gebunden hatte. Das weiße Haar trug sie streng zurückgekämmt, im Nacken saß ein Haarknoten wie eine reife Zwiebel.
„Man hat mir gesagt, Sie wohnen in Nummer 17. Ich bin Magdalena Blankenburg.“ Sie streckte der Frau die Hand entgegen. Dabei musste sie sich beinahe bücken.
„Das stimmt. Ich helfe nur meiner Nachbarin. Riekchen hat sich den Fuß gebrochen. Ich füttere ihre Hühner und tröste sie ein wenig.“ Sie hob den Kopf und ihre lebhaften braunen Augen musterten Magdalena genau. Ihr Gesicht war faltig und sie mochte wohl die Sechzig überschritten haben, doch sie wirkte voller Energie. „Sie sind also die Missionarsfrau, für die ich kochen soll?“
Magdalena zog die Augenbrauen nach oben. „Sie wissen bereits Bescheid?“
„Kindchen, das hier ist ein Dorf. Außerdem kenne ich den Dorfschulzen gut.“ Sie zwinkerte ihr zu. Dann steckte sie den Kopf durch die Tür hinter ihr. „Riekchen, ich komme gegen Mittag und bringe dir dein Essen.“ Sie griff sich ein wollenes Tuch, das über der Türklinke gehangen hatte, und wickelte es sich um Kopf und Schultern. „Kommen Sie, zeigen Sie mir Ihr Haus und Ihre Küche. Nebenbei können wir reden.“
„Sie würden uns also helfen?“
„Aber ja. Ich kann nicht gut Nein sagen. Und wenn mein Schwager meint, ich soll die Finger davon lassen, dann ist das für mich umso mehr Ansporn.“
„Er hat Ihnen abgeraten?“
Die Frau kicherte. „Bestimmt hat er Ihnen etwas völlig anderes erzählt, nicht? Er ist nicht umsonst Schulze geworden. Er lügt so schnell, dass die Balken das Verbiegen nicht schaffen.“
„Wann hat er denn mit Ihnen gesprochen?“
Käthchens kurze Beine eilten über die Brücke und Magdalena musste sich beeilen, um nicht zurückzubleiben. „Gestern Abend. Es war schon dunkel. Er sagte, Sie würden mich als Haushaltshilfe benötigen, aber ich solle die Stelle auf keinen Fall annehmen, da ich gewiss für das ‚Taternpack‘ kochen müsste.“
„Mein Mann hatte das extra nicht so deutlich ausgedrückt.“
Die Frau blieb stehen. „Mein Schwager ist nicht dumm. Er durchschaut die Menschen schnell. Sie sollten sich vor ihm in Acht nehmen.“
Magdalena schnaufte atemlos, als sie vor ihrem Haus angekommen waren. „Diese Straße ist so steil. Wie schaffen Sie das nur, so schnell zu laufen und nebenbei zu reden?“
Käthchen lachte lauthals. „Steil? Kindchen, dies hier ist eine der bequemeren Straßen im Dorf. Sie sollten meinen Schwager mal besuchen, die 22 Häuser hinauf zum Teich. Und waren Sie schon auf dem Schloss Lohra?“ Sie deutete mit dem Finger in Richtung des Waldes, der sich hinter dem Haus auf dem Bergrücken entlang zog. „Nein? Die Evangelischen gehen sonntags zum Gottesdienst auf den Schlossberg hinauf. Danach reden wir noch mal über steile Wege.“ Sie prustete leise vor sich hin.
„Sie gehen zum Gottesdienst auf den Berg?“ Heute kam sie aus dem Staunen nicht heraus. „Es gibt doch in Wenden die protestantische Kirche.“
„Pah, die hochnäsigen Bauern wollen uns arme Wollspinner dort nicht sehen. Nein, wir sind schon als Kinder auf das Amt geklettert, jeden Sonntag, bei Wind und Wetter. Es gibt dort eine kleine Kapelle, sie stammt aus den Zeiten, als es da oben noch Ritter und Edelfräulein gab. Und wenn Sie nach dem Abstieg wieder nach Hause kommen, schmeckt der Sonntagsbraten umso besser.“ Sie wies auf die Haustür. „Wollen wir nun hineingehen?“
In der Kammer hinter dem Hausflur drehte sich Käthchen mehrmals um sich selbst und schüttelte den Kopf. „Hier müssen wir viel ändern. Für wie viel Leute soll ich denn kochen?“
Magdalena schämte sich für die Armseligkeit des Raumes, der den Namen Küche sicher nicht verdient hatte. „Ich weiß nicht“, antwortete sie leise. „Erst mal für die Kinder, die hier zum Unterricht kommen. Ich habe keine Vorstellung davon, wie viele das sein werden.“
„Wenn sich herumspricht, dass es zu Essen gibt, dann werden es sehr bald zwei Dutzend Kinder sein.“ Käthchen begutachtete die Töpfe, die der Krämer hatte liefern lassen. „Immerhin, die sind nicht schlecht. Vielleicht ein bisschen klein. Mal sehen. Haben Sie eine Fußbank?“
Magdalena holte die Holzbank aus der Stube, auf der sie abends beim Nähen die Füße abstellte.
Käthchen rückte sie vor den Herd und kletterte hinauf. „So ist es besser.“ Sie strich über die Herdplatte, die Magdalena zu ihrer eigenen Erleichterung blitzblank geschrubbt hatte. „Hier oben lassen wir ein paar Regale anbringen. Da kommen die Töpfe drauf. Die stehen sonst im Wege rum. Drunter hängen wir Schöpfkellen und Rührbesen auf.“ Sie drehte sich um. „Schwarzburger hat Ihre Möbel angefertigt, nicht wahr?“
„Ja.“ In diesem Dorf blieb wirklich nichts verborgen.
„Der wird das Regal bauen. Schicken Sie einen Boten zu ihm. Was soll ich heute kochen?“
„Heute schon?“
„Worauf sollen wir warten? Die Kinder kommen sowieso zu mir, um zu betteln. Wir dürfen nur das Riekchen nicht vergessen.“ Käthchen rückte die Töpfe hin und her.
„Aber ich habe keine Zutaten. Mein Mann ist nach Nordhausen gegangen, der Landrat wird ihm erst sagen, wie viel wir ausgeben dürfen.“
Käthchen sah sie nachdenklich an. „Mein Schwager ist ebenfalls zum Landrat bestellt. Er war deswegen nicht begeistert.“
„Davon hat er gestern nichts gesagt.“
„Er lässt sich nicht gern in die Karten sehen. Er will in seinen zwei Jahren so viel wie möglich zu seinen Gunsten ändern.“
„Zwei Jahre?“
„Eins davon ist schon um. Das hat er Ihnen nicht erzählt, was?“ Käthchen grinste abfällig. „Alle zwei Jahre wechseln die Schulzen, mal ein Evangelischer, mal ein Katholischer. Das hat der Alte Fritz bei der Stiftung des Dorfes so festgelegt. Ab nächstes Jahr werden wir wieder von den Katholiken regiert.“
Käthchen wischte mechanisch über den Küchentisch und wandte sich zum Gehen. „Also, eine Suppe geht immer. Kartoffeln haben Sie, wie ich sehe. Ich habe ein paar Stücke Ziegenkalunnen, die werfen wir rein. Sellerie, Kohlrabi, Maggikraut. Ich bin bald wieder da. Bringen Sie schon mal das Feuer in Gang. Und schicken Sie jemanden zu Schwarzburger.“
Magdalena fühlte sich ein wenig überrollt, aber glücklich. Endlich kamen die Dinge ins Laufen. „Frau Henkel?“, rief sie ihr hinterher, als sie schon fast zur Tür hinaus war.
Die kleine Frau drehte sich um. „Also Kindchen, das hört sich schrecklich an. Alle sagen Käthchen zu mir.“
„Gut, ich heiße Magdalena. Oder Lenchen.“
„Was wolltest du sagen, Lenchen?“
„Danke für alles!“
Die Tür fiel ins Schloss, um gleich darauf wieder aufgerissen zu werden.
Sie fuhr herum. Vor ihr stand der Zigeunerjunge. „Christian, du sollst doch klopfen, bevor du hereinkommst!“
„Hab ich vergessen. Käthchen sagt, hier gibt es heute Essen?“ Seine Augen leuchteten bereits.
„Ja, aber nur für Kinder. Sag das bitte allen.“ Als sein Blick sich trübte, ergänzte sie rasch: „Du kannst dich ausnahmsweise zu den Kindern zählen. Doch jetzt sollst du für mich zum Tischler nach Wenden laufen. Bitte ihn, wegen eines Regales zu kommen, er soll Maß nehmen. Dann gehst du zu dem Bauern, der die schwarz-weißen Kühe hat. Bringe bitte eine große Kanne gute Milch. Sag, es ist für den Herrn Blankenburg.“
Christian druckste. „Du musst mir Geld mitgeben, Frau Blankenburg. Einem romnitschel geben sie sonst nichts.“
Sie musste mit den Bauern reden. Wenn sie Christian als ihren Laufburschen akzeptierten, würden sie sicher anschreiben. Sie kramte in ihrer Börse und gab ihm ihre letzten Pfennige. „Hier, das sollte reichen.“ Hoffentlich brachte Wilhelm Geld mit aus Nordhausen.
Sie holte Brennholz und fachte das Feuer im Herd an. Dann schleppte sie Wasser aus dem Angerbrunnen heran, setzte den größten Topf auf die Herdplatte und legte die weiße Linnenwäsche hinein. Bevor Käthchen ihre Küche in Beschlag nahm, musste sie ihre Wäsche schaffen. Ein viertel Stück Kernseife dazu, sie hatte sie letzte Woche vom Krämer geholt. Während das Wasser sich erwärmte, setzte sie sich an den Stubentisch, wo der Brief an ihre Eltern lag. Sie wussten bisher nur, dass sie angekommen waren, das hatte sie gleich in den ersten Tagen kurz auf einer Postkarte berichtet. Doch die Mutter würde sich sorgen, ob es ihrer Tochter wirklich gut ging.
Ach Maman, dachte Magdalena und lächelte wehmütig, wenn du wüsstest, dass ich Wasser schleppe und sogar die Wäsche selbst erledige. Das durfte sie der Mutter nicht schreiben, sie würde sich nur unnütz aufregen. Ihr Blick flog über die zierlichen schwarzen Buchstaben, die bereits eine Seite bedeckten. Dann griff sie zur Feder, um den Brief zu beenden.
„… Es sind wohl an die achtzig Zigeuner, die wir zu betreuen haben, das Herz schmerzt einem, sie so zu sehen. Ich bin froh, dass ihnen endlich geholfen wird, vor allem noch vor dem Winter. Sie sind allesamt katholisch getauft, doch ihrer Kirche scheint ihr Schicksal vollkommen egal zu sein. Jedenfalls erhalten sie von der hiesigen Gemeinde keinerlei Unterstützung. Heute wollen wir zum ersten Mal für die Kinder kochen, ich habe eine fleißige Küchenmamsell gefunden. Noch fehlt es an allem, wir wären euch sehr dankbar, wenn ihr Spenden auftreiben könntet. Warme Kinderkleidung, Schuhe und Decken sind natürlich besonders vonnöten, aber auch Geld können wir gut gebrauchen. Mein lieber Wilhelm ist gerade …“
Aus der Küche drang ein alarmierendes Geräusch, sie ließ die Feder fallen und rannte hinaus. Der Deckel tanzte auf dem Topf, das schäumende Wasser kochte über und große Wasserperlen ruckelten zischend über die Herdplatte. „Himmeldonnerwetter!“, fluchte Magdalena und biss sich gleich darauf auf die Zunge. Wo waren die Topflappen? Sie griff nach einem Handtuch und zerrte den Deckel vom Topf. Weißer, feuchter Dampf füllte im Nu den kleinen Raum und der Seifengeruch nahm ihr den Atem. Sie tastete nach dem Wäschekorb, trat einen Schritt nach vorn und stolperte über die Fußbank, die Käthchen hatte stehen lassen. Der Schmerz fuhr durch ihr Schienbein bis hinauf in den Magen, instinktiv suchte sie Halt, um nicht zu fallen. Sie griff nach dem eisernen Umlauf, der den Herd umgab, fasste jedoch daneben und erwischte die heiße Platte. Unsanft fiel sie in den leeren Wäschekorb, wo sie nach Luft schnappend liegenblieb. Das Brennen in ihrer rechten Handfläche trieb ihr die Tränen in die Augen. Besorgt lauschte sie in ihren Körper hinein, doch sonst schien alles in Ordnung. Sie strich mit der linken Hand über ihren Bauch. „Tut mir leid, mein Kleines, ich muss vorsichtiger sein.“ Langsam rappelte sie sich auf. Der Wassereimer war leer. Sie brauchte dringend etwas zum Kühlen. Das Gras auf dem Hof war nass, das würde zunächst reichen.
Als Käthchen zurückkam, hockte Magdalena hinter dem Haus und strich mit der Hand durch das feuchte Gras. „Lenchen, ist alles in Ordnung mit dir?“, rief die kleine Frau, die das Durcheinander in der Küche bereits gesehen hatte.
„Ich habe mir die Hand verbrannt.“
Käthchen kam auf den Hof, eine Schüssel mit Innereien knallte neben Magdalena ins Gras. „Wie ist das passiert? Zeig mal her!“
Doch Magdalena hatte nur Augen für das blutige Geschlinge und Gekröse neben sich, das den strengen Geruch nach toter Ziege verbreitete. Während Käthchen die Blasen auf der Handfläche musterte, übergab sie sich würgend direkt neben der Schüssel.
„Lenchen, du legst dich jetzt hin. Ich kümmere mich um alles andere.“ Käthchen zog sie nach drinnen, half ihr aus dem Überkleid und brachte sie ins Bett.
„Aber das Essen für die Kinder?“, wagte sie einen schwachen Einwand.
„Denkst du, das kann ich nicht allein? Hab schon öfter ein paar Kellen mehr gekocht. Ich bring dir eine Schüssel kaltes Wasser, da kannst du die Hand hineinhalten.“
„Ich habe Christian nach Milch geschickt. Die sollen die Kinder trinken. Wir müssen sie jedoch verdünnen, sonst reicht sie nicht.“
„Mach ich alles. Der Christian kann mir helfen. Ist schließlich für seine Sippe.“
„Er ist ein ordentlicher Junge.“
„Ach weißt du, wenn du die schwarzen Vögel einzeln nimmst, sind sie alle in Ordnung.“ Käthchen zwinkerte ihr zu und verschwand. Bald darauf hörte Magdalena Klappern aus der Küche und sie schloss beruhigt die Augen.
Dann fiel ihr der Brief ein. Wie sollte sie den mit der verletzten Hand beenden? Maman würde sofort merken, dass etwas nicht stimmte, wenn ihre Schrift plötzlich krakelte. Vielleicht könnte Wilhelm den Brief offiziell zu Ende schreiben?
„Verehrte Schwiegermutter, verehrter Schwiegerpapa, ich sende Euch meine herzlichen Grüße aus dem fernen Neuen Dorf. Viel Gutes kann ich leider nicht berichten. Es gibt kein Geld vom Landrat für unsere Mission, die protestantische Kirche sieht sich ebenfalls nicht in der Lage, uns zu helfen. Magdalena stellt sich im Haushalt ungeschickt an, erst heute hat sie sich die Hand verbrannt, bei dem Versuch Wäsche zu kochen. Wenn Ihr uns besuchen kommt, bringt bitte Lebensmittel mit, damit wir für Euch kochen können …“
Magdalena schreckte hoch. Ein bitterer Nachgeschmack drückte ihr das Herz ab, selbst dann noch, als sie begriff, dass sie nur geträumt hatte. Draußen hörte sie Geschirr klappern. Sie richtete sich auf, sofort begann ihre Hand wieder zu schmerzen. Zum ersten Mal konnte sie die Verletzung genauer betrachten. Sie zählte drei große und vier kleine Blasen, die prall mit gelber Flüssigkeit gefüllt waren. Sie würde sie aufstechen müssen, damit der Druck nachließ. Sie stand auf und griff nach ihrem Kleid. An ihrem Schienbein prangte ein dunkler Bluterguss, doch der war nebensächlich.
Als sie aus der Kammer trat, sah sie Christian in ihrer Stube Teller und Löffel zurechtlegen. Er hob den Kopf. „Das Essen ist gleich fertig. Käthchen sagt, auf einem Stuhl müssen zwei Kinder sitzen und sie sollen sich einen Teller teilen und in zwei Gruppen kommen, erst die Kleinen, dann die Größeren.“
„Das hört sich vernünftig an. Danke, dass du uns Käthchen empfohlen hast, sie ist wirklich eine Perle.“
Christian strahlte. Dann wurde sein Blick besorgt. „Was ist mit der Hand?“
„Ach, das wird schon wieder. Ich habe mich an der Herdplatte verbrannt.“ Sie half ihm, die Teller zu verteilen. In der Mitte des Tisches lag noch immer ihr Brief. Dort, wo die Feder hingefallen war, hatte sich ein daumennagelgroßer Klecks breitgemacht. Dem musste Wilhelm nachher mit dem Rasiermesser zu Leibe rücken. Sie schraubte das Tintenfass zu und räumte das Schreibzeug beiseite.
„Das sieht sehr schön aus“, sagte Christian und deutete mit dem Kinn auf den Brief. Hatte er etwa gelesen, was sie über die Sinti geschrieben hatte?
„Was meinst du?“
„Diese Zeichen auf dem weißen Papier, wie Ameisen laufen sie in einer Reihe. Ich würde gern schreiben können.“
„Ich werde es dir beibringen, versprochen.“ Sie stieß mit der verletzten Hand an die Tischkante und zuckte zusammen. „Autsch.“
„Ich kann die alte Tante Weiß fragen, sie kennt sich aus mit Krankheiten und so etwas. Sie kann die Wunden besprechen.“ Christian sah sie fragend an.
„Das ist nicht nötig. Ich werde die Blasen aufstechen, dann heilen sie schneller ab. Hast du Milch bekommen?“
Er nickte. „Ja, von den Schwarz-Weißen. Das Geld ist aber alle.“
„Das dachte ich mir schon, es waren ja nur zehn Pfennige.“
In der Küche roch es nach gekochter Ziege und nach Kernseife. Magdalena atmete flach, weil der Würgereiz sofort wieder da war. Käthchen stand auf der Fußbank, Herrin über drei Töpfe, aus denen fettiger Dampf aufstieg.
„Alles wieder gut?“, rief sie fröhlich und schwang den Kochlöffel.
Magdalena nickte und riss die Tür zum Hof auf. Gierig atmete sie die frische Luft ein.
„Na, wenn das nicht gelogen war. Hast du schon mit der Hebamme gesprochen?“
„Welche Hebamme?“
„Gütiger Jesus, in jedem Dorf gibt es eine Hebamme. Das sind die Frauen, die helfen, die Kinder zur Welt zu bringen, schon mal davon gehört?“ Sie hob einen Deckel an und ein Schwaden des fettigen Dampfes zog an Magdalena vorbei zur Tür hinaus.
„Ja. Und nein, ich weiß nicht mal, wie die Frau heißt und wo sie wohnt.“ Magdalenas Blick fiel auf eine quer über den Hof gespannte Wäscheleine, an der ihr Linnen zum Trocknen hing. „Du hast sogar die Wäsche fertig. Danke.“
„Der Junge hat mir geholfen, er ist wirklich in Ordnung, dafür, dass er ein Tater … ein Zigeuner ist.“
Sie fühlte, wie ihr die Röte ins Gesicht stieg. „Christian hat meine Unterhosen aufgehängt?“
Käthchen kicherte. „Nein, keine Sorge. Er hat nur die Leine gespannt. Wir haben sie im Holzschuppen gefunden.“
Magdalena erblickte die Milchkanne neben dem Herd, hob den Deckel und schnupperte vorsichtig.
„Die Hebamme heißt Martha Heinemann und wohnt in der Ziegelei, ganz oben am Ende der 22er Kolonie. Du solltest schon mal zu ihr gehen. Die Milch ist übrigens so dünn wie Molke, der Bauer hat den Jungen übers Ohr gehauen. Solche Geschäfte musst du hier selbst erledigen.“
Magdalena rührte mit dem Finger in der Milch, die bläulich schimmerte, und nickte erbost. „Das mach ich gleich nachher. Die Hälfte des Geldes kann ich zurückverlangen.“
„Wenn du willst, komme ich mit. Wann soll das Kleine kommen?“
„Im Mai hat der Arzt in Nürnberg gesagt.“
„So, so“, sie hob den Kopf und lauschte. „Die Glocken läuten Mittag. Mal sehen, ob die Kinder den Weg hierher finden.“ Ihre letzten Worte waren unnötig gewesen, denn von der Straße her hörten sie Stimmen.
Christian ging zur Tür. „Soll ich sie hereinlassen?“
„Warte, das will ich selbst tun.“ Magdalena lief an ihm vorbei und öffnete die Haustür. Draußen standen drei Mädchen im Alter von neun oder zehn Jahren, die sie erwartungsvoll ansahen. Zwei von ihnen waren nackt, eines trug ein graues Kittelchen voller Risse und Löcher. Ihre Haare starrten vor Schmutz, genau wie ihre Gesichter und Hände.
„Christian sagt, Käthchen kocht heute bei dir?“, fragte die Größte von ihnen ohne Scheu.
Magdalena überlegte fieberhaft, während sie nickte und in die Hocke ging, um mit den Kindern auf Augenhöhe zu sein. Auf keinen Fall würde sie diese nackten und schmutzigen Wesen in ihre Stube lassen. Warum hatte sie daran nicht früher gedacht?
„Ja, das stimmt. Wie heißt du, meine Kleine?“
„Sophie Deutsch, Madam gadschi.“
„Gut, Sophie. Wer ordentlich angezogen ist und gewaschen, der kann gern hereinkommen und essen. Es gibt eine gute Suppe und Milch.“
Das Mädchen machte einen Schritt nach vorn, die anderen zögerten. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Als die Große das bemerkte, beugte sie sich vor und flüsterte: „Die beiden haben aber kein Kleid.“
„So? Dann werden sie eines bekommen. Wartet einen kleinen Augenblick.“ Magdalena lehnte die Tür an und drehte sich um. Christian und Käthchen standen hinter ihr und sahen sie fragend an. „Christian, du holst zwei Eimer Wasser vom Brunnen. Wir waschen sie, bevor sie sich an den Tisch setzen. Käthchen, womit kann ich sie nur bekleiden?“
„Ich habe Linnentücher in deiner Wäsche gesehen. Daraus könnten wir schnell ein paar Kittelchen zaubern. Allerdings sind sie noch nass.“
„Ich hab noch mehr davon. Meine Maman hat mir eine Aussteuer geschickt, damit könnte ich eine ganze Armee versorgen.“ Sie lief in die Kammer zum Wäscheschrank. Wenn zwei Tücher gegeneinander genäht würden, dann gäbe das ein einfaches Hemd. Es wärmte zwar nicht wesentlich, aber bedeckte wenigstens den Körper. Doch das Nähen würde Zeit in Anspruch nehmen. Sie nahm einen Stapel von den weißen Leinentüchern und trug ihn in die Stube.
Käthchen schnappte nach Luft. „Aber das ist viel zu schade. Das ist feines Linnen und noch neu.“
„Ich kann sie nicht nackt am Tisch sitzen lassen. Das ist wider jede Sitte. Kannst du sie zusammennähen, während ich die Mädchen wasche?“
Die Köchin nickte widerwillig. Bedauernd strich sie über das weiße Leinenzeug. „Wo hast du deinen Nähkasten?“
Als Magdalena die Tür erneut öffnete, waren es bereits sieben Kinder, darunter zwei Jungen, die immerhin eine Hose trugen. Sie führte die Kinder zunächst nach hinten auf den Hof, wo sie sich in zwei Reihen vor den Eimern aufstellten. Sie schrubbte die Mädchen mit Kernseife ab. Wieder war sie entsetzt über die mageren Körper, die aufgetriebenen Bäuche und die wunden Hautpartien. Sie musste Salbe besorgen, um die Stellen einzureiben. Christian beaufsichtigte das Waschen und Kämmen der Jungen, was verdächtig schnell voranging. Sie selbst brauchte mehr Zeit, schließlich konnte sie nur die linke Hand benutzen und die dicken schwarzen Locken der Mädchen waren verfilzt und widerspenstig. Als sie endlich am Tisch saßen, faltete sie die Hände.
„Wir wollen beten und Gott danken für dieses Mahl.“ Sie sah die Kinder erwartungsvoll an, bis schließlich alle ihre Geste nachahmten. „Liebster Jesu, sei unser Gast und segne alles, was du uns bescheret hast. Amen.“ Die Kinder schwiegen und starrten auf die Teller mit der lauwarmen Suppe. Magdalena seufzte. „Ihr könnt jetzt beginnen. Lasst es euch schmecken.“
Käthchen hatte inzwischen genug Zeit gehabt, die Hemden fertigzustellen. Sie hatte sich nicht überwinden können, zwei Stücke für ein Hemd zu verschwenden, sondern wickelte jeweils eines der langen Tücher wie eine Toga um ein Mädchen herum und nähte die beiden Enden über einer Schulter zusammen, sodass die Kinder schließlich wie eine Schar kleiner Römer aussahen.
Magdalena lachte über diesen Anblick zufrieden und übermütig. „Schade, dass Wilhelm nicht da ist“, sagte sie und umarmte Käthchen spontan. „Ohne dich hätte ich das nie geschafft.“
„Gütiger Jesus, ich habe Riekchen vergessen. Die sitzt zu Hause und schiebt Kohldampf.“ Käthchen wickelte sich eilig in ihr Wolltuch. „Kommst du allein zurecht?“
„Aber ja. Christian ist auch noch da. Nimm ihr eine Schüssel von der Suppe mit. Und Milch.“ Sie griff zur Kelle.
„Suppe gern. Milch hat sie selbst, sie hat Ziegen.“ Käthchen öffnete die Haustür und rief über die Schulter: „Hier sind noch mehr Kinder. Hätte mich doch gewundert, wenn das schon alles gewesen sein sollte.“
Tatsächlich stand etwa ein Dutzend hungriger Mäuler auf der Straße vor dem Haus. Sie hatten offenbar abgewartet, wie es der ersten, mutigeren Gruppe erging, und waren nun nachgerückt.
Käthchen seufzte und legte den Umhang ab. „Riekchen muss eben warten.“ Und wieder wuschen Magdalena und Christian im Hof die mageren Körper, während Käthchen Milch ausschenkte und weitere Hemden nähte. Nachdem sie getrunken hatten, mussten sie die Stühle räumen für die zweite Gruppe. Sie wollten jedoch keineswegs gehen, sondern verteilten sich auf dem Fußboden in der Stube, um von dort aus zu beobachten, wie die anderen Kinder versorgt wurden. Erst als alle saßen und löffelten, kehrte etwas Ruhe ein. Auch Magdalena konnte sich setzen.
„Lauf nach Hause, jetzt schaffe ich das allein“, nickte sie Käthchen zu, die sich eilig verabschiedete.
Magdalena nutzte die Verschnaufpause, um die Kinder zu mustern und sich ihre Gesichter einzuprägen. Es schien auf den ersten Blick nicht einfach, sie zu unterscheiden. Ihre Haare waren einheitlich dicht, lockig und tiefschwarz; jetzt, wo sie gekämmt waren, lag ein metallisch-bläulicher Schimmer auf ihren Köpfen. Die Locken der Jungen kringelten sich ebenso ungebändigt wie die der Mädchen, und wenn sie nicht alle Kinder nackt gesehen hätte, würde sie kaum erkennen, wer von ihnen Junge oder Mädchen sei. Ihre Haut war dunkel, selbst jetzt im Herbst. Was sie am meisten beeindruckte, waren jedoch ihre Augen. Nicht nur, dass sie verhältnismäßig groß waren, die Iris schimmerte so schwarz, dass sie sich nicht von der Pupille abgrenzte. Dadurch bekamen die Gesichter den Ausdruck eines ständigen Staunens, und Magdalena hatte das unwillkürliche Bedürfnis, ein jedes von ihnen zu umarmen. Doch je länger sie die Kinder betrachtete, umso mehr Unterschiede erkannte sie. Etliche hatten eine leicht nach unten gebogene Nase, ähnlich wie Christian. Waren das vielleicht die Weiß-Kinder? Zwei der Jungen fielen durch abstehende Ohren auf, ein Mädchen hatte einen verstümmelten Zeigefinger. Sie beobachtete einen besonders kleinen Jungen, der kaum den Löffel halten konnte. Seine Arme waren nicht dicker als der Stiel eines Besens. „Wie heißt du?“, fragte sie ihn.
„Wilhelm“, flüsterte er, erschrocken, weil sie ausgerechnet ihn ansprach.
Sie lächelte. „Genau wie mein Mann. Wie alt bist du?“
Er hob die mageren Schultern und löffelte stumm weiter. Sie nahm sich vor, eine Kartei anzufertigen, in der sie die wichtigsten Fakten über jedes der Kinder aufnahm. Sie würde die Eltern befragen müssen. Vielleicht gab es Auffälligkeiten, Krankheiten, von denen sie wissen musste. Ihr Blick fiel auf ein Mädchen, dessen Rücken deutlich verkrümmt war. Ein anderes hatte eine Hasenscharte wie Christine, es quälte sich mühsam mit dem Löffel, die meiste Suppe floss wieder in den Teller zurück. Es kam vielleicht mit einer Tasse besser zurecht. Ob es sprechen konnte?
Sie stand auf und füllte etwas Suppe in einen leeren Milchbecher. „Versuch das mal, das geht bestimmt leichter.“ Sie hielt dem Kind den Becher hin.
Die Kleine sah sie schüchtern an, doch dann griff sie zu.
„Kann sie sprechen?“, fragte Magdalena das Mädchen, das daneben saß.
„Theresa? Ja, aber man versteht sie nicht gut.“
„Das macht nichts, wir werden uns viel Mühe beim Zuhören geben.“
Auf dem Fußboden wurde es unruhig. Die Kinder jagten sich um den Tisch herum und zogen die Sitzenden an den Hosenbeinen oder kniffen die Mädchen in die Waden. Es gab plötzlich Gekreisch und Stühlescharren, Löffel fielen klappernd auf die Teller.
„Seid leise, beim Essen muss es ruhig sein!“, rief Magdalena, doch es hörte niemand auf sie. Hilfe suchend blickte sie sich nach Christian um, der abwartend in der Tür stand.
Der grinste und rief etwas, das sie nicht verstand, nur das Wort „Gatschi“ hörte sie erneut heraus. Sofort kehrte Ruhe ein. Alle Kinder starrten sie an.
Sie nutzte die Gelegenheit: „Hört gut zu. Morgen beginnt der Unterricht. Zuerst die Mädchen, früh um neun. Die Jungen kommen dann zum Essen am Mittag dazu. Achtet auf die Glocken und seid pünktlich.“
„Sollen die Jungen nicht lernen?“, fragte Sophie.
„Doch, aber sie werden von meinem Mann unterrichtet, am Nachmittag. Für alle gleichzeitig ist hier kein Platz, das seht ihr ja.“
„Und was werden wir lernen?“, fragte ein größerer Junge, der sie sehr an Christian erinnerte.
Sie lächelte. „Das verrate ich nicht. Es soll eine Überraschung für euch sein. Aber eins ist klar: Wer morgen früh nicht sauber ist oder struppige Haare hat, muss wieder nach Hause gehen, habt ihr gehört?“
Die Tür fiel hinter dem letzten Kind ins Schloss. Magdalena sah ihnen durch das Fenster nach, eine kleine Schar in weißen Tüchern, wie loses Papier im Herbstwind wirbelten sie die Dorfstraße hinab und verteilten sich auf die Häuser. Was sie wohl ihren Eltern erzählen würden? Eine zufriedene Erschöpfung breitete sich in ihr aus. Der Anfang war geschafft. Ein kleiner Marienkäfer krabbelte an der Scheibe hinauf. Ein Glücksbringer. Willkommen, dachte sie, du kommst gerade recht.
Als sie sich vom Fenster abwandte, fiel ihr Blick auf das Chaos in der Stube. Teller, Löffel, Tassen standen und lagen auf und sogar unter dem Tisch, dessen Holzplatte fettig glänzte. Wie sollte sie das Geschirr säubern mit den Brandblasen an der Hand? Christian war verschwunden, sie konnte es ihm nicht verdenken. Er hatte heute sicher schon mehr gearbeitet als sonst in einer ganzen Woche. Sie stapelte die Teller und schaffte sie in die Küche, wo die Töpfe mit kalten Suppenresten auf dem Herd standen und Kohlrabi- und Kartoffelschalen auf dem Fußboden lagen. Sie musste daran denken, einen Küchendienst mit den Kindern zu organisieren. Selbst die Kleinsten konnten schon Geschirr abtragen. Die Großen würden abwaschen und die Stube fegen.
Um die restliche Suppe machte sie sich keine Sorgen, Wilhelm würde Hunger haben, wenn er heimkam. Bis dahin musste sie einigermaßen Ordnung geschaffen haben. Wenn sie doch nur ihre rechte Hand besser benutzen könnte! Nicht einmal die Blasen hatte sie aufgestochen. Sie eilte zurück in die Küche, kratzte mit der linken Hand ungeschickt die Asche aus dem Ofen und fachte das Herdfeuer wieder an. Dann trug sie Asche und Gemüseabfälle in den Garten und lief zum Brunnen. Das Wasserholen kostete viel Zeit und Kraft. Aber das konnten ab morgen die größeren Jungen übernehmen.
Sie zerrte gerade den vollen Eimer über den Brunnenrand, als aus der Tür des Backhauses eine kleine, gebückte Gestalt trat und den Anger hinauf huschte.
„Christine!“ Sie freute sich wirklich, das vertraute Gesicht zu sehen.
Die Pastorsfrau blickte erschrocken auf, doch lachte sie, als sie ihren ehemaligen Gast erkannte; ein Anblick, der Magdalena erneut durch Mark und Bein ging. Sie umarmten sich kurz, dann standen sie still am Brunnen, den Eimer zwischen sich. Christine hatte ein warmes, duftendes Brot unter dem Arm und sah betreten zu Boden. Magdalena stupste sie an. „Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen unser Haus. Es sieht heute sehr unordentlich aus, denn die Zigeunerkinder waren bei uns essen. Morgen kommen sie wieder. Wenn Sie wollen ...“
Christine unterbrach sie, indem sie einen Finger hob und den Kopf schüttelte. Dann bewegte sie die Hand wie einen Fisch, der aus dem Wasser springt, zeigte auf das Backhaus und nickte.
Magdalena verstand nicht, was sie meinte, doch Christine wiederholte immer nur die gleichen Gesten, drückte ihr schließlich die Hand und ging in Richtung Wenden davon. Nach ein paar Schritten drehte sie sich um und winkte.
Seufzend griff Magdalena nach ihrem Eimer. Vom Hof hinter der katholischen Schule drang Kinderlärm. Hier war gerade Pause. Sie sollten vielleicht den Lehrer aufsuchen, um sich vorzustellen. Immerhin waren sie beinahe so etwas wie Kollegen. Weiter unten in der Straße sah sie ein paar Männer stehen, die wild mit den Armen fuchtelten und diskutierten. Der Kleidung nach offenbar Zigeuner. Doch einer von ihnen, ein kräftiger Mann mit breitem Hut, sah aus wie der Schulze. Sie beschleunigte ihre Schritte. Wenn Henkel aus Nordhausen zurück war, dann würde Wilhelm auch gleich da sein.
In der Zeit, in der sich das Wasser auf dem Herd erwärmte, räumte sie Becher und Besteck in einen Füllkorb und trug alles in die Küche. Mit dem ersten warmen Wasser schrubbte sie die Holzplatte des Tisches wieder blank. Gerade als sie überlegte, wie sie mit einer Hand abwaschen sollte, hörte sie die Haustür knarren.
„Willi! Endlich.“ Sie wirbelte in den Flur und fiel ihm um den Hals. „Es gibt so viel zu erzählen. Du glaubst nicht, was wir heute alles erreicht haben.“ Sie zerrte ihn in die Stube, kaum, dass er die Stiefel von den Füßen gezogen hatte. „Ich war bei Käthchen, sie hat schon für die Kinder gekocht, sie waren hier und haben gegessen. Und morgen kommen sie wieder!“
Wilhelm nickte matt, erst jetzt sah sie, wie müde er war. „Du musst hungrig sein, ich hole dir eine Schüssel Suppe.“ Sie sprang auf und wollte hinaus, doch er fasste nach ihrer Hand.
Sie zuckte zurück.
„Was ist mit deiner Hand?“
„Ach, nichts. Ein wenig verbrannt. Es wäre schön, wenn du nachher den Abwasch erledigen könntest, mit nur einer Hand wird es bei mir nichts werden.“
Wilhelm begutachtete stirnrunzelnd die Blasen.
„Wie ist es beim Landrat gelaufen?“ Plötzlich fürchtete sie sich vor seiner Antwort, er wirkte so seltsam bedrückt. Sie entzog ihm die Hand und setzte sich zu ihm an den Tisch.
„Oh, eigentlich sehr gut. Der Schulze war auch dort, stell dir vor. Gestern hat er kein Wort davon gesagt. Ein komischer Hund, ich traue ihm nicht.“
„Hm, so ähnlich drückte sich Käthchen ebenfalls aus.“
„Mit den Rechnungen für unsere Möbel war alles in Ordnung, wir bekommen jeden Monat 100 Taler für uns und die Mission, alles andere müssen wir selbst erwirtschaften. Dem Schulzen hat er ordentlich ins Gewissen geredet, er soll uns unterstützen, wo es nur geht.“ Seine Hand fuhr über die Tischplatte, die noch feucht war.
Magdalena rückte dicht an ihn heran und drückte ihm einen Kuss auf die Wange. „Das ist wunderbar. Jetzt geht es endlich vorwärts, du wirst sehen. Morgen Nachmittag kommen die Jungen zum Unterricht zu dir. Für vormittags habe ich die Mädchen bestellt. Ich muss mir überlegen, womit ich sie beschäftige.“
„Freu dich nicht zu früh. Ich habe so ein Gefühl, als liefe hier etwas schief. Der Schulze hatte sich mit mir verabredet, gemeinsam nach Hause zu gehen. Eigentlich hatte das von Arnstedt vorgeschlagen, er meinte, wir könnten gleich ein paar Dinge, während der drei Stunden Fußweg, bereden. Nun wollte ich unbedingt bei Pfarrer Schonau vorsprechen, wegen der Spendenaufrufe in den Nordhäuser Kirchen. Ich bat also den Schulzen, an der Alten Mühle auf mich zu warten. Als ich dort ankam, war er bereits weg.“
„Vielleicht hat er etwas falsch verstanden. Oder er hat sich verspätet.“
„Er muss vor mir hier gewesen sein. Als ich eben ins Dorf kam, sah ich die Zigeunerkinder weglaufen. Sie rannten vor mir davon, als sei ich der Leibhaftige. Kein einziger Zigeuner war zu sehen, als ich die Straße hinaufging, nicht einmal hinter den Fensterscheiben. Der Schulze hat ihnen irgendetwas erzählt, ich weiß nicht was, aber es war nichts Gutes.“
Magdalena nickte nachdenklich. „Das könnte sein. Er stand, vielleicht ist es eine Stunde her, mit einigen Zigeunermännern unten in der Straße, sie haben heftig diskutiert.“
Wilhelm schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. „Siehst du, der Hund ist vor mir von Nordhausen weg. Es fuchst ihn gewaltig, dass nicht nach seiner Pfeife getanzt wird. Rennt nach Hause und erzählt den Zigeunern irgendwelche Gräuelmärchen. Es würde mich nicht wundern, wenn sie morgen früh nicht kommen, deine Mädchen.“
„Wenn sie Hunger haben, werden sie schon vor der Tür stehen, warte es nur ab.“ Ihr Blick blieb an dem unvollendeten Brief an ihre Eltern hängen. Sie schob ihn Wilhelm zu. „Könntest du ihn für mich beenden, ohne dass Maman etwas bemerkt?“
Er grinste. „Das wird schwierig, deine Mutter liest zwischen den Zeilen Dinge, über die wir beim Schreiben nicht einmal nachgedacht haben. Ich will es versuchen. Doch vorher muss ich essen, sonst fällt mir der Federhalter aus der Hand.“
Sie sprang auf und rief: „Das mach ich mit links! Im wahrhaftigen Sinne des Wortes.“ Sie hob ihre linke Hand. „Die Empfehlung des Tages: Suppe aus dem Inneren einer zarten Geiß à la Käthchen! Dazu blau-weiße Milch von der Schwarz-Weißen.“
Am späten Abend erledigte Wilhelm den Abwasch. Vorher hatten sie sich geliebt, er in der Hoffnung, seine schlimmen Vorahnungen für kurze Zeit zu vergessen, sie dagegen voll glücklicher Genugtuung. Doch selbst Magdalena hatte kein Interesse daran gezeigt, das Haus an diesem Tag noch einmal zu verlassen, obwohl sie Stunden zuvor fest entschlossen gewesen war, den Bauer zur Rede zu stellen, der die Molke geliefert hatte. Als sie das Geschirr einräumte, stellte sie fest, dass drei Löffel fehlten. Sie suchten in der Stube, sogar auf dem Fußboden, doch sie fanden sie nicht. Es gab nur einen Schluss: Sie waren gestohlen worden.
Der Morgen dämmerte erst, da stand Magdalena bereits auf, benutzte das Nachtgeschirr und wischte die angelaufenen Fensterscheiben trocken.
„Kannst du auch nicht mehr schlafen?“, fragte Wilhelm überflüssigerweise und kroch stöhnend aus dem Bett.
„Ich muss mir etwas für die Mädchen einfallen lassen. Ich könnte ihnen zeigen, wie man Sachen stopft.“ Sie schlüpfte zitternd in ihre Unterwäsche. Es war empfindlich kalt im Schlafzimmer.
„Sie haben keine Sachen, was sollten sie stopfen?“, fragte ihr Mann pragmatisch und hangelte nach seinen Pantoffeln.
„Ha, das weißt du noch nicht. Käthchen hat ihnen Hemden genäht, also den Mädchen jedenfalls, die gar nichts auf dem Leibe hatten. Aus unserem Linnen. Kannst du mir helfen, ich kann mit einer Hand keine Schleifen zubinden.“
„Du hast dein gutes Linnen geopfert? Wie viel davon?“ Er trat hinter sie und schlang seine Arme um ihren Leib.
Sie kuschelte sich an ihn. „So an die fünfzehn Stück, glaube ich. Ein paar sind übrig. Maman muss es ja nicht erfahren.“
„Ich liebe dich, weißt du das? Ohne dich wäre ich hier verraten und verkauft.“ Er küsste sie, bevor sie antworten konnte, und schob sie zurück ins Bett.
„Wilhelm Blankenburg, wir haben so viel zu erledigen. Was fällt dir ein?“, kicherte sie und versuchte, ihm zu entwischen. „Außerdem ist das ungerecht, ich bin verletzt!“
„Ungerecht? Das Leben ist nicht gerecht“, sagte Wilhelm und verschloss ihr den Mund mit einem Kuss.
Als sie endlich beim Frühstück saßen, schob sich die Sonne bereits über die Dächer der gegenüberliegenden Häuser.
„Gleich neun!“, stöhnte Magdalena. „Ich muss meinen Wollkorb holen, ich habe mir überlegt, dass ich ihnen das Stricken beibringen werde. Eine Frau muss stricken können, wollene Tücher und Strümpfe braucht eine Familie immer, vor allem im Winter. Vielleicht sollten wir die Frauen der Gemeinden aufrufen, Wollreste und Nadeln zu spenden.“
Wilhelm schwieg, er ahnte nichts Gutes. Tatsächlich rückte der kleine Zeiger des Regulators in der Stube der Neun bedrohlich näher. Draußen auf der Dorfstraße hörte er lediglich das Fuhrwerk eines Bauern, der verspätet zum Markt nach Bleicherode fuhr. Als das Geräusch verklang, wurde es still auf der Straße. Magdalena stand am Fenster. Zum wiederholten Male wischte sie das Kondenswasser von den Scheiben. Der Regulator schlug neun Mal.
„Sie kommen nicht“, sagte Wilhelm in die nachfolgende Stille hinein.
„Dann hole ich sie.“ Ihre Stimme klang gefährlich ruhig.
Wilhelm stand auf und griff nach seiner Jacke. „Ich begleite dich.“
„Nein.“ Diesen bestimmten Ton kannte er noch nicht. „Ich gehe allein. Ich habe gestern Vertrauen aufgebaut. Der Schulze hat gewiss nur dich verleumdet. Mit mir werden sie kommen.“
Er musste ihr recht geben. Vorsichtig half er ihr in die Jacke. „Viel Glück.“
Sie ging zuerst nach nebenan zum Haus des Schneiders. Im Stillen hoffte sie auf Christians Hilfe, obwohl sie wusste, dass er in seiner Familie noch nicht in der Position war, etwas anzuordnen. Sie trat in den Hausflur und lauschte. Im Zimmer der Zigeuner war es ruhig. „Hallo?“ Aus ihrer Kehle kam nur ein Krächzen. Sie räusperte sich. „Frau Weiß?“
Es rumorte hinter der Tür, Stimmen stritten sich leise. Sie machte einen Schritt nach vorn und klopfte. Nach einer Weile steckte Christians Mutter den Kopf zur Tür heraus, ohne sie weiter als nötig zu öffnen. „Ja?“
„Ich möchte die Mädchen zum Unterricht abholen. Sie hatten versprochen, heute früh zu kommen.“
„Sie werden nicht kommen.“ Frau Weiß war im Begriff, die Tür zuzuschlagen.
Geistesgegenwärtig trat Magdalena einen Schritt vor und schob ihren Fuß zwischen Tür und Rahmen. „Warum denn nicht? Sie haben sich gestern doch bei mir wohlgefühlt. Wir haben zusammen gegessen, Käthchen hatte gekocht. Das tut sie heute wieder.“
„Wir verkaufen unsere Kinder nicht für ein Mittagessen“, fauchte die dunkelhäutige Frau und zog an der Tür.
Magdalena schloss für einen kurzen Moment die Augen und schluckte den aufkommenden Zorn hinunter. „Frau Weiß, bitte, ich will Ihren Kindern doch nichts Böses. Darf ich hereinkommen? Ich will Ihnen erklären, was ich vorhabe.“
Sie hörte erregtes Tuscheln, konnte aber nur Frauenstimmen heraushören. „Bitte, Frau Weiß!“
Der Druck auf ihren Fuß ließ nach. Sie schob sich durch die Tür, hinter der die Zigeunerin argwöhnisch lauerte. Fünf oder sechs nackte Mädchen saßen zusammengedrängt in der Ecke unter dem Fenster und hielten die Köpfe gesenkt. Weder die Männer noch die Jungen waren anwesend. Die alte Frau lag an der Wand und schlief, zwei weitere Frauen sahen ihr vom Fußboden aus feindselig entgegen. Eine von ihnen trug den schlafenden Säugling auf dem Arm.
„Warum dieses plötzliche Misstrauen?“, fragte Magdalena ohne Umschweife. „Was hat Ihnen der Dorfschulze erzählt?“
Sie sah sofort, dass sie ins Schwarze getroffen hatte. Die Frauen auf dem Fußboden tauschten Blicke mit Christians Mutter. Doch sie schwiegen.
„Egal, was es war, er hat gelogen. Er arbeitet gegen uns, das müssen Sie mir glauben! Er hat kein Interesse daran, dass es Ihnen besser geht. Warum sollten Ihre Männer Geld verdienen und mit Ihren Familien in eigenen Häusern leben? Uns hat er erzählt, er wünscht Ihr Volk möglichst weit weg von seinem Dorf. Hat er das auch zu Ihnen gesagt?“
Die Frauen sahen sich nachdenklich an. Frau Weiß trat endlich von der Tür weg und kam näher.
Magdalena setzte nach: „Was ist so schlimm daran, wenn Ihre Kinder jeden Tag eine warme Mahlzeit bekommen? Nebenbei bringe ich ihnen Nützliches bei, heute wollte ich die Mädchen stricken lehren. Sie könnten sich dann selbst Strümpfe stricken oder wollene Tücher. Ist es nicht eine Schande, dass die Kleinen Sommer wie Winter nackt herumlaufen? Haben Sie denn kein Mitgefühl?“ Magdalena sah, wie die Augen der beiden Frauen auf dem Boden größer wurden, und redete weiter. „Ihre Kinder werden bei uns Lesen lernen, Sie sollten wissen, wie wichtig das ist. Sie werden später Verträge selbst lesen können, bevor sie ihre Unterschrift darunter setzen. Niemand wird sie mehr übers Ohr hauen können. Warum gönnen Sie Ihren Kindern diese Vorteile nicht?“
Frau Weiß stemmte die Hände in die Hüften. „Der Schulze sagte, ihr nehmt uns die Kinder weg. Wir sollen ins Arbeitshaus kommen, um arbeiten zu lernen.“
„‚Die Faulenzerei werden sie euch austreiben‘, das hat er gesagt“, ergänzte die Frau auf dem Fußboden.
Magdalena wurde rot, der Zorn schnürte ihr die Luft ab. „Dieser Bastard! Er lügt, warum glauben Sie ihm?“
„Er war gestern bei eurem bulibasha in der Stadt.“
Magdalena schnaufte. „Es stimmt, dass er mit meinem Mann in Nordhausen war, beim Landrat. Alles andere ist gelogen. Sie haben beraten, wie wir genug Geld beschaffen können, um Ihnen zu helfen. Das Essen, Bücher, Schreibzeug und Kleidung, das kostet alles viel Geld. Dem Schulzen wurde aufgetragen, uns zu unterstützen.“
„Hat der bulibasha euch Geld gegeben?“ Erneut mischte sich die andere Frau ein.
„Ja, für den Anfang. Aber es wird nicht lange reichen. Wir müssen Spenden sammeln. Unser Missionsverein schickt Geld, die Kirche wird uns helfen. Meine Eltern in Nürnberg sammeln für unsere Mission in ihrer Kirchengemeinde. In Nordhausen und in Bleicherode werden die Pastoren für Sie und Ihre Kinder beten und um Spenden bitten.“
Die Frau mit dem Säugling auf dem Arm stand auf. „Wie kommt es, dass eure Leute es plötzlich so gut mit uns meinen?“, fragte sie. „Wir sind doch nur Zigeuner.“
„Sie sind Geschöpfe Gottes, genau wie wir. Schon Jesus sagte, was ihr getan habt, dem Geringsten meiner Brüder, das habt ihr mir getan. Wir sind Christen, wir leben nach den Gesetzen Gottes, die sagen: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“
„Wir sind katholisch getauft“, wandte die junge Frau erneut ein.
„Wir sind Christen, ob katholisch oder protestantisch, vor Gott sind wir gleich.“ Magdalena wünschte sich Wilhelm herbei, er hätte die besseren Argumente parat.
Doch die Zigeunerin schien zufrieden mit ihrer Antwort. Sie blickte abwartend Christians Mutter an. Die rang mit einer Entscheidung.
Hilfe kam schließlich aus der Ecke der Mädchen, die bisher schweigend der Diskussion gelauscht hatten. „Können wir nicht mit der gadschi gehen? Bitte! Käthchen kocht für uns.“ Plötzlich waren sie alle auf den Beinen und wirbelten um die Zigeunerfrau herum. „Bitte!“
„Gut.“ Frau Weiß hob die Hände. „Nun geht schon, gut.“
„Was bedeutet eigentlich Gatschi?“, fragte Magdalena, die ihren Triumph zu verbergen suchte.
„Es ist unser Wort für eine deutsche Frau“, antwortete die Zigeunerin. „Nimm die Mädchen heute mit, aber das letzte Wort hat der Bulibasha. Wir werden ihn erst fragen müssen, was morgen und in Zukunft geschehen soll.“
„Wo sind die Jungen? Kommen sie nachher zum Unterricht?“
Die Frauen wichen ihrem Blick aus. Sie befürchtete, dass sie erneut Überzeugungsarbeit leisten musste.
„Sie sind mit den Männern auf den Markt nach Bleicherode gegangen. Sie kehren gegen Mittag zurück“, antwortete Christians Mutter.
„Werden sie kommen?“, hakte Magdalena nach.
„Ich werde mich dafür einsetzen.“
Magdalena wandte sich an die Kinder, die schon an der Tür standen. „Bringt die Löffel von gestern wieder mit. Ich habe sonst nicht genug für alle.“ Und schnell, bevor die Peinlichkeit dieser Aufforderung bewusst wurde, fügte sie hinzu: „Und zieht euch an, ich gehe die anderen Mädchen holen.“
Während sie zur Tür ging, drehte sie sich um: „Würden Sie mich begleiten, um die anderen Mütter zu überzeugen?“
Frau Weiß zögerte kurz, nickte dann aber und griff nach einem Tuch, das sie sich um die Schulter legte.