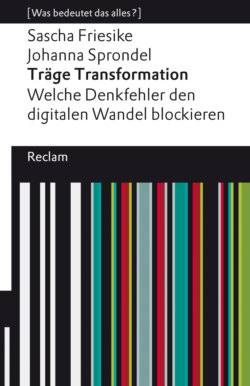Читать книгу Träge Transformation. Welche Denkfehler den digitalen Wandel blockieren - Johanna Sprondel - Страница 5
»Am Anfang steht die Vision«
ОглавлениеWer schon mal an einer Führungskräftetagung unter dem Motto »digitale Transformation« teilgenommen hat, ist möglicherweise über eine Kreativitätsmethode gestolpert, die man »Moonshot Thinking« nennt. Moonshot Thinking verdankt seinen Namen dem US-amerikanischen Apollo-Programm, dem in wenigen Jahren das Unglaubliche gelungen ist, einen Menschen auf dem Mond abzusetzen und heil wieder auf die Erde zurückzubringen
Entsprechend mutig und innovationsfreudig soll die Methode das Denken in inkrementellen (also schrittweisen) Verbesserungen aufbrechen und dazu animieren, große Visionen zu ersinnen. Es geht um die radikale Abkehr vom Tagesgeschäft, wenn man so mag. Wie würde unsere Organisation aussehen, wenn die digitale Transformation keine zehnprozentige Verbesserung bedeuten würde, sondern wir uns absolut gesehen um den Faktor zehn verbessern könnten? Mit diesem Arbeitsauftrag machen sich gestandene Managerinnen und Manager dann ans Werk und entwickeln – üblicherweise unter hohem Zeitdruck – bunte Poster, die die Organisation von Morgen zumindest in Grundzügen skizzieren sollen.
Der Vorteil der Methode besteht darin, dass die Tätigkeit sehr kurzweilig ist und es keine falsche Lösung gibt, ja: dass es gar keine falsche Lösung geben kann. Wer darüber nachdenkt, wie eine Organisation aussehen könnte, die wenig mit der heutigen Organisation zu tun hat, genießt einen so hohen Grad an Freiheit, dass festgehalten werden kann, was immer man will. Sind die Ergebnisse besonders abwegig, so wird von der Moderation darauf hingewiesen, dass dies gar nicht schlimm sei, sondern dass es ganz im Gegenteil eben einer neuen Fehlerkultur bedürfe, die endlich auch einmal unorthodoxe Ideen fördere.
Die Methode entwickelt meist eine verblüffende Eigendynamik, die den Teilnehmenden selbst nicht immer ersichtlich ist. Ist man indes Zaungast bei mehreren solcher Führungskräftetagungen von ganz unterschiedlichen Organisationen, so fällt auf, dass sich die entwickelten Moonshots erstaunlich ähnlich sind. Vor ein paar Jahren, als »Big Data« das Schlagwort der Stunde war, sahen die Moonshots gerne vor, dass man sich von der heutigen Organisationsform lösen müsse, um sich hin zu einem »Data Analytics Provider« zu wandeln, der dann die Datengrundlage für eine ganze Branche legen könnte.
Als die »Plattformisierung« zum Mode- bzw. Buzzword avancierte, zeigten die Ergebnisse der Moonshot-Poster zweiseitige Märkte. Geschäftsmodelle also, bei denen Anbieter mit Kunden vernetzt werden. Airbnb, Uber oder YouTube lieferten hierfür erfolgreiche Beispiele, die dann auf jede erdenkliche Branche übertragen wurden.
Im Zuge der aktuellen Renaissance der künstlichen Intelligenz steht nun natürlich ebendiese Technologie im Zentrum zukünftiger Geschäftsmodelle, die aus der Moonshot-Methode keimen.
Dabei wird die Moonshot-Methode typischerweise verwendet, um die zukünftige Entwicklung einer bestehenden Organisation auszuloten, doch beziehen sich die Ergebnisse fast nie auf die heutige Organisation – höchstens noch auf die Branche allgemein.
Die Managementforschung hat sich in den letzten Jahrzehnten viele Gedanken über Ressourcen gemacht – über materielle Ressourcen, wie den Zugang zu Rohstoffen, aber auch immaterielle Ressourcen, wie Wissen oder Fähigkeiten. Ein Verständnis von Organisationen, das besonders populär ist, versteht Organisationen als Einheiten, die die Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen, besser einsetzen können als andere.
Dabei ist unumstritten, dass Organisationen ständigen Veränderungen unterworfen sind und dass gerade die Fähigkeit, Ressourcen dynamisch zu rekonfigurieren, sie wettbewerbsfähig macht. Eine gesunde Organisation arbeitet also in einem Jahr anders, als sie das heute tut. Sie reagiert auf Veränderungen oder ist selber Antriebsfeder für Veränderungen. Dieses Verständnis setzt voraus, dass Ressourcen und deren Nutzung kontinuierlich angepasst werden. Oder anders ausgedrückt: Bestimmte Praktiken müssen aktiv ›verlernt‹ werden, um sie aus der Organisation zu verdrängen, andere Fähigkeiten müssen erst noch entwickelt werden. Diese Prozesse laufen in einer ›gesunden‹ Organisation kontinuierlich ab, im Kleinen, wenn spezielle Abläufe verbessert oder von Grund auf neu aufgesetzt werden, und im Großen, wenn strategische Entscheidungen eine ganze Organisation neu ausrichten sollen.
Ergebnisse der Moonshot-Methode, die suggerieren, Vorschläge für eine digital transformierte Organisation zu bieten, haben indes in aller Regel nichts mit den realen Ressourcen zu tun, die eine Organisation heute ausmachen.
Das wirft zwei Fragen auf:
1 Wie soll ein Prozess aussehen, der alle heutigen Ressourcen abschneidet und vollkommen neue aufbaut?
2 Warum sollte ausgerechnet die Organisation selbst dazu in der Lage sein, diese Schritte sinnvoll allein aus sich selbst heraus zu entwickeln? Wäre es nicht viel leichter, die in der Methode skizzierte Organisation vollkommen neu aufzubauen, beispielsweise als Start-up?
Doch zeichnet einen Moonshot noch eine andere Eigenschaft aus. Die visionäre Idee hat eine Strahlkraft, einen »Halo-Effect«, der von den realen, heutigen Problemen ablenken kann. Wer möchte sich schon mit der Banalität des Alltags auseinandersetzen, wenn man sich auch in eine Vision flüchten kann?
Dieser Nebeneffekt eines Moonshots wird deutlich an einem Interview, das die damalige »Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung« Dorothee »Doro« Bär der ZDF-Moderatorin Marietta Slomka gab. Auf die Frage, wann man in Deutschland denn endlich dem lang angekündigten Breitbandausbau nachkommen würde (zu dem Zeitpunkt waren in Litauen 71 Prozent aller Breitbandanschlüsse aus Glasfaser, während es in Deutschland 2,3 Prozent waren), lautete Bärs inzwischen legendäre Antwort:
Digitalisierung ist doch nicht nur der Breitbandausbau […]. Mein Thema ist nicht: Funktioniert jetzt hier die Straße? […] Aber das Thema muss doch sein: Kann ich auf dieser Infrastruktur, die wir haben, dann auch autonom fahren? Habe ich die Möglichkeit auch zum Beispiel mit einem Flugtaxi durch die Gegend zu können?
Die breite Verfügbarkeit von Flugtaxis ist ein typischer Moonshot. Jeder, der das Interview sieht, kann nicht anders, als sich auszumalen, wie hinreißend es wäre, in ein Flugtaxi zu steigen. Sofort vergibt man der CSU, dass man nie in den Münchner Hauptbahnhof »einsteigen« konnte, um dort in zehn Minuten einen Flug zu starten, wie Edmund Stoiber es in einem früheren Moonshot doch versprochen hatte. Das Bild eines Flugtaxis entschädigt für alles. Und während man sein zukünftiges Selbst in einem Flugtaxi sieht, hat man schon vergessen, dass es in dem Interview eigentlich um etwas ganz anderes ging, um etwas viel Dringenderes, aber eben auch dem Anschein nach viel Banaleres: um den mangelhaften Glasfaserausbau in Deutschland, der im wahrsten Sinne des Wortes die Grundlage ausmacht, auf der eine digitale Transformation überhaupt erst stattfinden kann.
Konstruktive Utopien können Anstöße geben, gewachsene Strukturen in Frage zu stellen. Das kann helfen, die Trägheit des Alltagsgeschäfts zu überwinden, und genau darin besteht die eigentliche Motivation hinter der Moonshot-Methode. Wenn die entwickelte Vision jedoch vollkommen entkoppelt dasteht und es keine sinnvollen Verbindungslinien vom Hier und Jetzt zum utopischen Übermorgen gibt, dann ist die Vision bestenfalls wertlos und schlimmstenfalls kontraproduktiv. Kontraproduktiv, weil sie ablenkt von den heutigen Problemen, die immer noch nicht angegangen wurden und damit die Wettbewerbsfähigkeit in einer viel näheren Zukunft gefährden.
Ganz offensichtlich hat das, was man heute als Moonshot-Methode versteht, also nur wenig mit dem Apollo-Programm zu tun: Weder steht eine weltpolitische Führungsposition auf dem Spiel – wir haben eingangs gesehen, dass diese inzwischen in weite Ferne gerückt ist – noch, und das ist dramatischer, sind wesentliche Grundlagen für einen Moonshot bereits vorhanden.
Beides war der Fall, als John F. Kennedy am 25. Mai 1961 ankündigte, dass bis zum Ende des Jahrzehnts ein Amerikaner auf dem Mond wandeln werde. Am 12. April 1961 war Juri Gagarin als erster Mensch ins Weltall geflogen und hatte in der Vostok die Erde einmal orbital umrundet – während die NASA noch den ersten suborbitalen Flug plante.
Nach dem »Sputnikschock« des Jahres 1957 war es der damaligen Sowjetunion erneut geglückt, ihre Vorherrschaft in der Raumfahrt zu beweisen. Zugleich hatte die Sowjetunion auch gezeigt, dass man die Atmosphäre der Erde verlassen und lebendig wieder zur Erde zurückkehren konnte. Gagarins Flug, ein sehr konkretes Ereignis also, aus dem sich sowohl eine Bedrohung als auch Erkenntnisse ergaben, war es dann auch, was den Anlass dafür gab, dass Kennedy seinen Vizepräsidenten Lyndon B. Johnson umgehend damit beauftragte, bei der NASA Informationen über Möglichkeiten und Chancen einzuholen, wie man der damaligen Sowjetunion ihre Führungsposition im Weltall abjagen könnte. Konkret fragte Kennedy nach Möglichkeiten des »leapfrogging«, um die Sowjetunion einzuholen, quasi mit einem ›riesigen Bocksprung‹ die eigentlich in einem Entwicklungsprozess immer geduldig nacheinander zu nehmenden Stufen auszulassen bzw. zu überspringen. Erst als Kennedy die Bedingungen für solch einen Sprung eingehend geprüft hatte, und erst nachdem Alan Shepard am 5. Mai 1961 als zweiter Mensch ins Weltall geflogen war, wandte Kennedy sich an den Kongress. »Our eagerness to share its meaning is not governed by the efforts of others. We go into space because whatever mankind must undertake, free men must fully share.«2 Raum, sich in Utopien zu verrennen, war in diesem (inflationsbereinigt) 283 Milliarden Dollar teuren Projekt nicht vorgesehen. Die Recommendations for our National Space Program: Changes, Policies, Goals, verfasst vom NASA-Administrator James E. Webb und dem damaligen US-Verteidigungsminister Robert McNamara, die Vizepräsident Johnson am 8. Mai 1961 vorgelegt wurden, enden mit den Sätzen:
Finally, even if the Soviets get there first, as they may, and as some think they will, it is better for us to get there second than not at all. In any event, we will have mastered the technology. If we fail to accept this challenge it may be interpreted as a lack of national vigor and capacity to respond.3
Wenn man das wirklich zu verstehen sucht und idealerweise auch beherzigt, wäre auf manch einer Führungskräftetagung viel erreicht.